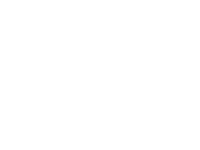In Plossig in Sachsen-Anhalt haucht der Mühlen- und Dampfmaschinenverein nicht nur einer alten Bockwindmühle neues Leben ein. Er will auch das historische Sägewerk erhalten.
Das Pfingstwochenende hatten sich die Mitglieder des Mühlen- und Dampfmaschinenvereins in Plossig (Landkreis Wittenberg) ganz anders vorstellt. Stolz wollten sie ihren Besuchern zum traditionellen Mühlentag, der aufgrund von Corona abgesagt wurde, ihre Bockwindmühle präsentieren. Immerhin steckt in dem in dem fast 200-jährigen Kulturdenkmal nicht nur viel Geschichte, sondern auch sehr viel Enthusiasmus der 27 Vereinsmitglieder.
Ursprünglich stand die Mühle im etwa 23 Kilometer entfernten Schweinitz. Noch bis Ende der 1950 Jahre war sie dort betrieben worden, dann hatte zwischen Holzstapeln und alten Obstbäumen an ihr der Zahn der Zeit genagt. Schwamm, Pilz und Holzwurm hatten sich breitgemacht, und die Mühle sollte abgerissen werden. Das wussten die Mitglieder des Mühlen- und Dampfmaschinenvereins 2017 dank ihrer Leidenschaft für historische Technik zu verhindern, retteten die alte Dame und geben ihr in Plossig ein neues Zuhause.
Fördermittel und viel Herzblut

Seit zwei Jahren investieren sie viel Zeit und vor allem Herzblut in den denkmalgerechten Wiederaufbau. „Am Anfang war es lediglich die Liebe zu der alten Mühle, die wir unbedingt erhalten wollten. Und keiner von uns ahnte wirklich, was da auf den Verein und das Dorf zukommt“, berichtet Bauingenieur Bernd Seidel (61), der nicht nur ehrenamtlich die Baukoordination übernommen, sondern sich von Beginn an auch um Anträge und Genehmigungen gekümmert hat und dabei so manche bürokratische Hürde meistern musste. „Er hat sich die Finger wund geschrieben“, lacht Vereinschef Wilfried Pötzsch (70). Doch das mit Erfolg.
Bisher sind 170.000 Euro aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums in den Wiederaufbau geflossen, auch die Sparkassen-Stiftung konnte für eine Förderung gewonnen werden. Die landwirtschaftlichen Betriebe der Region helfen mit Logistik und Technik und nicht zuletzt die Vereinsmitglieder selbst mit unzähligen unentgeltlichen Arbeitsstunden. „Und vor einer Woche haben wir die Zusicherung für weitere 90.000 Euro Leader-Förderung bekommen, um die Mühle mahlfertig wiederherzurichten“, freut sich Bernd Seidel. Dennoch hofft der Verein dringend auf weitere Sponsoren und Spenden, ist doch ein Eigenanteil von 25 Prozent aufzubringen, was für den kleinen Verein schwer zu stemmen ist. „Jeder Cent zählt“, so Pötzsch.
Im Oktober 2018 war Grundsteinlegung, und im Oktober 2019 wurde Richtfest gefeiert, bei dem, so will es die Tradition, in den Mehlbalken der Mühle die letzten Nägel eingeschlagen wurden. Allerdings konnte von der alten hölzernen Substanz der Mühle nur wenig gerettet werden. Anders schaut es mit der historischen Technik aus, die zum Teil noch funktionsfähig ist und nach der Aufarbeitung eingebaut werden soll. Auch die Flügel, die ebenfalls neu entstehen, müssen noch montiert werden.
Doch mit einem fixen Datum für die Eröffnung der Mühle hält sich der Vereinschef mit einem schelmischen Augenzwinkern Richtung BER erst mal zurück. Ziel ist es auf jeden Fall, dass die Mühle wieder voll funktionsfähig ist und betrieben wird. Dafür konnte der Verein Müllerin Ina Hänsch-Goldau aus Jüterbog gewinnen. Doch nicht nur Mehl soll in Plossig gemahlen werden. „Wir wollen rund um die Mühle unseren Besu- chern auch den Prozess vom Korn bis zum Brot zeigen und dafür alte Technik einbinden.“ Dafür wiederum konnte bereits jetzt als Mitstreiter der Lanz-Bulldog-Verein aus dem Nachbardorf begeistert werden. Auch soll ein gläsernes Bienenhaus entstehen, und ein junger Imker will eng mit Schüler zusammenarbeiten, die auch ein Bienenvolk betreuen sollen. So ist die Mühle nicht das einzige Projekt des Vereins, der sich 2015 vor allem mit dem Ziel gegründet hat, alte Technik zu erhalten.
Dampflokomobile im alten Sägewerk
Dazu gehört auch das Dampfsäge & Hobelwerk. Herzstück des über 100-jährigen Betriebes ist eine Dampflokomobile, die 1939 in Magdeburg gebaut wurde und noch voll funktionsfähig ist. Zu besonderen Anlässen wie dem jährlichen Standmotorentreffen wird sie auf Touren gebracht wird. „Diese Maschine ist eine von nur noch drei, die deutschlandweit in Betrieb sind“, weiß Gerhard Schmidt (69), der gemeinsam mit seinem Bruder Hartmut (65) viel Leidenschaft, Geld und Zeit in den Erhalt der historischen Dampflokomobile und ins Sägewerk mit seinen alten Loren und Gattern steckt.
Und dann steht an einem Feldrand des Dorfes noch ein einst von der Landwirtschaft genutzter Trafoturm. „Daraus soll ein Aussichtsturm mit Tierhotel werden,“ erklärt Biologe Dr. Bernd Simon. Einziehen sollen zum Beispiel Eulen, Turmfalken, Fledermäuse. Zwei Außentreppen führen die Besucher zu einer Aussichtsplattform, von der aus der Blick über die Elbauenlandschaft schweifen kann, in der sich sogar ein weit über 1.000-jähriger slawischer Burgwall befindet. Der Verein hofft auch auf viele Radfahrer, die vom nahen Elb- und Schwarze-Elsterradweg aus einen Abstecher nach Plossig machen.
Doch bei all den optimistischen Plänen für die Zukunft zeigen sich auch Sorgenfalten auf der Stirn des Vereinschefs. Zum einen sind es Bedenken, das sich die Coronakrise auf Zahlung und Verteilung von Fördermitteln auswirken könnte, zum anderen sind es Nachwuchsprobleme. „Unser Bestreben ist es, die Jugend für die Vereinsarbeit zu begeistern in der Hoffnung, dass sie mit Elan fortführt und erhält, was wir bis jetzt schaffen und schaffen werden und auf das wir alle sehr stolz sind.“
Waldbrand bei Plessa: Feuer weitet sich aus
Seit Freitag steht ein Moorgebiet im Landkreis Elbe-Elster in Flammen. Die Feuerwehr versucht, den Brand durch Wasserschneisen einzudämmen – doch inzwischen soll sich das Feuer auf rund 100 ha ausgeweitet haben.
Von Veit Rösler (Text und Fotos)
Seit Freitagvormittag brennen nahe dem Ort Plessa Dutzende Hektar Wald in einem Brandenburger Moorgebiet. Bis zum Freitagabend haben etwa 140 Feuerwehrleute aus der Region Elbe-Elster versucht, die Ausbreitung des Brandes durch Wasserschneisen zu verhindern. Wegen dem sumpfigen Untergrund, können die Einsatzkräfte große Brandflächen nicht betreten. Durch die vielen Gräben in dem Gebiet ist auch für die ca. 45 Einsatzfahrzeuge der Zugang erschwert.

Unsere Top-Themen
- Friedenstreck 2025
- Roboter im Ökolandbau
- Schwerpunkt Kälbergesundheit
- Märkte und Preise
Bekämpfung aus der Luft
Die Löschwasserversorgung muss deshalb über lange Wegstrecken aufgebaut werden. Daneben hat ein Hubschrauber der Bundespolizei in schneller Frequenz mit Wasser aus dem Grünewalder Lauch bis zum Einbruch der Dunkelheit versucht, das Feuer aus der Luft zu bekämpfen. Mit im Einsatz sind THW, Polizei und die Katastrophenschutzeinheit.
Die Tiefe des Moorbrandes sei das Problem, sagt Kreisbrandmeister Steffen Ludewig. Das Feuer habe daneben unverhältnismäßig und ungewöhnlich schnell durchgezündet und eine sehr große Fläche von ca. 30 Hektar in Mitleidenschaft gezogen. Über Nacht waren 100 Kameraden im Einsatz.
Am Samstag um 9.00 Uhr sind Brandschutzeinheiten aus der Uckermark, aus Prenzlau und Angermünde zur Unterstützung im Einsatz. Mittlerweile sollen 100 Hektar betroffen sein. Das Feuerwehrdepot Hohenleipisch wurde als Zentrale eingerichtet. Am Samstagvormittag ab 10.00 Uhr wird das Feuer wieder aus der Luft bekämpft. red
Bildergalerie: Waldbrand bei Plessa
Thüringer Feldtage finden online stattDie Feldtage des TLLLR beginnen auch 2020 planmäßig. Los ging es auf den Versuchsfeldern in Großenstein und Friemar. Doch eine Besonderheit gibt es diesmal: Die Besucher sind nicht vor Ort, sondern vor ihren Bildschirmen.
Von Frank Hartmann, Erik Pilgermann und David Benzin
Die Feldtage des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) haben planmäßig begonnen. Start war in dieser Woche in Großenstein (Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen) sowie in Friemar (Pflanzenschutz und Düngung). Allerdings musste das Landesamt für Landwirtschaft auf die Coronasituation reagieren. Und so bieten die Fachleute des Landesamtes mit den Mitarbeitern der Versuchsstationen in diesem Jahr Online-Feldtage auf.
Damit hat die Behörde und einzige landwirtschaftliche Forschungs- und Versuchseinrichtung in Thüringen Neuland betreten. Und es ist ihr gelungen! Mit großem Aufwand wurden Videos erstellt. Fotos bilden die Versuchsanordnungen ab und dokumentieren Ergebnisse. Daneben finden sich Fachvorträge und Präsentationen, damit Praktiker detaillierte und umfassende Informationen erreichen.
Premiere: Die Thüringer Feldtage
des TLLLR online – Schauen Sie rein!
Zum Auftakt hieß es, die Stärke des Thüringer Versuchswesens sei seine Präsenz in vielen Regionen des Landes. Neben den Versuchsstationen gibt es zahlreiche Partnerbetriebe in der Praxis. Dies ermögliche es, auch Nischen- und Sonderkulturen, die regional neue Einkommensmöglichkeiten eröffnen, zu testen. Neben Dinkel oder Durum kämen Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen in Frage. Auch Öllein und Hanf lockerten die Fruchtfolgen auf, erhöhten die Attraktivität des Landschaftsbildes und böten Insekten Nahrungsangebote.
Bei den Versuchen zu Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, die in Thüringen auf über 1.000 ha angebaut werden, stehen Lösungen rund um den Pflanzenschutz, zur Düngung oder neue Aussaatverfahren im Mittelpunkt. Der Online-Feldtag informiert beispielsweise über den Herbizideinsatz in Herbst- und Frühjahrskamille, Melisse und Pfefferminze – jeweils mit variierten Applikationsterminen. Es gibt Versuche zum Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz in Kamille. Diskutiert werden die problematischen Perspektiven für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Für noch junge Kulturen wie Kapuzinerkresse und Blaue Malve fehlen Grundlagen für eine fundierte Berechnung des Düngebedarfs, womit die Düngeverordnung ins Spiel kommt (zum Feldversuchsführer Großenstein).
Letztere nimmt beim umfangreichen Online-Feldtag in Friemar zum Pflanzenschutz und zur Düngung breiten Raum ein. So finden sich Ergebnisse von N-Düngeversuchen in Winterweizen, Wintergerste, Durum oder Raps.
Videos gegen etwa Auskunft zur Feldmaussituation in Thüringen, zur Unkrautbekämpfung in Ackerbohnen oder zur Kombination von mechanischer und chemischer Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben (Hacke mit Bandspritzanlage).
Zudem sind Vorträge hinterlegt, etwa zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz in Winterweizen (zum Feldversuchsführer Friemar).
Novellierung der Düngeverordnung
Finden Sie hier die Zusammenstellung der wichtigsten Neurregelungen. Betroffen sind die Düngerbedarfsermittlung, die Aufzeichnungspflichten und die Bemessung der N-Gabe aus organischem Stickstoffdünger. Informieren Sie sich auch zu Gewässerabständen, zur Herbstdüngung und zu den neuen Sperrfristen. Ebenso von den Neuregelungen betroffen sind die Gebiete innerhalb der Nitratkulisse.
Bandspritze in Zuckerrüben
In Friemar wird ein Versuchsprojekt mit einer 18-reihigen Rübenhacke mit 45 cm Reihenabstand durchgeführt. Die Hacke ist unter anderem mit einem Kamerasystem ausgestattet. Hinzu kommt eine Bandspritzeinrichtung. Das Ziel dieser Technik ist eine deutliche Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln.
Unkrautbekämpfung in Futtererbsen
Auch in Futtererbsen kann die Unkrautbekämpfung mit Herbiziden oder mechanisch erfolgen. Bei Trockenheit kommen die Bodenwirkstoffe an ihre Grenzen. Bei lückigen Beständen besetzen die Unkräuter die Fehlstellen.
Unkraut in Ackerbohnen BEKÄMPfen
Die Unkrautbekämpfung in Ackerbohnen kann chemisch und mechanisch erfolgen. Alle Verfahren haben Stärken und Schwächen. Bestandesdichten und Wasserverhältnisse zeigen die Grenzen der verschieden Verfahren auf.
Bekämpfung von (resistentem) Ackerfuchsschwanz
in Winterweizen
Ackerbauliche Maßnahmen wie Saattermin, Walzen und der Einsatz von Striegeln vor der Aussaat können in Winterweizen Ackerfuchsschwanz zurückdrängen und bekämpfen. Sie sind wichtige Bausteine des Resistenzmanagements.
Aktuelles zum Feldmausbefall
Nicht nur am Versuchsstandort in Friemar tritt in diesem Jahr intensiver Feldmausbefall auf und kann sich noch aufschaukeln. Die Bekämpfung gestaltet sich aufgrund der starken Beschränkungen von zinkphosphidhaltigen Rodentiziden sehr schwierig.
Das TLLLR wird in den nächsten Wochen weitere Juni-Feldtage rund um ihre geplanten Termine online präsentieren. Die nächsten sind der Ökolandbau-Feldtag in Mittelsömmern bei Dr. Ralf Marold, die Sortenversuche in den Stationen oder der Durum-Feldtag Ende Juni in Friemar.
Die Materialien zu den Feldversuchen
Online-Feldversuchsführer Friemar
Im Feldversuchsführer werden zur Düngung sechs Versuche zu N, P und K präsentiert. Zum Pflanzenschutz stehen neun Versuche zu UKB, Funigzid und Wachstumsregler bereit. mehr
Online-Feldversuchsführer Großenstein
In Thüringen werden auf über 1.000 ha Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen angebaut. Der Feldversuchsführer gibt einen Überblick zu Lösungen rund um den Pflanzenschutz, Düngung und neue Aussaatverfahren. mehr
Die Agrar- und Umweltminister der Länder berieten heute mit dem Bund und der EU-Kommission über den Green Deal und die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Aus Thüringer Sicht ist man in wesentlichen Fragen noch weit auseinander.
Eine über zwei Stunden dauernde Videokonferenz versammelte heute Vormittag die Agrar- und Umweltminister der Länder, die beiden EU-Kommissare Janusz Wojciechowski (Agrar) und Virginijus Sinkevičius (Umwelt) sowie die Bundesministerinnen Julia Klöckner (Landwirtschaft) und Svenja Schulze (Umwelt). Einigkeit habe darin bestanden, dass die Landwirtschaft einen höheren Beitrag zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt und des Klimas leisten und dies ausreichend finanziert werden müsse, hieß es auf Anfrage der Bauernzeitung im Thüringer Agrarministerium.
Wie realistisch sind die Ziele?
Diskutiert wurde, wie die ambitionierten Ziele der EU-Kommission beim Klima- und Umweltschutz, dem sogenannten Green Deal, mit der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) in der Förderperiode bis 2027 verknüpft werden können. Aus Sicht des Thüringer Agrarministeriums wiesen die beiden in der vorigen Woche vorgestellten Strategien der EU-Kommission (Farm-to-Fork; Biodiversitätsstrategie) zwar grundsätzlich in die richtige Richtung. Wie realistisch es aber sein wird, die konkreten Ziele etwa beim Pflanzenschutz, der Düngung oder im Ökolandbau zu erreichen, stehe und falle mit der Ausgestaltung der GAP und der Finanzierung, so das Agrarministerium in Erfurt.
Landwirtschaft und Umwelt zusammendenken
Noch weit auseinander lägen – das habe die Sonderkonferenz und vor allem die in ihrem Vorfeld öffentlich gemachten Papiere gezeigt – die Positionen bei der Frage, wie die Landwirtschaft ökologisch nachhaltiger wird und dabei ökonomisch und sozial leistungsfähig bleibt. Die Grünen-Agrar- und Umweltminister der Länder etwa hatten Ende voriger Woche ihre Positionen mit einem Brief an die beiden EU-Kommissare öffentlich gemacht.
Thüringens Agrarstaatssekretär Torsten Weil (Linke) kommentierte dies mit dem Hinweis, dass das „Zusammendenken von Landwirtschaft und Umwelt tatsächlich noch geübt werden muss“. Denn es könne dabei nicht darum gehen, „die GAP ausschließlich in eine Umweltpolitik umzugestalten“, so Weil gegenüber der Bauernzeitung (hier nachzuhören).
Den Brief der Grünen Agrar- und Umweltminister der Länder können Sie hier herunterladen.
Keine Kürzung bei Zweiter Säule
Der gestrige Vorschlag der EU-Kommission zum Budget für die Jahre 2021 bis 2027 (Mittelfristiger Finanzrahmen) ist aus Sicht des Erfurter Agrarministeriums „zunächst ein Fortschritt“. Denn im Vergleich zu den bisherigen Ideen sollen – trotz der großen finanziellen Anstrengungen zur Überwindung der Corona-Krise – wieder mehr Mittel für die GAP zur Verfügung stehen. Erfreulich sei, dass die Kürzungen bei der Zweiten Säule nicht mehr greifen sollen. Die Rede ist von 15 Mrd. € für sieben Jahre. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie sich der Europäische Rat und das Europäische Parlament zu dem Kommissionsvorschlag positionierten. Obwohl die EU den finanziellen Rahmen setze, komme es letztlich darauf an, wie in Deutschland die einzelnen Elemente der GAP zur Entwicklung der Landwirtschaft ausgestaltet würden.
LsV: Das waren die Proteste in OstdeutschlandDie Äußerungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze zum „Bericht zur Lage der Natur“ bringen für viele Landwirte das Fass zum Überlaufen. „Land schafft Verbindung Deutschland“ hält erneut bundesweite Kundgebungen ab – und fordert Schulzes Rücktritt.
Von Gerd Rinas und David Benzin
Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat am 19. Mai während der Veröffentlichung des „Berichts zur Lage der Natur“ der Landwirtschaft die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt gegeben. Es würden zu viel Dünger und Pestizide auf den Wiesen und Weiden eingesetzt. Außerdem soll sich laut Schulze die intensive Mahd von Wiesen ebenfalls negativ auf die Natur auswirken. Wie „Land schafft Verbindung Deutschland“ (LsV) mitgeteilt hat, sei ein Dialog mit dem Bundesumweltministerium bislang nicht möglich gewesen. Die Kontaktaufnahmen seien bislang ignoriert worden. Deshalb hat LsV zu Protesten für den heutigen Donnerstag aufgerufen. Wir geben einen Überblick auf die Demos in Ostdeutschland.
SPD in Thüringen kritisiert Schulze
In Erfurt übergaben ein Dutzend Landwirte vom Thüringer LsV-Team das Protestschreiben an SPD-Innenminister Georg Maier. Das geschäftsführende Mitglied des SPD-Landesvorstandes sagte, dass das Gremium die Äußerungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze nicht unterstütze. Dies wolle die Landes-SPD auch in der Bundespartei klarstellen.
Eine pauschale Schuldzuweisung an die Landwirte wies Maier zurück, weil es diesen Zusammenhang nicht gebe. Dies bezog der SPD-Politiker auch auf den Klimawandel, wo man nicht zuerst über die Landwirtschaft als Verursacher reden dürfte. Er ermutigte die Landwirte, ihren Protest fortzuführen und auf ihre berechtigten Anliegen aufmerksam zu machen.
Maier bot an, im Rahmen seiner Sommertour einen ganzen Tag lang in einem Landwirtschaftsbetrieb mitarbeiten zu wollen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Alltag und die Leistungen der Landwirte zu lenken.



Vor MAGDEBURGER SPD-Zentrale: LsV-Landwirte fordern Rücktritt Schulzes
Nach Angaben von LsV Sachsen-Anhalt haben sich für die spontane Aktion gestern über 100 Landwirte eingetragen, die mit Schleppern nach Magdeburg kommen.
„Der Frust sitzt tief“, sagte Orga-Teamchef Frank Bröcker von LsV Sachsen-Anhalt. Die Demo war kurzfristig angemeldet worden, um Sanktionen von Polizei und Behörden zu vermeiden.
LSV-Brandenburg übergibt Rücktrittsforderung an BMU
Unter der Organisation von LsV Brandenburg haben sich am Vormittag mehr als 20 Traktoren in der Berliner Innenstadt und in Potsdam zusammengefunden. Organisiert wurde die Kundgebung von Christoph Plass, einem Brandenburger Landwirt und dem Sprecher von LsV Brandenburg.
Zusammen mit den anderen angereisten Landwirten kritisierte er die Arbeit von Bundesumweltministerium und Svenja Schulze. Auch weitere Landwirte haben ihre Meinung auf dem LsV Protest kundgetan.
Aus der Politik war FDP-Agrarsprecher Gero Hocker auf der Seite der demonstrierenden Landwirte zugegen. Die Rücktrittsaufforderung für Umweltministerin Schulze wurde von einem Vertreter des Ministeriums kommentarlos in Empfang genommen.




Die Rücktrittsaufforderung für die SPD-Politiker Svenja Schulze und Jochen Flasbarth. 
LsV-Brandenburg-Sprecher Christoph Plass bei der Kundgebung vor dem Bundesumweltministerium. 

Ein Vertreter des Bundesumweltministeriums nimmt die Rücktrittsaufforderung entgegen.
LSV MV: Positionspapier an Landtagsabgeordnete übergeben

Vor dem Schweriner Schloß, Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, hat heute eine Abordnung von Landwirten, Mitglieder von Land schafft Verbindung (LsV) MV und Landesbauernverband, der Vorsitzenden des Landtags-Agrarausschusses, Elisabeth Aßmann, ein Positionspapier zum „Bericht zur Lage der Natur“ von Umweltministerin Svenja Schulze übergeben.
LsV-MV-Sprecher Toni Reincke wies einseitige Schuldzuweisungen der Umweltministerin an die Landwirte zurück. Nur mit einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung können wir mehr Natur- und Artenschutz erreichen und gleichzeitig die regionale Lebensmittelproduktion sichern. Landwirte leisten mittlerweile viele zusätzliche Maßnahmen für Umwelt und Natur, verdienen damit aber kein Geld. Da muss was kommen“, betonte Reincke.

LsV fordert Svenja Schulzes Rücktritt
Gegen den Bericht zur Lage der Natur bereitet “Land schafft Verbindung” (LsV) für den 28. Mai neue Proteste vor. Ein Ziel soll das Bundesumweltministerium sein. Außerdem fordert LsV den Rücktritt von Umweltministerin Svenja Schulze. mehr
Die Einkommenssituation in den Betrieben sei angespannt. „Im Binnenland droht ein weiteres Dürrejahr. Auf einer Reihe von Betrieben arbeiten die Leute zum Mindestlohn“, machte der Sprecher aufmerksam. Er wäre froh, den LsV-Mitstreitern sagen zu können, dass die Gespräche mit Politikern fruchteten. „Bisher satteln die aber immer nur drauf“, so Reincke mit Blick auf den „Bericht zur Lage der Natur“.
Im folgenden Meinungsaustausch mit Landtagsabgeordneten ging es vor allem um den vorliegenden Entwurf des Musterpachtvertrages für Landesflächen. Die Landwirte bemängelten, dass nach den neuen Kriterien ein Teil der Landesflächen für Agrarumweltmaßnahmen aus der Produktion genommen werden soll – ohne Pachtzinsanpassung. „Wenn wir auf der Fläche keinen Ertrag erzielen können, macht die Bewirtschaftung keinen Sinn“, argumentierten die Praktiker in der Runde.
Die Ausschussvorsitzende Aßmann deutete an, dass man an einem Kompromiss für die Pachtzinsanpassung in den neuen Landpachtverträgen arbeite. Sie schlug außerdem vor, Umweltministerin Schulze im Herbst zum Gespräch mit Landwirten nach Mecklenburg-Vorpommern einzuladen. Die Begeisterung dafür hielt sich bei den Landwirten allerdings in Grenzen. „Sofern Frau Schulze dann überhaupt noch im Amt ist, wovon ich momentan nicht ausgehe. Sie ist nicht mehr tragbar“, brachte Toni Reincke die Meinung vieler Berufskollegen auf den Punkt.
Landmaschinen im 265-Punkte-CheckBei der Ernte muss alles glatt laufen. Das Unternehmen TWL in Südbrandenburg prüft daher Mähdrescher und Häcksler nach einem ausgeklügelten Plan. Die Bauernzeitung war mit der Kamera dabei.
Von Jörg Möbius (Text) und Sabine Rübensaat (Foto und Video)
Direkt am Betriebsgelände der Technischen Werkstätten Langengrassau (TWL) führt die Bahnlinie Berlin-Dresden vorbei. Langengrassau liegt etwa in der Mitte zwischen diesen beiden Städten als Ortsteil der Gemeinde Heideblick im Landkreis Dahme-Spreewald. Schon beim Abbiegen von der Straße zeigen Maschinen am Zaun des weitläufigen Geländes, dass hier vor allem Landtechnik von Claas verkauft und betreut wird.
„Wir sind B-Händler des Technik-Centers Grimma“, erklärt Geschäftsführer Roberto Kühne. „Auch bei vielen anderen Landmaschinenfabrikaten wie Amazone, Väderstad, Agrifac, BSA, Bergmann, Kverneland, Rauch und Kerner ist unser Gebiet mit Grimma abgestimmt. Bei Hofladern allerdings gehen wir einen anderen Weg und sind A-Händler für Weidemann mit einem eigenen Gebiet.“
Das Unternehmen entstand 1990 aus dem Technikbereich des Volkseigenen Gutes Langengrassau. Sieben Gesellschafter der neuen GmbH, die alle vorher im Gut beschäftigt waren, erwarben das Areal von der Treuhand. Die dahinter liegende landwirtschaftliche Betriebsstätte und Ställe wurden ebenfalls von ortsansässigen Landwirten erworben.
Foto-Rundgang durch die Werkhallen der TWL

Kennt sich aus mit schwerem Gerät: Meister Patrick Schmidt. 
Akribisch wird bei der Überprüfung eine lange Liste mit 265 Punkten abgearbeitet. 
Hier kontrolliert Patrick Schmidt einen Halmtrenner am Schneidwerk. 
Schmidt überprüft die Temperatur: Mehr als 40 – 60 °C dürfen nicht überschritten werden 
Gut gelaunt geht es am besten – auch die eines Teleskoplader- Getriebes.

Preisgekrönt: Toni Eckardt gewann 2017 den Titel als Deutschlands bester Land- und Baumaschinenmechatroniker. 
Schmidt kontrolliert die Zentralschmierung des Häckslers. 
Schmidt auf einem Lexion 440, dessen Verteilergetriebe zur Überholung ausgebaut wurde. 
Hinten ohne: Diesem Traktor werden zur Reparatur die Hinterreifen abgezogen. 
Patrick Schmidt und Bernd Thiele von der Agrar GmbH Langengrassau beim Fachsimpeln. 
Ein letzter Blick in die Werkstatt der TWL.
Von Anfang an war es ihr Bestreben, das landtechnische Unternehmen mit weiteren Geschäftszweigen zu diversifizieren. Das hält Arbeitsplätze und in gewissem Umfang können Arbeitskräfte ausgetauscht werden. Neben der Innenwirtschaft (BouMatic) ist in erster Linie der Stahlbau mit Hallen-, Dach- und Fassaden- sowie Apparatebau zu nennen. Der gut ausgestattete Agrarshop mit Kärcher, Husquarna und Würth als wichtige Marken rundet das Angebot ab.
„Bilanziell erzeugen wir mehr Strom als wir verbrauchen“
Dazu kommt die Tochterfirma Tief- und Leitungsbau GmbH, deren Haupttätigkeit aus dem Namen hervorgeht. Das TWL-Einzugsgebiet erstreckt sich über sechs der großen Landkreise des Landes Brandenburg im Süden von Berlin.
Eine Niederlassung in Peitz bei Cottbus dient dortigen Kunden als Anlaufstelle, ein Meister ist für die Region zuständig. 42 Mitarbeiter sind momentan beschäftigt.
Fast jeder der elf Mechaniker hat ein eigenes Servicefahrzeug mit entsprechender Ausrüstung, die Meister natürlich auch. Da ist Kapital gebunden.
Es gibt bei TWL keine repräsentative Glasfassade, aber ordentlich modernisierte Gebäude mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach und Heizenergie von der Biogasanlage des Landwirtschaftsbetriebes nebenan. „Bilanziell erzeugen wir mehr Strom als wir verbrauchen“, ist der Geschäftsführer berechtigt stolz. „Nachhaltigkeit, ein ordentliches Betriebsergebnis und lokales Engagement sind so unsere Leitbilder, die wir als Geschäftsführung verfolgen.“

Ernte 2020: Die Mähdrescher sind fit
Die Vorbereitungen der Technik für die Ernte 2020 laufen auf Hochtouren. Die sorgfältige Vorbereitung der Mähdrescher ist wichtig, damit sie zur Ernte gut laufen. Dabei ist einiges zu beachten. Ein Kommentar von Jörg Möbius. mehr
Roberto Kühne ist Diplomwirtschaftsingenieur und Master of Business Administration (MBA) und hat vor zehn Jahren als Geschäftsführer die Nachfolge seines Vaters angetreten, der 1990 zu den Gründern des Unternehmens gehörte. Zum lokalen Engagement gehört auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde beim Brandschutz. In einer Garage der TWL steht ein Einsatzfahrzeug der Gemeinde. Tagsüber in der Woche sind viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes zur Arbeit weg. Aber die Mitarbeiter der TWL sind da und von ihnen ist jeder zweite bei der Feuerwehr, so kann dann das Fahrzeug mit ihnen besetzt werden. …
Biogas nach EEG: Jetzt Entscheidungen treffenIn Thüringen können landwirtschaftliche Biogaserzeuger eine geförderte Beratung in Anspruch nehmen, um sich für den Weiterbetrieb ohne EEG-Vergütung fit zu machen. So will man verhindern, dass sinnvolle Anlagen stillgelegt werden.
Landwirtschaftsunternehmen stehen vor der Frage, ob und wie ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb ihrer Biogasanlagen in Zukunft möglich sein kann. Ohne Perspektive wird das Abschalten der Anlagen eine Option sein, die nicht im Sinne des Erfinders sein kann: der Politik.
Für die ersten 50 der 260 vor dem Jahr 2014 in Thüringen errichteten landwirtschaftlichen Biogasanlagen endet in den nächsten fünf Jahren die 20-jährige EEG-Vergütung. Laut dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) stammt der Gärprodukteanfall im Freistaat zu mehr als 70 % aus Wirtschaftsdünger und zu weniger als 30 % aus Feldfrüchten.
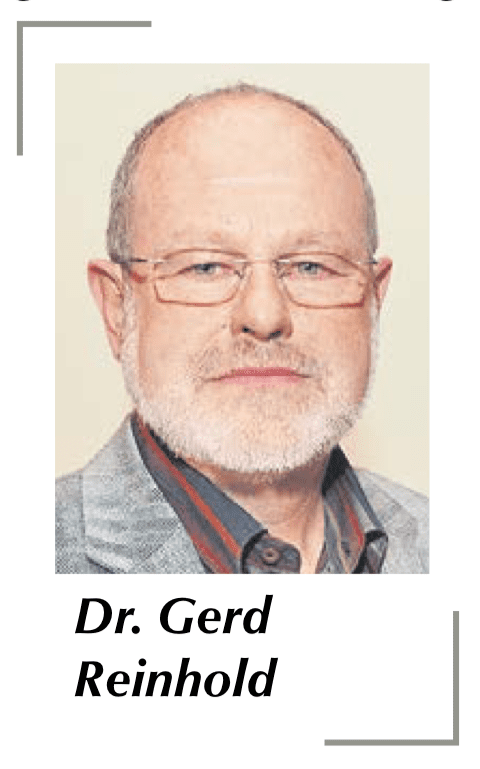
Rund 66 % der in Thüringen eingesetzten Wirtschaftsdünger sind Gärprodukte. „Mit der Orientierung der Errichtung der landwirtschaftlichen Biogasanlagen am Standort der Tierhaltung wurde ein zukunftsweisender Weg begangen“, urteilt TLLLR-Biogasexperte Dr. Gerd Reinhold. Aber: „Durch das EEG 2014 wurde diese positive Entwicklung abrupt abgebrochen und dem Anlagenneubau die ökonomischen Grundlagen entzogen.“ In den letzten sechs Jahren fand – abgesehen von wenigen Kleinanlagen – kein Zu- bzw. Neubau mehr statt.
Fehler nach EEG-Ende vermeiden
In Thüringen hat sich die Landesregierung auf Initiative des Agrarministeriums auf den Weg gemacht, den Anlagenbetreibern eine „Beratung und aktive Unterstützung bei der Eruierung der Möglichkeiten für den Weiterbetrieb“ zu eröffnen. Diese Biogasberatung organisiert die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA), die dem Umwelt- und Energieministerium untersteht, das Landes- und Eler-Mittel bereitstellt. Mit an Bord sind das TLLLR und das „Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie“ in Weimar mit Prof. Frank Scholwin.
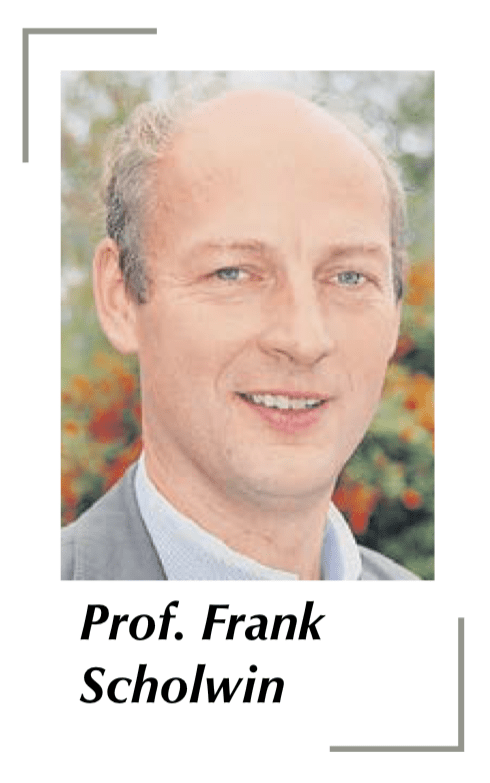
„Wenn wir die sinnvollen Biogasanlagen erhalten wollen, müssen wir die Betriebe dabei unterstützen, einen Zukunftsweg zu finden und gleichzeitig Fehlentwicklungen zu verringern oder zu vermeiden“, sagt Scholwin. Verfolgt werden müsse ein systematischer Ansatz, der die Energieerzeugung, die Kreislaufwirtschaft und die Emissionen im Blick hat. Und das unter wirtschaftlichen Bedingungen.
Biogas nach EEG: erhalten und Betrieben helfen
Als Fehlentwicklung beschreibt Scholwin Anlagen, die keine lokale Einbindung haben, das heißt „die keinen landwirtschaftlichen Bezug haben, keine lokale Integration in Energie- und Stoffkreisläufe und ausschließlich mit pflanzlichen Substraten betrieben werden“. Eine Fehlentwicklung wäre es freilich auch, wenn Biogasanlagen gerade dort stillgelegt würden, wo sie Sinn machen.
Für die kostenfreie Beratung fährt Scholwin zu den Betrieben, erörtert mit den Landwirten eventuell vorhandene Pläne oder Ideen, prüft die Kenndaten und nimmt das Umfeld ins Visier. „Jeder mögliche Weg ist individuell, es gibt keine pauschalen Lösungen“, weiß Scholwin, der die ersten fünf Beratungen abgeschlossen hat. Vier grobe Wege zählt der Biogasfachmann als Optionen auf, die einer Prüfung unterzogen werden.

Keine Zeit für Partys, aber für Visionen
In diesem Jahr wird das Gesetz zu den erneuerbaren Energien – oder kurz EEG – 20 Jahre alt. Was war gut, was eher weniger? Zeit für eine Bilanz. Ein Kommentar von Christoph Feyer. mehr
Das wäre zunächst die Folgevergütung nach dem EEG 2017, was zwar einen zehnjährigen Weiterbetrieb erlaubt, allerdings mit aktuell bis zu 5 ct/kWh geringerer Vergütung. „Dies kann der einfachste Weg sein, wenn ich etwa, einschließlich der für die Ausschreibung geforderten Flexibilisierung, keine großen Änderungen mehr an der Anlage vornehmen muss.“
Biogas nach EEG: Ergänzende Optionen im Blick behalten
Allerdings haben rund 60 % der Thüringer Anlagen nicht die seit dem EEG 2012 geforderte Mindestverweilzeit von 150 Tagen, was diese Option deutlich einschränkt. In den Blick nehmen sollte man dabei stets die Kombination mit ergänzenden Optionen, die von der Nahwärmeversorgung, dem Trocknen, Kühlen mit Abwärme bis hin zur Verwertung von Rohbiogas über Leitungen an einem weiteren BHKW-Standort reichen.
Auch wenn das Halbieren der Leistung und ein ausschließlicher Gülleeinsatz schmerzliche Optionen sind, so werden doch nicht wenige Betriebe diesen Weg gehen müssen, wenn nicht die Rahmenbedingungen geändert werden.
Praxisbeispiel aus Frauenprießnitz
So macht man das bei der Agrarproduktion Frauenprießnitz GmbH GmbH & Co KG, die die Biogasberatung als einer der ersten Betriebe genutzt hat. Christian Einax, der derzeit als künftiger Geschäftsführer eingearbeitet wird, bilanziert das Angebot als Gewinn, gleichwohl man nicht ratlos gewesen sei. 2022 läuft für die Anlage mit einer aktuellen Leistung von 526 kW die komfortable EEG-Vergütung aus; das BHKW erhielt 2018 einen neuen Motor; derzeit wird neue Software für das Prozessleitsystem installiert. „Durch die wirklich gute Beratung haben wir Bestätigung für das erhalten, was wir vorhaben“. …
Erntehelfer: Einreise jetzt länger möglichDie Einreiseregelung für Erntehelfer wird bis zum 15. Juni verlängert. Darauf haben sich Julia Klöckner und Horst Seehofer geeinigt. Auch wie es danach weitergeht, war im Gespräch.
Die Bundesregierung hält an der geltenden bestehenden Einreiseregelung für Saisonarbeitskräfte fest. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben sich am Wochenende auf eine Fortführung der geltenden Erntehelferregelung zum 15. Juni geeinigt.
Nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission sollen danach die Corona-bedingten Binnengrenzkontrollen aufgehoben werden, sofern das Infektionsgeschehen das zulässt. Die Bundesregierung will dann die Reisebestimmungen grundsätzlich neu bewerten. Eine weitere Anschlusslösung für die Zeit nach Mitte Juni soll sich an diesem Grenzregime orientieren.
Einreise für Erntehelfer länger möglich, Kontingent bleibt bestehen
Ein zusätzliches Einreisekontingent soll es zunächst nicht geben, da die für April und Mai gewährte Zahl von insgesamt 80.000 Erntehelfern mit bislang rund 33.000 nicht annähernd ausgeschöpft wurde. Bestehen bleiben sollen auch die Infektionsschutzauflagen bei der Einreise und der Beschäftigung von Saisonkräften. Dazu zählen ein Gesundheitscheck am Flughafen nach der Landung, die Übermittlung der Ergebnisse an das zuständige Gesundheitsamt, eine 14-tägige faktische Quarantäne nach Ankunft, strikte Abstands- und Hygienevorschriften in den Betrieben, eine geringere Belegung der Unterkünfte sowie das Arbeiten in möglichst kleinen, gleichbleibenden Gruppen.
Einreise von erntehelfern: Landwirte brauchen Planungssicherheit
„Unsere Landwirte brauchen auch nach Mai bis zum 15. Juni Planungssicherheit, ob sie zusätzliche Saisonarbeitskräfte beschäftigen können“, erklärte Klöckner. Danach werde eine neue Lagebeurteilung vorliegen. Man werde die Landwirte bis dahin nicht in der Luft hängen lassen, versicherte die Ministerin.
Kabinettskollege Seehofer bescheinigte der Landwirtschaft einen verantwortungsvollen Umgang mit der Einreiseregelung. „Verstöße hat es in der Landwirtschaft nicht mehr gegeben als in der Fußballbundesliga auch“, so der CSU-Politiker. Schwarze Schafe dürften nicht alle anderen, die sich ordentlich verhalten, in Mithaftung nehmen. red (mit AgE)
Agrar Teichel: Improvisation ist gefragtDie Agrar Teichel, unseren Praxispartner in Thüringen, fordert die Witterung besonders heraus. Der Weideauftrieb findet sonst um Ostern statt, in diesem Jahr erst Mitte Mai.
Vom Plan, die Mutterkuhherden nach Ostern auf die Weiden zu treiben, ließ die Agrargenossenschaft Teichel am Ende doch die Finger. „Die Aufwüchse ließen es einfach nicht zu. Wir wollten ihnen noch vier Wochen geben, damit die Herden auch Futter finden“, beschreibt Dr. Stefan Blöttner die Futtersituation. In Ermangelung von Niederschlägen begann der Auftrieb somit erst Mitte voriger Woche. Im Laufe dieser Woche sollten dann alle 220 Charolais-Rinder aus ihren Ställen sein.
Agrar TeicheL: Erster Schnitt enttäuschte

Nachdem der Schnitt der ersten 13 ha Futterkorn mit gerade mal 110 dt/ha eine Enttäuschung war, konnte auf den übrigen 47 ha aufgeatmet werden. „Die gut 200 Dezitonnen je Hektar liegen im Durchschnitt der Jahre, was uns wirtschaften hilft“, so Vorstand Stefan Blöttner. Kaum war zu Beginn der Vorwoche der erste Mais aufgelaufen, bekam er während der Eisheiligen „gleich einen weg“. Bis zu -4 °C zeigte das Thermometer an. Zum Glück traf es nur die Blattspitzen. „Der Mais wird sich erholen, wenn wir Niederschläge bekommen.“

Wie schon in den Vorjahren sollten auch die letzten 40 ha nicht in Einzelkornsaat gelegt werden. „Wir haben in den zurückliegenden Trockenjahren darauf gesetzt, dass heterogene Bestände zügig für Beschattung sorgen, womit wir der Verdunstung entgegenwirken.“ Dies sei zwar nicht die „reine“ pflanzenbauliche Lehre, weil der Ertrag abfalle. Das Improvisieren gehöre in extremen Situationen aber zum Tagesgeschäft.
Umbruch von 30 ha Raps in der AGRAR TEICHEL nötig
Anders als gehofft musste man sich nun doch von knapp 30 ha Raps verabschieden. Auf drei Schlägen kam der Mulcher zum Einsatz. Wassermangel und hohe Tagestemperaturen bei gleichzeitig strengem Nachtfrost führten Mitte März zu Rissen an den Stängeln. Parallel trat „örtlich in kürzester Zeit extremer Befall mit dem Gefleckten Kohltriebrüßler auf. Bis zu 40 Larven fanden sich in einem Stängel, was wir so noch nicht erlebt haben“.
Auf eine Bekämpfungsmaßnahme verzichtete man in diesem Moment: „Die Kosten und der in Aussicht stehende geringe Erfolg der Maßnahme mussten abgewogen werden.“ Auf den Flächen werden jetzt Hafer-Sommergerste-Gemenge zur Ganzpflanzenernte und eventuell noch Mais gedrillt. Die Futtersituation erleichterte die Entscheidung zum Umbruch.

Der Befall mit den Larven des Kohltriebrüsslers war extrem. 
Einige Rapsschläge wurden umgebrochen.
Blöttner und seine Mannschaft treiben aber nicht nur Sorgen um. Vorgestellt hatte sich am letzten Donnerstagnachmittag mit Marie George eine künftige Landwirt-Auszubildende. Die gelernte Speditionskauffrau stammt aus Nordhessen, wo ihr Vater einen Hof bewirtschaftet und eine kleine Charolais-Zucht betreibt. Man kennt sich über den Bundesverband der Charolais-Züchter. Die Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag sollte nur noch eine Formsache sein.

Wintererbsen werden für die erstmalige Aussaat (mit Wintertriticale) im Herbst nachgebaut. 
Trotz Trockenheit stehen die Sommererbsen gut da.
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft in Thüringen. mehr
Die Ostseeinsel Usedom war seit Mitte März für Urlauber tabu. Jetzt öffnet sie sich langsam wieder für ihre Besucher. Und während es viele an die kilometerlangen Sandstrände zieht, gibt es fernab der quirligen Bäderorte auch stille Oasen wie den Kräutergarten in Prätenow.
Von Bärbel Arlt
(Text und Fotos)
Es sind in erster Linie die Bäderorte und die Strände mit ihrem feinen, weißen Sand, die auf Usedom die Urlauber magisch anziehen. Doch wer sich ins Hinterland aufmacht, schnell von der wunderbaren, oft stillen Natur begeistert sein wird und so manches verträumte Fleckchen finden. So weist unweit vom Schloss Stolpe ein kleines, fast unscheinbares
Schild den Weg zum Kräutergarten mit Hofladen von Ina Schirmer.

Ruhig ist es hier am Waldrand, nur ein stolzer Hahn kräht hin und wieder. Wachsam und freundlich schaut Hündin Luna um die Ecke und auch Ina Schirmer lässt ihre Besucher erstmal in Ruhe durch ihr kleines Refugium aus Heil- und Duft- und Küchenkräutern spazieren. Rund 100 sind es, die hier übers Jahr wachsen.
Kräuterleidenschaft steckt in den Genen
„Mit meiner Leipziger Oma habe ich als Kind säckeweise Kamillen- und Lindenblüten gesammelt und sie in der Sammelstelle abgegeben. Auch gegen jedes Wehwehchen hatte Großmutter immer ein Kraut zu Hause“, erinnert sich Ina Schirmer und lacht: „Wahrscheinlich sind die Kräuter in unseren Genen drin.“ Denn auch Ina Schirmer liebt sie über alles. Vor allem Wildkräuter. Dafür hat sie vor zehn Jahren ihren Job als gelernte Diätassistentin, den sie 17 Jahre in einer Mutter-Kind-Klinik ausübte, an den Nagel gehängt und dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Denn die Leidenschaft für Kräuter und die Liebe zur Insel, auf der sie als Kind oft ihre andere Oma besuchte, hat sie nie verlassen.
Als die Jugendjahre vorbei waren, habe sie dann wieder angefangen, Kräuter zu sammeln und zu verwerten. „Und wenn man sich da- mit beschäftigt, kommt man nicht mehr los“, schwärmt die gebürtige Leipzigerin und blickt tief in die Geschichte. „Ob Klosterheilkunde, die Kräuterkunde der Hildegard von Bingen oder Paracelsus, der Vater der Naturheilkunde – Kräuter werden seit Menschengedenken verwendet. Das ist es, was mich so fasziniert“, sagt sie und mag es überhaupt nicht, wenn bei Wildkräutern von Unkraut die Rede ist. „Das Wort Unkraut sollten wir aus unserem Sprachschatz verbannen“, meint sie und schreibt in ihrem Rezeptebuch „Grüne Schätze aus der Natur“: „Das, was wir mit Füßen treten oder regelmäßig mähen, kann für uns Menschen hilfreich sein.“

Denn wilde Pflanzen haben gegenüber kultivierten nicht nur viel mehr Vitamine und Mineralstoffe. „Mit jedem Kraut nimmt man auch natürliche Antibiotika zu sich. Das heißt, es stärkt das Immunsystem, was auch ohne oder nach Corona wichtig ist“, so die Kräuterexpertin und zählt auf: Antiviral wirkende Pflanzen sind zum Beispiel Salbei, Melisse, Wasserdost und Knoblauch. Weitere antiseptisch wirkende Pflanzen sind unter anderem Thymian, Lavendel, Knoblauchrauke, Rosmarin, Pfefferminze und Zwiebel. Aber auch andere Kräuter, die vorwiegend Bitterstoffe für eine bessere Verdauung enthalten wie Schafgarbe, Löwenzahn und Wermut oder Kräuter mit vorwiegend Saponinen wie Spitzwegerich, Seifenkraut und Eibisch und eine schleimlösende Wirkung haben, beeinflussen unser Immunsystem positiv.
„Also ein guter Grund, Kräuter zu verwenden, zumal sie alle direkt vor der Haustür wachsen und nicht aus fernen Ländern kommen“, so Ina Schirmer und erklärt bei einem Spaziergang durch den Garten, dass zum Beispiel Kapuzinerkresse bei Blasenentzündungen hilft, Erdrauch gegen Schuppenflechte, die Wilde Karde gegen Borreliose, Giersch gegen Gicht, Beinwell gegen Hexenschuss. Johanniskraut stärkt die Nerven, Gundelrebe das Bindegewebe der Venen. Jetzt im Frühjahr helfen Brennnessel, Giersch und Löwenzahn, den Körper zu entgiften. „Nicht umsonst heißt es, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“, so Ina Schirmer.
Doch auch kulinarisch machen die wilden Kräuter eine gute Figur und lassen sich wunderbar in den täglichen Speiseplan einbauen, zumal sie würziger und aromatischer sind. Vogelmiere schmeckt ein bisschen nach Mais, Hopfenspitzen nach Spargel. Der sehr bittere Wermut eignet sich – unbedingt dosiert in kleinen Mengen – für Kräuterschnäpse. Eine alte, vergessene Gemüsepflanze, die oft in Bauerngärten zu finden ist, ist die Nachtkerze. Schon Goethe soll sie sehr geschätzt haben. Die weiß-rot durchzogenen Wurzeln die aufgrund ihres Aussehens auch Schinkenwurzel genannt werden, können ebenso gegessen werden wie die gelb leuchtenden Blüten. Ina Schirmer füllt sie gern mit Frischkäse. Und die Samen, aus denen das gegen Neurodermitis helfende Nachtkerzenöl gewonnen wird, passen auch gut ins Müsli, so die Kräuterexpertin, die alle ihre Rezepte selbst zubereitet und geprüft hat.

Dennoch weist sie darauf hin, dass Heilkräuter bei bestimmten Erkrankungen die Heilung unterstützen können, jedoch den Arztbesuch nicht ersetzen. Auch können sie bei sehr empfindlichen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen. Fast täglich durchstreift Ina Schirmer Wald und Wiesen auf der Suche nach frischen Kräutern, die dann in Hotels der Insel auf den Tisch kommen. Doch auch mit interessierten Gästen ist sie gern unterwegs, sammelt mit ihnen Kräuter und zaubert anschließend Wildkräutermenüs. „Ich möchte das ursprüngliche Wissen der Heilpflanzen weitergeben, damit die Leute erfahren, wie Kräuter Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen können.“
Noch mehr mit der Natur verbunden
Allerdings war das in den vergan- genen Wochen nicht möglich, hat doch das Coronavirus Touristen und Urlauber seit März komplett von der beliebten Ostseeinsel verbannt. So kam auch das kleine Unternehmen von Ina Schirmer nahezu komplett zur Ruhe, Einnahmen blieben aus. Doch die 48-Jährige, die abseits der quirligen Bäderorte lebt, hat dieser Ruhe auf der Insel auch etwas Positives abgewinnen können. „Die Strände waren
noch viel traumhafter und ich habe viel Zeit im Garten verbracht, bin mit meiner Hündin durch den Wald und über die Wiesen spaziert – ganz in Ruhe und ohne Druck. Das hat mich mit der Natur noch viel mehr verbunden, mir Kraft und Urvertrauen gegeben.“ Auch viel Bewegung. Musik und Lesen haben sie gestärkt, um gut über diese Zeit zu kommen. Inzwischen dürfen wieder Urlauber auf die Insel und Ina Schirmer lädt wieder zu Kräuterwanderungen und Wildmenüs ein – natürlich unter Einhaltung aller geforderten Maßnahmen. Es ist ein zarter Neubeginn.

Und so fällt es ihr nicht leicht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. „Ich versuche im Augenblick zu leben“, sagt sie und verrät, dass sie oft von Besuchern gefragt werde, „ob man denn von den Kräutern leben könne.“ Dann stellt sie ihnen die Gegenfrage: „Was bedeutet „leben“?“ In den Urlaub fahren? Shoppen? Das ist es für sie nicht. Sie setzt im Leben andere Prioritäten, zu denen vor allem das eigene Zeitmanagement gehört: „Ich liebe es, den Tag so zu gestalten, wie ich ihn mag, möglichst ohne Stress und Druck.“
Und sie wünscht sich, dass sie gesund bleibt und ihren kleinen Kräutergarten mit Hofladen, in dem es getrocknete Küchen- und Heilkräuter, Pestos, Gewürze, Tee, Kräutersalze und Räucherwerke gibt, weiterführen, ihr Kräuterwissen auch weiterhin ihren Gästen vermitteln kann und dass diese dabei vor allem entspannen und zur Ruhe kommen.
Mehr Informationen: www.kraeuterverbena.de
Direktvermarktung: Junge Meister im Doppelpack
Das Fleischerhandwerk in der Römhilder Agrargenossenschaft liegt in jungen Händen. Betriebsleiter Sebastian Michael ist gerade mal 27 Jahre alt. Sein Weg zur Führungskraft ging schneller, als gedacht.
Von Birgitt Schunk
(Text und Fotos)
Eigentlich wollte Sebastian Michael Koch werden. „Essen und Lebensmittel interessierten mich schon immer“, sagt er. Als Kind vom Dorf war er zudem oft genug dabei, wie zu Hause geschlachtet und Wurst gemacht wurde. „Vor allem wollte ich in einem handwerklichen Betrieb lernen, in dem von der Pike auf alles noch selbst gemacht wird – so wie früher.“
Heute ist der junge Mann aus Leimrieth immer noch in seinem Lehrbetrieb, der Landwirtschaftlichen Erzeugung und Vermarktung (LEV) „Zu den Gleichbergen“ Römhild eG, und hat den Meisterbrief in der Tasche. „Ich hatte mir von Anfang an vorgestellt, irgendwann einmal Verantwortung zu übernehmen.“ Mit 26 Jahren erfüllten sich seine Berufswünsche, denn da wurde er Betriebsleiter der Fleischerei. „Das ging schneller als gedacht.“ Er weiß somit, dass es auch berufliche Chancen auf dem Lande gibt. „Ein Städter wollte ich ohnehin nie werden.“ Zeit und kurze Wege, Landleben, Familie und Freunde sind ihm wichtig.
AlS Meister Chef von sieben Leuten
Als Fleischer-Meister geht der Arbeitstag zudem früh los, nach dem Mittag kann er sich schon fast auf den Heimweg machen. So bleibe Zeit für den Nachwuchs und das Haus: „Auch das sind Vorteile in dem Beruf“, so Sebastian Michael.
Heute ist der 27-Jährige Chef von sieben Leuten und einem Lehrling – eine junge Truppe, das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Sein 26-jähriger Kollege Andreas Heun wird ebenso seinen Meisterabschluss ablegen – die letzte Prüfung ist wegen der Coronakrise allerdings verschoben. Michael und er kennen sich schon aus der Kindergartenzeit und lernten beide im Betrieb. Zwischenzeitlich lebte und arbeitete Heun in Südbayern, kam aber wieder zurück. „Ich konnte hier wieder anfangen und wollte aber unbedingt meinen Meister machen.“

Lesen Sie auch:
Hausschlachtung wie früher – mit der Jugend von heute
In seinem alten Betrieb stieß er dabei auf offene Ohren. LEV-Vorstandsvorsitzender Udo Schubert hatte nur eine Bedingung: Beide sollten nicht gleichzeitig die Meister-Schulbank drücken. „Ansonsten muss man jungen Leuten, die wirklich wollen, solche Chancen bieten, um sie zu halten“, sagt er. Der Betrieb finanzierte die Lehrgänge und legte auch beim Gehalt nach erfolgreichem Abschluss etwas drauf. „Sonst funktioniert es nicht – zumal die Bewerberzahlen für eine Lehre im Fleischerhandwerk in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind.“ Dennoch kann die Genossenschaft mit dieser Konstellation nicht klagen. Die jungen Leute selbst und auch die Qualitätsprodukte werben für die Branche.
Der Aufwand ist hoch, denn das Unternehmen schlachtet noch selbst und hat hier einiges investiert. „Solange wir das können, wollen wir den Standard halten“, sagt Schubert. Rund 30 Schweine werden in der Woche geschlachtet. Die Tiere wurden viele Jahre selbst in dem nur einen Kilometer entfernten Stall aufgezogen.

Lesen Sie außerdem zum Thema:
Direktvermarktung in der Agrargenossenschaft Görike-Schönhagen
Kurze Wege bis zur Direktvermarktung
Dort werden die Schweine auch heute noch gemästet, allerdings unter einem neuen Betreiber. „Der hat ein geschlossenes System und kann effektiver arbeiten – wir waren immer vom Läuferpreis abhängig.“ Von diesem Betrieb und weiteren Partnern wird zugekauft. Wichtig sei, dass die kurzen Wege von der Schlachtung bis zur Verarbeitung erhalten blieben. „Das ist auch eine Qualitätsfrage für uns.“ Verarbeitet werden zudem zwei bis drei Bullen pro Woche. Neben der eigenen Landkaufhalle am Firmensitz betreibt die LEV Filialen in Heldburg, Schleusingen und Hildburghausen. Zwanzig Verkäuferinnen finden hier Arbeit. Die Produkte werden geschätzt und nachgefragt. „Trotzdem schauen noch zu viele Leute nach Billigangeboten – hätten wir unsere Läden in großen Städten, könnten wir mehr absetzen.“

Lesen Sie auch:
Lammfleisch im Online-Shop
Das BetriebsKlima stimmt
Die Coronakrise bekommt der Betrieb am sinkenden Umsatz zu spüren. Große Feste fallen aus, private Partys sind ebenso nicht erlaubt. „Es wird längst nicht so viel gegrillt wie sonst um diese Zeit“, weiß Schubert. In den Läden mussten zudem die Corona-Auflagen umgesetzt werden – von Absperrungen bis hin zu Schutzscheiben an der Kasse. „Das volle Programm.“ Online bestellen die Kunden etwa Konserven mit Hausschlachtwurst, Knacker oder Schinken. „Das sind aber keine Riesenumsätze – vielleicht 20, 30 Pakete in der Woche.“
Wichtig aus Schuberts Sicht ist vor allem, dass das Arbeitsklima stimmt. „Das passt in der Fleischerei“, sagt er. Die junge Mannschaft kann freilich eigene Ideen umsetzen. So kam jüngst beispielsweise der „Knusperbauch“ mit verschiedenen Außenwürzungen wie Curry oder Kräuter in die Ladentheke. Neben der klassischen Thüringer Rostbratwurst gibt es auch Varianten mit Barbecue oder Käse.
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft in Thüringen. mehr