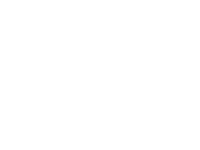Auf dem Impulsforum „Nährstoffkonzepte für den Ökolandbau von morgen“ der DLG-Wintertagung kamen Ökoberater Andreas Jessen und Ökolandwirt Christoph Müller aus der Praxis zu Wort.
Eines der Impulsforen auf der DLG-Wintertagung 2020 widmete sich dem Themenkomplex „Nährstoffkonzeopte für den Ökolandbau von morgen“. Ökolandwirt Christoph Müller, der seit 1989 zusammen mit seiner Frau den Bioland-Hof Müller-Oelbke in Niedersachsen an der Grenze zu Thüringen bewirtschaftet, hat ganz eigene Ansätze, die Nährstoffkreisläufe auf seinem Betrieb weitestgehend zu schließen.
Für ihn sind die Bausteine einer betrieblichen Düngung eine viehlose Landwirtschaft. Der Grund dafür ist einfach: in seinem Fall ist kein geschlossener Nährstoffkreislauf möglich – der Betrieb ist also ein Nettoexporteur. Stattdessen ist für Müller ein Mündungsdenken über die Fruchtfolge mit Kleegras besonders wichtig. Humus ist nicht nur gut für die Bodenfruchtbarkeit, sondern auch ein guter Wasserspeicher.
Düngung über regionale und überregionale Kooperationen
Die Düngung organisiert der Biolandwirt durch vielfältige Bestandteile und immer auf Basis des Nährstoffentzugs bzw. des Nährstoffmangels. In der Region unterhält er daher verschiedene Futter-/Mist-Kooperationen mit anderen Betrieben. Auf überregionaler Ebene kommt zugekaufter Dünger in seinen betrieblichen Nährstoffkreislauf. Vor Ort sind dafür jedoch Lagerkapazitäten notwendig. Zu diesem Zweck hat der Landwirt eine Mistlagerhalle mit einer Haufenkompostierung gebaut.
Die organischen Düngemittel, die er auf regionaler Ebene bezieht, sind:
- Mistkompost von Rind, Pferd,
- festes Gärsubstrat,
- Grüngutkompost,
- Gärrest flüssig (über einen Kooperationspartner, der dafür Kleegras und Futterreste zurückbekommt) und fest (teils Bioland, Nawaro).
Von ihm eingesetzte organische Düngemittel auf überregionaler Ebene sind:
- Biohühnertrockenkot (von der Wirkung vergleichbar mit Kalkammonsalpeter),
- Handelsdünger wie Haarmehlpellets.
Der Einsatz von Grüngutkompost dient vor allem der Humuslieferung. Zu den Kartoffeln werden auf dem Müller-Oelbke-Hof alle fünf Jahre 20 t/ha Grüngutkompost ausgebracht. Mit Rhizoctonia hat er in den Kartoffeln keine Probleme, denn Grüngutkompost wird von ihm auch als „Gesundungsfrucht“ gesehen.
Eingesetzte mineralische Düngemittel auf dem Bioland-Hof Müller-Oelbke sind:
- Carbokalk,
- Kalkmergel,
- Gips,
- Schwefel (linsenförmig und flüssig),
- Kalium (Polysulfat und Kalimagnesia) und
- Mikronährstoffe wie Bor, Zink, Molybdän u. a.
Müller zum Nährstoffkreislauf: „Das ganze System muss stimmen“

Für Christoph Müller sind stabile und gute Erträge der Erfolgsmaßstab einer kreislaufbetonten Düngung. „Das ganze System muss stimmen“ sagt er. Und man muss die Gesamtkosten einer Kultur im Blick behalten. „Stickstoff ist für uns kein Thema“, sagt er, denn sie dürfen nach den Vorgaben ihres Anbauverbands Bioland im Jahr 22.000 kg N zukaufen.
Phosphor sei für den Betrieb schon eher problematisch, da der Bedarf der Pflanzen meist geringer ist, als über die eingesetzten Dünger an Phosphor auf den Acker komme, betont der Landwirt. Für die Kaliumdüngung und die Regulierung des pH-Wertes (nach Gehaltskassen von A bis D) verwendet er Applikationskarten. So kann er dem Bedarf entsprechend Dünger ausbringen, um die Gehaltsklasse des Nährstoffs bzw. des Säuregehaltes der Fläche zu homogenisieren.
Probleme sieht Müller vor allem in der Düngeverordnung. Hier macht ihm besonders der Phosphor sorgen, da es bei diesem Nährstoff einen Überschuss aufgrund der von ihm eingesetzten Mehrnährstoffdünger gibt. Doch auch mit den Richtlinien der Bioanbauverbände sieht Christoph Müller Probleme auf die Branche zukommen. Die geregelte Nährstoffzukaufsmenge und deren Art führt er hier beispielhaft an. Der Klimawandel habe besonders einen Wassermangel zufolge. Daher müssen landwirtschaftliche Betriebe unbedingt wassersparender arbeiten. Eine Kleegrasfruchtfolge kann dabei eine hilfreiche Maßnahme sein. Mit dem Zitat „Irgendwie gehts immer weiter“ beendete Müller seinen Vortrag.
Berater Jessen: Leguminosen auf 20 Prozent der Fläche
Andreas Jessen ist Berater bei der Naturland-Fachberatung aus Schleswig-Holstein. Bereits seit 17 Jahren berät er Naturland-Betriebe. Für ihn gibt es in Bezug auf die Fruchtfolge einen wichtigen Grundsatz: Auf mindestens 20 % der Fläche sollten Leguminosen (also Kleegras oder Körnerleguminosen) angebaut werden. Außerdem sollten sich seiner Meinung nach Betriebe auch nach externen organischen Düngern umschauen (sein Leitsatz: „Düngen hilft“), doch die haben auch immer einen Nachteil, z. B. Phosphor-Inbalance oder Mikroplastikbesatz.

Herausforderungen bei der Düngung sieht Jessen in versiegenden Nährstoffquellen durch eine erhöhte Nachfrage (beispielsweise nach Biohühnertrockenkot), ein geringes Angebot „geeigneter Dünger“ und einen erhöhten Beschaffungsaufwand. Auch Düngerqualitäten sind Herausforderungen: Phosphat-Minen sind mehr und mehr erschöpft oder mit Schadstoffen belastet, „Störstoffe“ wie Mikroplastik und größere Plastikteile finden sich zum Teil in Komposten wieder und bestimmte potenziell geeignete Düngemittel stoßen bei der Richtlinienkonformität an ihre Grenzen.
Komplett in sich geschlossene Nährstoffkreisläufe gibt es für Jessen nicht. Doch Lösungsansätze für die genannten Herausforderungen sieht er in einer erhöhten Bodenfruchtbarkeit durch „Investitionen“ in den Bodenaufbau. Pflanzen mit hohen Wurzelmassen können gut zum Humusaufbau beitragen. Die Wurzelmasse kann je nach Pflanze das Zwei- bis Dreifache der oberirdischen Erntemenge betragen. Zum Anbau von Zwischenfrüchten hat er eine klare Meinung: „Zwischenfrucht nur mit Senf – damit können wir uns nicht zufriedengeben und im Ökolandbau schon gar nicht.
Leguminosenanbau: Potenziale und Herausforderungen
Seiner Meinung nach sollte der Anbau von Leguminosen gestärkt werden, da so ein betriebliches Einkommen erzielt werden kann und Stickstoff generiert wird. Auf der anderen Seite müssen beim Leguminosenanbau Wechselwirkungen beachtet werden, wie das Einhalten der Anbaupausen von mehreren Jahren bei Erbsen etc. Große Potenziale sieht der Ökoberater in der Züchtung und besseren Verwertung von Leguminosen. Bis auf eine neue Sorte der Weißen Lupine sei die Züchtung fast zum Erliegen gekommen, sagt er.
Als ebenso wichtig für die Nährstoffkonzepte der Zukunft erachtet er Kooperationen zwischen ökologischen und konventionellen Betrieben. Win-Win-Situationen gebe es z. B. bei hohen Flächenkosten und geringer Effizienz. So könnten Milchviehbetriebe einen Teil der Futterproduktion auf den Ökobetrieb auslagern.
Züchter auf der Fleischrind Vision 2020Auf der Fleischrind Vision der RinderAllianz im sachsen-anhaltischen Bismarck laufen am Donnerstag und Freitag Mini-Rinder und sanfte Riesen durch den Ring. Auf der Landesschau gibt es eine eine große Vielfalt an Rinderrassen zu sehen.
Die schönsten Fleischrinder aus den Zuchtgebieten zwischen Unstrut und Usedom sind heute und morgen (27./28. Februar) im Vermarktungszentrum der RinderAllianz im altmärkischen Bismarck in Sachsen-Anhalt zu sehen. Die Fleischrind Vision 2020 bietet Top-Qualität, Spitzengenetik und eine große Rassenvielfalt, teilte die länderübergreifende Zuchtorganisation mit. Die Veranstaltung wartet mit einem umfangreichen Programm auf.
Fleischrind Vision: Rinder aus 39 Zuchtbetrieben
Im Schauring präsentieren sich heute ab dem späten Nachmittag und morgen Vormittag 72 Zuchttiere aus zwölf Rinderrassen, darunter 24 Kühe mit Kalb sowie drei Altbullen. Das Spektrum reicht dabei vom Dexter, dem Zwergrind, bis hin zum Charolais, dem sanften Riesen. Die Fleischrinder kommen aus 39 Zuchtbetrieben, davon 34 aus Sachsen-Anhalt und fünf aus Mecklenburg-Vorpommern.
Dem heutigen Jungzüchterwettbewerb stellen sich 30 Jungzüchter im Alter von 4 bis 23 Jahren aus beiden Zuchtgebieten. Sie zeigen allen Interessierten, wie professionell, liebevoll und gekonnt sie mit ihren Rindern umgehen.
Bei der abschließenden Jungbullenauktion stehen morgen 36 Vererber der Rassen Charolais (2), Limousin (8) und Fleckvieh-Simmental (26) zum Verkauf. Es werden Käufer aus Deutschland und dem Ausland erwartet.
Der Zeitplan zur Fleischrind Vision 2019 in Bismark
Donnerstag:
Freitag:
10.00 – 12.00 Uhr Körung Bullen
14.00 – 16.00 Uhr Jungzüchterwettbewerb
16.30 – 19.00 Uhr Fleischrindschau Teil 1 (Färsenklassen)
ab 19.30 Uhr Züchterabend
9.30 – 12.30 Uhr Fleischrindschau Teil 2
(Färsen, Kühe, Bullen, Betriebssammlungen)
13.00 Uhr Auktion Jungbullen
Den Katalog der Auktionsbullen finden Sie hier.
Alles rund um die Landesschau, zum Jungzüchterwettbewerb und zur Bullenauktion demnächst in der gedruckten Ausgabe der Bauernzeitung und online auf www.bauernzeitung.de
Getriebemodell für Berufsschule
Hochwertige Leihgabe: Der Landtechnik-Bereich der Beruflichen Schule in Mecklenburg-Vorpommern kann sich über ein John-Deere-Doppelkupplungsgetriebe zu Schulungszwecken freuen.
Dem Bereich Landtechnik an der Lehrwerkstatt der Beruflichen Schule des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Demmin stehtein Modell des John-Deere-Doppelkupplungsgetriebes aus der aktuellen Produktserie 6R als Leihgabe auf unbegrenzte Zeit zur Verfügung.
Stefan Sprock, geschäftsführender Gesellschafter der B+S Landtechnik GmbH, sowie Werkstattmeister Tino Lachmann konnten das Modell zur sichtlichen Freude von Schulleitung und Mitarbeitern im Januar bereitstellen. Bisher stand den jährlich 60 angehenden Land- und Baumaschinenmechatronikern lediglich ein stationäres Motorenmodell zur Verfügung. Für die Prüfungen ist das Modell ebenfalls praktikabel. Mobil und durch den untergesetzten Träger leicht zu bewegen, kann es auch anderorts verwendet werden.

Schulleiterin Kathleen Supke und Außenstellenleiter Gunnar Seemann zeigten deutlich ihre Wertschätzung gegenüber dieser Geste von Unternehmerseite. „Wir sind der B+S Landtechnik für die Bereitstellung des Lehrmodells sehr dankbar“, unterstrich Supke ihre Begeisterung. „Es ist ja doch eine erhebliche materielle Investition, welche durch John Deere und B+S übernommen wird.“
Elke Tiegs, Verbandsjuristin des AGV Nord und Geschäftsführerin des Landesverbandes LandBauTechnik Mecklenburg-Vorpommern, war bei der Übergabe anwesend und konnte sich ein Bild über die Notwendigkeit der Modernisierung in der Lehrwerkstatt machen. moe
Umfrage: Wie künftig kastrieren?Wie stellen sich die Thüringer Ferkelerzeuger auf die Ende 2020 fällige Entscheidung zur Kastrationsmethode ein? Dazu hat der Thüringer Bauernverband gemeinsam mit der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Thüringen eine Umfrage durchgeführt.
Bis zum Ende des Jahres müssen sich vor allem Ferkelerzeuger darüber im Klaren sein, ob sie zukünftig weiter kastrieren wollen und wenn ja, mit welcher Methode. Dabei ist diese Entscheidung nicht allein vom betrieblichen Management abhängig. Auch viele äußere Faktoren spielen eine Rolle. Damit sind auch die Mäster in der Pflicht, sich mit ihren Ferkelerzeugern auseinanderzusetzen.
Kompromisse bei der Ferkelkastration
Die endgültige Entscheidung wird in den meisten Fällen ein Kompromiss sein. Denn alle Varianten bringen bekanntermaßen Vor- und Nachteile mit sich. Bei der Impfung mit Improvac ist man auf die abnehmende Hand angewiesen. Werden die Immunokastrate mit der Eber-Maske abgerechnet, ist diese Methode wirtschaftlich kaum darstellbar. Soll sich dieser Weg etablieren, müssen die Tiere zwingend wie Sauen bzw. Kastrate abgerechnet werden.
Aber wie stellen sich die Thüringer Betriebe auf diese Entscheidung ein? Haben sie schon einen Entschluss gefasst und Absprachen getroffen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, führte der Thüringer Bauernverband (TBV) gemeinsam mit der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Thüringen (IGS) Anfang Februar eine Umfrage unter Thüringer Schweinhaltern zur Ferkelkastration durch. Insgesamt beteiligten sich 15 Betriebe daran, darunter vier Ferkelerzeuger und neun Mäster sowie zwei Betriebe, die im geschlossenen System arbeiten.
Kundenbetriebe kamen auf Ferkelerzeuger zu
Alle Ferkelerzeuger gaben an, dass ihre Kundenbetriebe signalisiert haben, auch zukünftig ausschließlich Kastrate/Börge abnehmen zu wollen. Infolgedessen favorisieren diese Betriebe die Isofluran- oder Injektionsnarkose. Ein Betrieb könnte sich auch die örtliche Betäubung durch den Tierarzt vorstellen. Auch der Tierarzt hat bereits signalisiert, diese durchführen zu wollen.
Bis auf einen Betrieb vermarkten die Mäster ihre Tiere bisher ausschließlich als Kastrate und wollen dies auch nach dem 1. Januar 2021 weiter so halten. Nur einer der befragten Betriebe experimentiert bisher mit Improvac und will dieses Verfahren zukünftig etablieren. Überraschend ist, dass ein Großteil der Mäster sich bisher noch nicht mit seinen Ferkelerzeugern und Schlachtbetrieben verständigt hat, wie die Tiere zukünftig geliefert werden sollen. Nur drei Mäster haben ihren Ferkelerzeugern bereits signalisiert, auch weiterhin ausschließlich Kastrate anzunehmen.
Bei den zwei Betrieben, die im geschlossenen System arbeiten, sieht es wie folgt aus: Ein Betrieb mästet bereits Jungeber und wird das auch weiterhin tun. Der andere Betrieb kastriert und wird dies auch weiterhin mittels Injektionsnarkose tun, da der Tierarzt kein Isofluran abgeben würde.
Alternativen bei der Ferkelkastration
Das Fazit: Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass sich die Betriebe durchaus mit dem Thema beschäftigen und eine Alternative für sich suchen. Auf der anderen Seite besteht noch Rede- und Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen Gliedern der Produktionskette. Wie eingangs beschrieben, kann diese Entscheidung oft jedoch nicht losgelöst von den betrieblichen Gegebenheiten getroffen werden, sodass hier noch einige dicke Bretter zu bohren sind.
Text: Anne Byrenheid, (Thüringer Bauernverband e. V.)
Kaliumdüngung: Unterflur oder über Kopf?Zur tieferen Platzierung von Nährstoffen für Rüben gab es bislang kaum Studien. In der Magdeburger Börde sind in den letzten Jahren jedoch mehrere Versuche zum Düngen mit Kalium in Zuckerrüben gelaufen.
Von Bernd Frey und Prof. Dr. Annette Deubel
Die Ackerflächen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen werden zu mehr als 50 % ausschließlich oder überwiegend konservierend bewirtschaftet. Diese Art der pfluglosen Bodenbearbeitung weist eine Reihe von Vorteilen auf. Das Verfahren spart in der Regel Wasser und Energie und vermindert die Erosion.
Hohe Nährstoffgehalte in oberer Bodenschicht
Allerdings gibt es auch einen Nachteil. Die nichtwendende Bodenbearbeitung führt häufig dazu, dass Nährstoffe vertikal nicht gleichmäßig in der Krume verteilt werden. Es kommt zu einer Schichtung oder sogenannten Kopflastigkeit der Böden. Speziell beim Kalium ist die hohe Konzentration in der oberen Bodenschicht (vor allem die ersten 10 cm) nicht nur auf die Düngung mit Kalium (K) mit der beschriebenen begrenzten Verteilung in der Krume zurückzuführen, sondern insbesondere auch durch die auf dem Feld verbleibenden Erntereste wie Stroh, Rübenblatt oder andere Koppelprodukte. Darin sind bekanntlich große Kalium-Mengen enthalten, welche sich dann durch die nichtwendende Einarbeitung überwiegend in der oberen Bodenschicht befinden.

Werden nun Bodenproben aus z. B. 20 cm Tiefe (nach Standardmethode) entnommen, kann der ermittelte Wert natürlich nicht die ungleiche Verteilung widerspiegeln. Häufig weisen die Bodengehalte auch einen insgesamt höheren Wert im Vergleich zur wendenden Bodenbearbeitung auf. Gerade unter dem Eindruck der letzten trockenen Jahre besteht die Befürchtung, dass die Pflanzen unter diesen Bedingungen in tiefere Schichten wurzeln, um dort vorhandenes Bodenwasser zu nutzen, hier jedoch nur suboptimale Nährstoffgehalte vorfinden.
Hochschule Anhalt: Kalium-Dauerversuche seit 1994
Die plausible Schlussfolgerung ist, die tiefere Ablage von Kalium zu prüfen. Seit 1994 wird an der Hochschule Anhalt ein Kalium-Dauerversuch durchgeführt. In der geprüften Fruchtfolge stehen jährlich auch Zuckerrüben.
Die Ergebnisse beweisen, dass die Rübe auch bei optimalen Bodengehalten hohe Anforderungen an die Kaliversorgung stellt und bei Zuckergehalt und Ertrag gesichert positive Reaktionen auf eine K-Düngung zeigt. Gleichzeitig kann die Zuckerrübe bei einem nur mäßig verzweigten Wurzelsystem sehr tiefe Bodenregionen erreichen. Deshalb wurde sie als Testkultur für die Versuchsfrage ausgewählt.
Den Artikel in voller Länge lesen Sie in der Bauernzeitung 8/2020 im Schwerpunkt Zuckerrübenanbau – hier direkt als E-Paper oder in der gedruckten Ausgabe.
Getreidelaufkäfer: Weizenernte in Gefahr
Als William und Ivette Jokisch über einen ihrer Äcker spazierten, war der Schrecken groß. Der Weizen war stark geschädigt. Doch unter der Erde sah es noch schlimmer aus. Getreidelaufkäfer tummelten sich überall im Oberboden.
Haben Sie schon mal etwas vom Getreidelaufkäfer gehört? Ja sicher, werden einige von Ihnen jetzt vielleicht sagen. Im Herbst ein rechtzeitig terminiertes Pyrethroid* – und der Schädling ist unter Kontrolle. Doch dieses „Rezept” funktioniert in dieser Saison nicht wie üblich. Zumindest nicht in Brandenburg. Es ist kurz vor zwei am Nachmittag, als wir zusammen mit Landwirt William Jokisch und seiner Frau Ivette auf dem 17-ha-Weizenschlag in der Nähe von Börnicke im Brandenburger Landkreis Barnim ankommen. Der Boden ist sandig, hat aber in den letzten Wochen zumindest etwas Regen abbekommen, um nicht allzu viel Staub in die Luft zu wirbeln.
Im Boden rund um die jungen Pflanzen sind überall kleine, etwa einen halben Zentimeter große Löcher. Von Regenwürmern stammen die Bohrungen leider nicht – sie sind das Werk der Larven des Getreidelaufkäfers. Dieser sei hier überall im Boden, berichtet Jokisch. Als wir mit dem Spaten etwas herumgraben, kommen mehr als zehn Larven zum Vorschein. Sie fressen die Blätter von Getreidebeständen an und saugen das Chlorophyll heraus, sagt Ivette Jokisch.
Bio auf 110 Hektar
Die Jokischs betreiben im Nachbardorf Willmersdorf einen Ökobetrieb mit 110 ha Ackerfläche. Daneben halten sie noch etwas Geflügel, das sie direktvermarkten. Außerdem gehören zwei Emus zu ihrem Tierbestand. Den Anbauschwerpunkt bildet das Getreide, das sie unter dem Bioland-Siegel vermarkten. Die Jokischs betreiben im Nachbardorf Willmersdorf einen Ökobetrieb mit 110 ha Ackerfläche. Daneben halten sie noch etwas Geflügel, das sie direktvermarkten. Außerdem gehören zwei Emus zu ihrem Tierbestand. Den Anbauschwerpunkt bildet das Getreide, das sie unter dem Bioland-Siegel vermarkten.
Als das Ehepaar Jokisch Ende Dezember über die Flächen ging, war der Schrecken groß. Der Winterweizen, den William Jokisch im Herbst ausgesät hatte, sah schlecht aus. Die Blätter waren angefressen und bräunlich gefärbt, erzählen die beiden.
*Nachtrag: Die Bekämpfung mit einem Pyrethroid bezieht sich nicht auf den Ökobetrieb von William Jokisch selbst, sondern blickt beispielhaft auf Maßnahmen in konventionell wirtschaftenden Betrieben. Danke an unseren Leser Raphael V. für den Hinweis, dies klarer herauszustellen.
Die ganze Geschichte lesen Sie in der Bauernzeitung 8/2020 als E-Paper oder gedruckt.
Wie hoch ist momentan das Vogelgrippe-Risiko?
In Deutschland hat es zum wiederholten Mal einen Fall von Vogelgrippe gegeben. Die Bauernzeitung hat bei Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, nachgefragt, wie der Experte die aktuelle Gefahrensituation für Geflügelhalter einschätzt.
Bauernzeitung: Prof. Mettenleiter, wie hoch schätzen Sie die Gefahr eines Eintrags mit der hochpathogenen Vogelgrippe HPAIV in einen Nutztiergeflügelbestand in Deutschland ein?

Das Vogelgrippe-Risiko eines Eintrags von HPAIV in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte Kontakte zu Wildvögeln wird vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) als mäßig eingestuft. Das Risiko eines direkten Viruseintrages in deutsche Geflügelbetriebe durch Lebendtransporte aus EU-Mitgliedstaaten wird als gering erachtet. Das Risiko eines Eintrags durch mit HPAI-Viren kontaminierte Gegenstände aus den betroffenen Regionen (derzeit in Polen, der Slowakei, Rumänien, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Ukraine) wird als mäßig eingestuft.
Wie ansteckend ist das HPAI-Virus des Subtyps H5N8? Wodurch kann die Vogelgrippe übertragen werden?
Das in den oben genannten Fällen festgestellte Virus zeigt die für Geflügelpestviren typische hoch krankmachende Wirkung und Ansteckungsfähigkeit bei Hühnervögeln und Puten, ähnlich dem 2016/17 aufgetretenen H5N8. Bei Wassergeflügel gehen wir nach den bisher zur Verfügung stehenden Informationen ebenfalls von einer hohen Ansteckungsfähigkeit aus. Die Genomanalysen der in Deutschland aufgetretenen Viren weisen eine sehr hohe Übereinstimmung mit den bislang in Osteuropa aufgetretenen Erregern auf.
Worauf müssen Geflügelhalter in Deutschland jetzt besonders achten? Wie können sie ihre Tiere vor einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus des Subtyps H5N8 wirksam schützen?
Tierhalter sollten ihre Biosicherheitsmaßnahmen überprüfen und bei Bedarf anpassen. Hierfür stehen Checklisten im Internet zur Verfügung. Beispielsweise eine Risikoampel, die von der Universität Vechta in Zusammenarbeit mit dem FLI erstellt wurde. Für Kleinhaltungen hat das FLI ein Merkblatt zur Umsetzung der Mindest-Biosicherheitsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Zudem sollten generell, insbesondere aber in der Nähe zu Geflügelhaltungen entdeckte verendete oder kranke Wildvögel an die zuständige Veterinärbehörde gemeldet werden.

Das könnte Sie auch interessieren:
Geflügelpest in Brandenburg nachgewiesen
Bei einer verendeten Blessgans im Landkreis Spree-Neiße wurde im Januar der Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen. Es ist der erste bestätigte Fall in Deutschland. mehr
Was ist auf Lebendtransporten von Geflügel, besonders durch Osteuropa, zu beachten?
Beim Verbringen von Geflügel aus betroffenen Regionen ist Vorsicht geboten. Hierzu gehört die sorgfältige Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Gerätschaften, die aus betroffenen Regionen nach Deutschland verbracht werden. Außerdem sollten Personenkontakte in Geflügelbetrieben, die sich in betroffenen Regionen befinden, vermieden werden und gegebenfalls eine Karenzzeit von mindesten 72 Stunden nach Betreten eines HPAI-verdächtigen Betriebes eingehalten werden (Krankheitssymptome und/oder erhöhte Sterberate).
Was sollte ein Geflügelhalter sofort tun, wenn er verendete Tiere in seinem Stall findet und der Verdacht auf Vogelgrippe besteht?
Falls eine erhöhte Sterblichkeit bei Vögeln beziehungsweise Geflügel auftritt, sollten die zuständigen Behörden unverzüglich benachrichtigt werden.
Interview: Bettina Karl
Rotes Gebiet trotz „Bruchteil des Grenzwertes“Zwei Agrarbetriebe in Nordsachsen liegen zu 60 % im roten Gebiet – trotz bester Nitratwerte am Messpunkt auf den eigenen Flächen. Für Geschäftsführer Ulrich Blanke ist das schwer zu verstehen.
Ein Interview von Karsten Bär
Herr Blanke, wann haben Sie erfahren, dass Ihre Betriebsflächen im roten Gebiet liegen?
Im vergangenen Jahr hat mich ein benachbarter Kollege, ein Ökolandwirt, darauf aufmerksam gemacht. Ich habe mich daraufhin bei der zuständigen Außenstelle des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erkundigt, die das bestätigte. 60 % unserer Flächen liegen demnach im roten Gebiet.
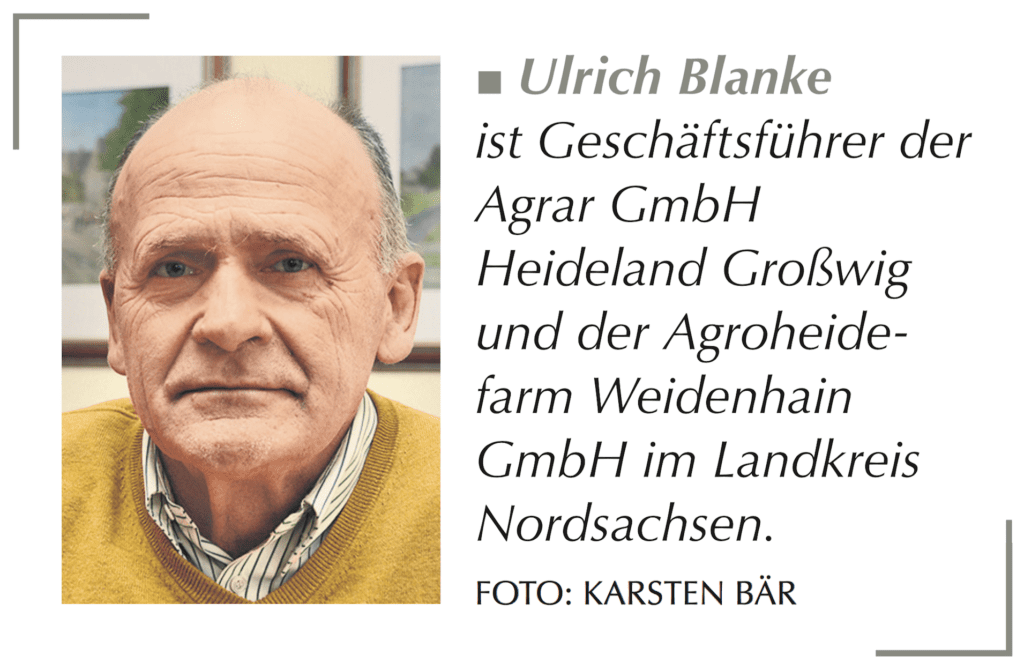
Ausschlaggebend ist ein Messpunkt mit Nitratwerten im Grundwasser, die zwischen 50 und 70 mg/l schwanken. Diese Messstelle liegt aber außerhalb unserer Flächen – und eine andere Messstelle auf unseren Flächen ergibt Nitratwerte von lediglich 0,221 mg/l, weniger als ein Zweihundertstel des Grenzwerts!
Nitratgebiet trotz guter Werte – passt das zusammen?
Dass wir trotzdem rotes Gebiet wurden, wird mit den bestehenden Wasserschichten und Fließrichtungen im Boden begründet. Aber für mich ist das schwer nachzuvollziehen. Wir haben auch selbst Wasser aus unseren Brunnen für die Tränkwasserversorgung untersuchen lassen. Dort haben wir einen Nitratgehalt von 2,8 mg/l, also immer noch ein Bruchteil des Grenzwertes. Deshalb sind wir in Widerspruch gegen die Einstufung als rotes Gebiet gegangen.
Mit Erfolg?

Nein. Man hat uns deutlich gemacht, dass der Widerspruch keine Erfolgsaussichten hat, weil die Abgrenzung des roten Gebiets fachlich begründet ist. Auch meine Vermutung, dass eine Fläche mit militärischen Altlasten in der Nähe der Messstelle für die überhöhten Werte verantwortlich ist, lässt sich nicht bestätigen. Die Stoffe, die dort potenziell austreten könnten, verursachen keine Nitratbelastung.
Was bedeutet die Einstufung als rotes Gebiet für die beiden von Ihnen geleiteten Betriebe?
Es ist ja bekannt, dass im roten Gebiet nur noch 20 % unter dem Pflanzenbedarf gedüngt werden darf. Zudem müssen wir auf der betroffenen Fläche regelmäßig Bodenproben nehmen und untersuchen lassen. Und das von 60 % der Fläche – das sind auch keine geringen Kosten. Generell bindet das Thema fachliche Kraft. Das bremst uns auch dabei, notwendige Investitionen vorzubereiten und zu realisieren. Wir fühlen uns wie aufs Abstellgleis gestellt. Fachlich gehen die Vorschriften doch zunehmend an der Realität vorbei.
Wir haben über Dezember und Januar bis jetzt noch Rinder auf der Weide, weil es bei dieser Witterung noch Aufwuchs gibt. Wir reden alle vom Klimawandel, es wird milder und die Pflanzen wachsen eine längere Zeit im Jahr. Warum werden Düngungssperrfristen dann nicht an tatsächliche Temperaturen geknüpft? Stattdessen sind die Sperrfristen für uns noch einmal verlängert worden. Es geht also nicht mehr um die realen Bedingungen, sondern nur noch um Paragraphen.
Update (24.02.): Dass die Altlasten einer ehemals militärisch genutzten Fläche keine Auswirkungen auf die Nitratbelastung des Grundwassers haben, ist laut Ulrich Blanke eine Aussage des LfULG. Er habe inzwischen jedoch eine zweite, gegenteilige Meinung von Düngungsexperten erhalten, teilte er uns mit.
Die Agrar GmbH Heideland Großwig und die Agroheidefarm Weidenhain GmbH bewirtschaften zusammen 1.300 ha im Südosten der Dübener Heide bei Torgau auf leichten Standorten. Neben Pflanzenproduktion, Milchviehhaltung und Mutterkuhhaltung ist die Direktvermarktung von Fleischprodukten ein wichtiges Standbein des Unternehmensverbundes.
Der Ziegenhirte von der Elbe
Er hat Informatik studiert, doch den Job an den Nagel gehängt: Heute ist Patrick Pietsch Hirte in der Sächsischen Schweiz. Seine Thüringer Wald Ziegen lässt er am Fuße der Festung Königstein weiden.
Da kann man nicht meckern: So ein tierisches Spektakel bekommt das Festungsstädtchen Königstein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nicht alle Tage zu Gesicht. Denn im vergangenen Herbst trieb Ziegenhirte Patrick Pietsch erstmals seine Thüringer Wald Ziegenherde im Beisein von etlichen Schaulustigen vom Sommerquartier in Pfaffendorf ins Winterquartier nach Halbestadt. Zunächst ging es für die Mutterziegen und weiblichen Jungziegen ziemlich flott und ohne großes Gemecker hinunter ins Tal nach Königstein und dann weiter durch den Ort zur Fähre.
Schließlich setzten die Tiere samt Ziegenhirten über auf die andere Seite der Elbe ins Winterquartier. Dort wartete Zuchtbock Balthasar bereits ungeduldig und sehnsüchtig auf „seine“ Damen. Und dessen Einsatz hat sich gelohnt: „Vier Muttertiere sind trächtig und erwarten meist im Doppelpack Nachwuchs. Zu Ostern wird es soweit sein“, rechnet der Hirte und bedauert sogleich, dass sich damit eine verbindliche Buchung für eine Ziegen-Wanderung kompliziert gestalten wird.
Ein Leben für die Ziegen
Der gebürtige Dresdner Patrick Pietsch, auch Patu genannt, entschied sich vor fünf Jahren für ein Leben mit den Ziegen. Um genau zu sein – mit Thüringer Wald Ziegen. Von dieser vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse hat er vier Muttertiere samt Jungziegen sowie einen Zuchtbock. Insgesamt beläuft sich der Ziegenbestand auf aktuell 30 Tiere. Sie weiden unter anderem unweit des Tafelberges „Quirl“ und in den Flussniederungen der Elbe unterhalb des Königsteins. Zusätzlich will Patrick Pietsch seine kleine Herde noch um zehn Bocklämmer aufstocken, die er bei dem befreundeten Radebeuler Ziegenprojekt „Ziegenwein“ holen wird.

Mit der Zeit sind immer mehr vorwiegend kleine, private Pachtgrundstücke für die Beweidung hinzugekommen und so bewirtschaft er jetzt ungefähr fünf Hektar, verrät der über 30-Jährige. Besonders ideal sei die sonnenverwöhnte, unmittelbar an der Elbe gelegene Gemarkung Halbestadt. Durch die Nähe des Flusses und die Südseite finden die Tiere selbst in den Wintermonaten immer genügend Grünes, sodass Ziegenhirte Pietsch auf das Zufüttern von Heu und Kraftfutter verzichten kann. Auch feste Ställe gibt es nicht. Stattdessen setzt er auf eine Jurte, die er jederzeit auf- und abbauen kann und die den Tieren Schutz vor Nässe und Kälte bietet. Die Jurte, so sagt er, habe auch die Regengüsse und kleineren Stürme der letzten Wochen gut überstanden. Was er hingegen gerade problematisch sieht, das sind die weichen, nassen und matschigen Weideflächen.
Der studierte Informatiker besucht mindestens einmal täglich seine kleine Herde am Fluss, ist meist mit dem Fahrrad unterwegs und für die Überquerung benutzt er die Fähre. Sobald er die erste von zwei Ziegenherden erreicht hat, rennen ihm die vier Muttertiere Lexa, Lilly, Arne und Alvine in Begleitung von Balthasar, dem Zuchtbock, entgegen. Lexa fängt gleich an zu schmusen. Das gefällt dem Hirten allerdings überhaupt nicht. „Ich habe die Tiere so konditioniert, dass sie speziell bei unseren Wanderungen Abstand zu den Teilnehmern halten.“ Das gleiche gelte auch beim Essen, denn wer möchte sich während der Wanderpause schon die Brote stibitzen lassen?
Bei Gershi und Anashqa, seinen ersten Ziegen, sei das noch anders gewesen, plaudert er aus dem Nähkästchen. Die beiden hatten so eine innige Verbindung zu ihm aufgebaut, dass sie jeden Zaun überwanden, um ihrem Hirten zu folgen. „Ich hatte die beiden schon in Dresden und habe mich intensiv mit ihnen beschäftigt. Sie waren auch dabei, als ich ein Jahr in Struppen auf dem Schellehof in der Sächsischen Schweiz gelebt und gearbeitet habe“, resümiert Patu, der in der Sächsischen Schweiz geblieben ist und sich ein wenig als Nomade versteht. Zwar habe er ein so inniges Verhältnis wie zu dem Ziegenpärchen Gershi und Anashqa seitdem bewusst vermieden. Dennoch verbindet den Hirten und seine Ziegen etwas Besonderes: So bringen die Zibben ihre Lämmer erst dann zur Welt, wenn Patu bei ihnen ist. Dieser Umstand und der geplante Geburtstermin im April führen dazu, dass es bei dem Ziegenhirten keine von ihren Müttern verstoßene Jungen gibt. Zumindest bisher nicht.
Schonende Beweidung
Ob auf den Elbwiesen oder auf den Steilflächen – seine Tiere seien auf beiden Seiten der Elbe wichtige Landschaftspfleger, indem sie die Flächen schonend beweiden, erklärt der Ziegenhirte, der sein Wissen über und seine Begeisterung für die Tiere und deren Haltung auch sehr gern bei Wanderungen an interessierte Besucher weitergibt.

Pietsch hatte sich nach der Haltung von Kaninchen, Laufenten und Schafen letztlich 2014 für Ziegen und gegen ein großstädtisches Leben als Softwareentwickler und Wirtschaftsinformatiker entschieden. „Ich hatte während meines Studiums Zugang zu selbstverwalteten Strukturen bekommen, und das Thema Umweltbildung spielte ebenfalls schon eine Rolle. Ich wollte nachhaltig Lebensmittel produzieren und auf eine zukunftsfähige Landwirtschaft setzen.“ Schließlich habe das über mehrere Tausend Jahre funktioniert. Und zwar auch hier, am Fuße des Königsteins, wo es auf der Festung immer mehrere Hundert Leute zu versorgen galt und kleinstrukturierte Flächen zu pflegen waren. „Dies ist auch heute durch durchdachte, logistische Strukturen möglich. Dadurch werden die Ausgaben gesenkt und die Erzeugung von handwerklichen Kleinstmengen wird wirtschaftlich möglich. Auf den Einsatz von eigenen Maschinen wird komplett verzichtet. Ein weit im Voraus geplantes Weide- und Tiermanagement führt zum durchgängigen Aufwuchs des Grünlandes, das CO2 bindet und zu Humusaufbau der absterbenden Graswurzeln führt“, erklärt er.
Auch beim Transport will der junge Hirte CO2-arme Strukturen für seine qualitativ hochwertigen Produkte aufbauen. Dazu gehört sein Wunsch, mit seinen Tieren zum Schlachter wandern zu wollen, beziehungsweise irgendwann einmal vor Ort schlachten zu lassen. Früher habe es viele Fleischereien im Landkreis gegeben, heute sind sie an einer Hand abzuzählen. Patrick Pietsch arbeitet beim Zerlegen der Tiere und der Herstellung seiner Ziegenknacker mit Fleischermeister Thomas Schick in Pirna und der Fleischerei Falk Häntzschel in Reinhardtsdorf-Schöna zusammen.
Ziegenatelier eröffnet
Der Vertrieb funktioniert größtenteils online – beispielsweise über die Plattform Marktschwärmer. Pietsch bringt dann den Kunden das Fleisch per S-Bahn nach Dresden in ein Depot, wo sie es innerhalb von zwei Stunden abholen können. Damit erspart er sich lange Wartezeiten auf den Wochenmärkten.
Sein erklärtes Ziel ist es, die Ziege vollkommen „auszuschöpfen“. Dazu soll auch sein Ziegenatelier auf der Bielatalstraße 13 in Königstein beitragen, das am 28. März eröffnet wird – mit u. a. Folkmusik und Vorträgen. Die Besucher werden in der kleinen Ausstellung Wissenswertes rund um das Hörnertier und dessen Präsenz in der Kulturlandschaft erfahren sowie hochwertige und regionale Produkte rund um die Ziege kaufen können – wie Seife, Ziegenmilch, Knacker und Felle. Und nicht zu vergessen – auch das ist dem Königsteiner Ziegenhirten wichtig – sind die kleinen Arbeitseinsätze mit Anwohnern und Helfern auf den Elbwiesen, bei denen Müll, Treib- und Fallgut eingesammelt werden. Und im Juni wird gemeinsam die Heuernte eingebracht.
Gordischer Knoten NutztierhaltungHohe Tierschutzstandards, strenge Umweltauflagen, Preisdruck des Handels – die Aufgabe, Tierhaltung mit den gesellschaftlichen Ansprüchen in Einklang zu bringen, erinnert an den berühmten Gordischen Knoten. Kann die Borchert-Kommission das Wirrwarr zerschlagen?
Der berühmte gordische Knoten hielt zwar ein Gespann zusammen, hat aber sonst mit bäuerlicher Tierhaltung wenig zu tun. Es war der Wagen eines Königs, dessen Deichsel die unauflöslich verknödelten Seile mit dem Joch verbanden. Wer es schaffte, das Wirrwarr zu entpfriemeln, sollte die Herrschaft über Asien erlangen. Das war damals so erstrebenswert, dass sich viele daran versuchten. Nur Alexander der Große schaffte es. Der Sage nach griff er kurzerhand zum Schwert.
Die Aufgabe, Tierhaltung mit den gesellschaftlichen Ansprüchen in Einklang zu bringen, erinnert nahezu zwangsläufig an dieses sagenhafte Gebilde. Hohe Tierschutzstandards, strenge Umweltauflagen, Preisdruck des Handels, Wettbewerb um Kostenführerschaft auf dem Weltmarkt, Kritik von Politikern, Anfeindungen von Tierschützern, Bloßstellungen in den Medien – das sind nur einige der Enden, die im Betrieb zu einem gewaltigen Wust zusammenlaufen. Den Tierhaltern liegt er wie ein schwerer Stein auf der Brust. Und ein Alexander mit dem Schwert ist weit und breit nicht in Sicht.

In Jochen Borchert, dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister, würde man den Knotenlöser auch kaum vermuten. Zwar Bauernsohn aus der Altmark, ist aber das Hemdsärmelig-Robuste, das man von Knotendurchschlägern gemeinhin erwartet, nie das Ding des Ökonomen gewesen. So war die Skepsis groß, als ihn die Bundeslandwirtschaftsministerin im vorigen Jahr mit dem Vorsitz des „Kompetenznetzwerkes Nutztierhaltung“ betraute. Ihr Auftrag an die 30 Fachleute und Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft: Findet den Weg zu einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung! Denn nach wie vor stehen die Aussagen im Raum, mit denen schon 2015 der Wissenschaftliche Beirat für heftige Diskussionen innerhalb wie außerhalb der Landwirtschaft gesorgt hatte.

Von „Defiziten beim Tier- und Umweltschutz“ war in dem aus der Landwirtschaft heftig kritisierten Gutachten die Rede, vom „Wandel der Wertvorstellungen zum Mensch-Tier-Verhältnis“ in der Gesellschaft. Dies betrachtet, seien „die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere nicht zukunftsfähig“, lautete das Fazit. Irgendwann legte sich die Empörung. Die Debatte versandete, auch weil es keine Antwort auf die nicht unwichtige Frage gab, woher die Milliarden für den Umbau der Tierhaltung kommen sollten.
Dass Alexander das Schwert nahm, steht übrigens nicht fest. Laut einer zweiten Legende zog er nach genauer Untersuchung nur den Deichselnagel raus und bekam so das Zugjoch frei. Nicht weniger scheint der Borchert-Kommission gelungen zu sein. Ihre Empfehlungen könnten ein Fahrplan zu gesellschaftlich akzeptierter Nutztierhaltung in Deutschland sein. In spätestens 20 Jahren soll jedes Nutztier in den Stufen 2 und 3 des geplanten Tierwohllabels gehalten werden. Mit dem Vorschlag, eine Fleischabgabe einzuführen, liegt zugleich ein Angebot für die Finanzierung auf dem Tisch. Um sie den Betrieben zu garantieren, soll der Staat mit Tierhaltern 20-Jahres-Verträge abschließen, wie es Bioenergieerzeuger vom EEG kennen.
Die Empfehlungen sind radikal. Nicht nur, was die Finanzierung über eine zusätzliche Abgabe betrifft. Bedeuten sie doch zumindest in Teilen eine Abkehr vom Weltmarkt. Aber den Anschluss an die globalen Kostenführer, so argumentiert Borchert, werden die heimischen Tierhalter mit jeder neuen Regulierung ohnehin ein Stück mehr verlieren. Er ist überzeugt, dass die Empfehlungen des Kompetenznetzwerkes die Tierhaltung insgesamt nicht gefährden, sondern zu mehr Stabilität führen werden. Eine spannende Diskussion ist eröffnet.
Leistungsmelken: Die Besten im LandBis 22 Uhr standen am Mittwochabend junge Thüringer Melkerinnen und Melker in Neumark im Wettbewerb um den Landestitel im Leistungsmelken.
Am gestrigen Abend (19. Februar) startete Punkt 19.30 Uhr der Praxisteil des Landesausscheids im Leistungsmelken. Acht junge Thüringer Melkerinnen und ein Melker waren am Start. Die Erzeuger-Genossenschaft Neumark eG als Gastgeber und ihr eingespieltes Team sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Drei Melker konnten gleichzeitig im Side by Side-Melkstand (De Laval; 2 x 30) ihr Können unter Beweis stellen. Die schönen, sauberen Kühe der Neumarker dürften ihre Motivation zusätzlich gesteigert haben.
Die Erzeuger-Genossenschaft wurde 2012 mit dem Tierschutzpreis des Freistaates ausgezeichnet. In der Begründung hieß es, der Betrieb im Weimarer Land sei „ein lebendiges Beispiel dafür, dass auch in größeren Tierhaltungen herausragende Bedingungen für eine artgerechte Haltung geschaffen werden können“. Der Begriff „Tierkomfort“ werde mit Herz und Fachverstand gelebt.
1.400 melkende Kühe
Gemelkt werden zweimal täglich rund 1.400 Kühe. Mit drei Leuten im Melkstand und einem Treiber beginnen die Schichten gewöhnlich um 7 Uhr bzw. 19 Uhr. Anders als andere Betriebe entschied man sich beim Neubau im Jahr 2010/2011 für einen Side by Side-Melkstand. Zuvor wurde im Karussell gemolken.
Wer am Mittwochabend Landesmeister und Vizemeister 2020 im Melken geworden ist, gibt die Thüringer Melkergemeinschaft am 12. März in Jena bekannt. Die beiden werden für den Freistaat beim Bundesausscheid Mitte April in Rheinland-Pfalz antreten. fh
IVM-Betriebsvergleich: Lebensleistung ist entscheidendViele Faktoren zeichnen Spitzenbetriebe aus. Wichtig für den Erfolg ist ein gutes Management. Das zeigt das Ergebnis des Betriebsvergleiches des Interessenverbandes der Milcherzeuger (IVM).
Mit den Ergebnissen der IVM-Betriebsauswertung 2019 liegen jetzt gut vergleichbare Daten aus den letzten zehn Jahren vor. Dies ermöglicht eine langjährige Bewertung der Entwicklung relevanter Kennziffern – zum einen für die Milchviehanlagen des Verbandes insgesamt, als auch für jeden einzelnen Betrieb. Der Betriebsvergleich wurde intern mit den Mitgliedsbetrieben ausgewertet und diskutiert. Die Datenerhebung und Auswertung erfolgte erstmals nicht durch den IVM selbst, sondern extern von Dr. Frank Wesenberg, IAK Agrar Consulting GmbH Leipzig.
Ein Ziel ist die zukünftig noch bessere und objektivere Vergleichbarkeit der Kennziffern, die seit 2019 einheitlich für den Zeitraum des Milchleistungsprüfjahres (jeweils vom 1.10.–30.9.) erhoben werden. Der IVM-Betriebsvergleich soll, auch aufgrund der aktuellen umfassenderen gesellschaftlichen Kommunikation, in den nächsten Jahren weiter qualifiziert und damit noch aussagefähiger werden.
Bestandserweiterung abgeschwächt
Im Schnitt der 35 ausgewerteten IVM-Unternehmen wurde im Milchwirtschaftsjahr 2018/19 eine LKV-Milchleistung (LKV=Landeskontrollverband) von 10.612 kg Milch je Kuh und Jahr ermittelt. Das waren nochmals 160 kg mehr als das schon sehr hohe Leistungsniveau im Vorjahr. Die Leistungsentwicklung ist Ausdruck dafür, dass die Betriebe, trotz aller in der Vorjahresbefragung geäußerten Zweifel, die angespannte Futtersituation 2018 mit viel Aufwand gemeistert haben. Da auch 2019 vielerorts witterungsbedingt erneut nur unterdurchschnittliche Futtererträge erreicht wurden, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
Die Auswertung 2019 zeigt aber auch, dass das regional sehr differenziert zu bewerten ist. Viele Betriebe haben auf die Futtersituation 2018 mit einer Ausweitung der Futteranbaufläche reagiert …
Lesen Sie den ganzen Artikel zum IVM-Betriebsvergleich in der Ausgabe 06 der Bauernzeitung