Am Sonntag entdeckten Spaziergänger in der Nähe einer Ferkelaufzuchtanlage im Havelland lebende Ferkel in einem Kadavercontainer. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Drei noch lebende zwischen 30 toten Ferkeln wurden am Sonntag in einem Kadavercontainer in der Nähe einer Ferkelaufzuchtanlage in Bützer (Havelland) entdeckt. Spaziergänger hatten die panisch quiekenden Tiere gehört und die Polizei gerufen. Diese verständigte Feuerwehr und Veterinäramt.

(c) Kay Harzmann 
(c) Kay Harzmann
Eines der drei noch lebenden Ferkel im Kadavercontainer war schwer verletzt und wurde durch einen Jäger vor Ort fachgerecht getötet. Die anderen beiden Ferkel seien zunächst in die Zuchtanlage zurückgebracht worden, hätten aber aus hygienischen Gründen getötet werden müssen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Die Polizei nahm die Personalien eines Verantwortlichen des Betriebs und mehrerer anwesender Mitarbeiter auf und leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

(c) Kay Harzmann 
(c) Kay Harzmann
Landesbauernverband (LBV) distanzierte sich deutlich
Die Ferkelaufzuchtanlage in Bützer gehört zur Fläminger Tiergut GmbH mit Hauptsitz in Bad Belzig, Ortsteil Schwanebeck mit 20.000 Geschäftsführer Erwin van den Borne war auch am Dienstag telefonisch nicht erreichbar, um zu den Vorgängen in seinem Betrieb Auskunft zu geben.
Der Landesbauernverband (LBV) distanzierte sich deutlich: „So etwas darf unter keinen Umständen geschehen. Wenn Tiere in den Kadavercontainer verbracht werden, muss sichergestellt sein, dass diese tatsächlich tot sind“, stellte Dorsten Höhne, Vorsitzender des Fachausschusses Tierhaltung/Tiergesundheit beim LBV Brandenburg klar. Das betroffene Unternehmen sei kein Mitglied im Bauernverband, so Höhne in einer Pressemitteilung des LBV am Montagnachmittag. Dirk Peters, Kreisbauernverbandsvorsitzender im Havelland forderte gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) eine schnellstmögliche Aufklärung und Ahndung. In diesem Punkt gebe es für ihn null Toleranz, so Peters.
Brandenburg will Anbau von Nutzhanf fördernBis in die 1950er-Jahre war in Brandenburg der Anbau von Nutzhanf zur Fasergewinnung und als Viehfutter üblich. Seit Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 1996 ist das rein rechtlich wieder möglich, allerdings mit hohem bürokratischem Aufwand. Der Landtag hat am Mittwoch (28. April) beschlossen, den Nutzhanfanbau im Land zu fördern.
Der Beschlussantrag der Regierungsfraktionen wurde am Mittwochnachmittag vom Landtag mehrheitlich angenommen. Jetzt ist das Agrarministerium gefordert. Zunächst sollen mit den berufsständischen Fachverbänden und Forschungseinrichtungen wie dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie ATB die Potenziale hanfbasierter Wertschöpfungsketten (Dämmmaterialien, verspinnbare Zellstoffe wie Lyohemp) erkundet und Maßnahmen entwickelt werden.
Der nächste Schritt sind Förderprogramme (Forschung und Investitionen) zu Nutzhanfernte und -verarbeitung, zur Unterstützung von Wertschöpfungsketten und zur Förderung der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Außerdem sollen sich bestehende Initiativen (Prignitz-Ruppin-Havelland und Lausitz) zu „Hanfclustern“ mausern.
Die Abgeordneten beschlossen zudem, das Ministerium möge gemeinsam mit den zuständigen Stellen für Gesundheit die aktuell gültigen THC-Grenzwerte bei der Zulassung von Saatgut neu bewerten und mit den Werten und Erfahrungen anderer europäischer Staaten vergleichen, um Wettbewerbsnachteile für die brandenburgische Hanfproduktion und -verarbeitung zu vermeiden. „Es ist eine Empfehlung zu erarbeiten, die aussagt, ob eine Kopplung des landwirtschaftlichen Nutzhanfanbaus an das Betäubungsmittelgesetz noch als zeitgemäß zu bewerten ist.“ Entsprechend solle sich das Land auf Bundesebene starkmachen.
bürokratische Hemmnisse auf bundesebene
„Hanf ist eine vielseitig einsetzbare Nutzpflanze, deren Anbau in Brandenburg auf vielen Standorten sehr gut möglich ist und sich gut in die Fruchtfolgen vieler Ackerbaubetriebe einfügen kann“, begründete Johannes Funke, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion die Initiative.
Allerdings seien die bürokratischen Hemmnisse vergleichsweise hoch: „Der Anbau von Nutzhanf ist seit 1996 zwar möglich. Durch die enge Bindung an das Betäubungsmittelgesetz ist der bürokratische Aufwand für Landwirte und Verarbeiter vergleichsweise hoch“, so Funke. Das Regelwerk rund um den Hanf habe sicherlich seinen tieferen Sinn, dennoch sollten wir uns heute fragen, ob die bestehenden Reglungen nicht zu scharf und noch auf der Höhe der Zeit sind.

Den Linken geht der Beschluss nicht weit genug. Sie möchten, dass sich Brandenburg gleich auf Bundesebene für eine Neufassung der rechtlichen Rahmenbedingungen einsetzt, ohne erst eine Empfehlung zu erarbeiten. Ihr Änderungsantrag wurde allerdings abgelehnt. Agrarminister Axel Vogel wies darauf hin, dass man sich diesbezüglich zuvor mit dem Gesundheitsministerium verständigen müsse.
Der Minister machte deutlich, dass der Hanfanbau in Brandenburg schon jetzt gefördert werde und begründete die Vorteile: „Die Hanfpflanze nutzt Wasser etwa sechsmal effizienter als Baumwolle und ist daher in Zeiten zunehmender Trockenheit von besonderem Interesse für die Brandenburger Landwirtschaft. Nutzhanf eignet sich für den Anbau unter Brandenburger Bedingungen, besitzt einen guten Vorfruchtwert und lässt sich in alle Fruchtfolgen integrieren. Darüber hinaus kommen stabile Bestände ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel aus.“
Ausbaufähig: Kompetenznetzwerk Hanf
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz fördert das „Kompetenznetzwerk Nutzhanf“, dessen Träger der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land ist, mit 50.000 Euro über die Richtlinie zur Förderung der konzeptionellen Zusammenarbeit für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Das Projekt läuft bis Ende 2021 und konzentriert sich auf die Begleitung des Nutzhanfanbaus, die Vermarktung des Rohstoffs sowie die Wissensvermittlung. Die Bauernzeitung berichtete im vergangenen Jahr ausführlich über den Feldtag Nutzhanf (Bauernzeitung 2020/27, S. 32). Erst kürzlich ging es in einem Fachbeitrag um den Einsatz von Nutzhanf in der Pferdehaltung.

Noch stelle die Verarbeitung von Hanferzeugnissen eine Nische dar, doch mit der Hanffaser Uckermark eG gebe es bereits einen Pionier für die Herstellung von technischen Fasern und nachhaltigen Baustoffen aus regional erzeugtem Nutzhanf, erinnerte Vogel. Der Agrarausschuss hatte sich zuletzt im Januar 2021 in einem Fachgespräch über den Hanfanbau informiert. Dort beantworteten Wissenschaftler und Praktiker die Fragen der Abgeordneten. Zu Wort kamen Dr. Hans Gusovius (Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V.), Daniel Kruse (European Industrial Hemp Association), Jan Paki (Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land), Manuela Ludwig (bioformtex GmbH), Dr. Wilhelm Schäkel (Bio Ranch Zempow), Rafael Dulon (Hanf Farm GmbH) und Rainer Nowotny (Hanffaser Uckermark eG).

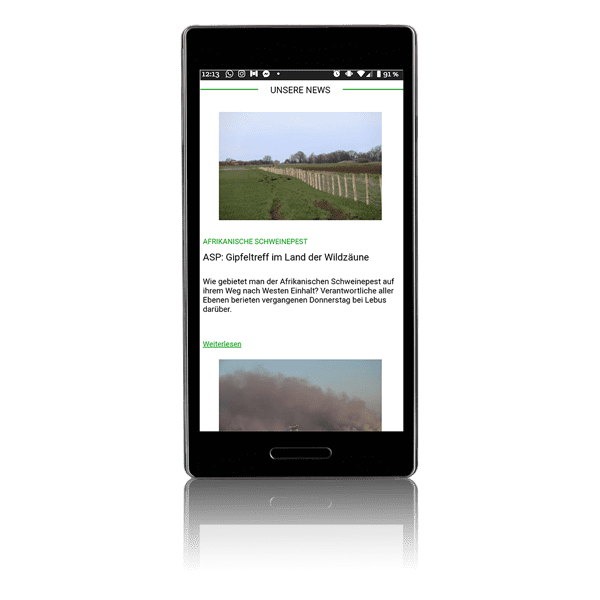
Unser Bauernzeitungs-Newsletter
- Die wichtigsten Nachrichten der ostdeutschen Landwirtschaft
- Regional & praxisnah
- exklusive Angebote und Gewinne
- natürlich kostenlos

Nach 24 Jahren Schweinemast sind seit heute die Ställe von Karsten Ilse leer. Bereits im November hatte der Landwirt beschlossen die Schweinehaltung in Letschin (Oderbruch) aufzugeben, da wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) die Verluste für Mäster in der ASP-Restriktionszone zu groß waren.
Heute Morgen (19. April), 7.30 Uhr: Landwirt Karsten Ilse aus Letschin, einer der wenigen Schweinehalter im Landkreis Märkisch-Oderland (Brandenburg), verlädt seine letzten 36 Mastschweine. Das Transportunternehmen bringt sie nach Kellinghusen. Der Schlachthof in Schleswig-Holstein ist der einzige, der bereit ist, Hausschweine aus den ASP-Restriktionszonen zu schlachten. Der Landesbauernverband (LBV) begleitete die Aktion heute Morgen und stellte einen Film auf youtube:
Karsten Ilse muss als Mäster mit erheblichen Abzügen rechnen, da nicht alle Teile der Schweine aus den Restriktionsgebieten vermarktet werden dürfen. Auch die Testung auf ASP-Freiheit vor der Verladung verursacht erhebliche Kosten. Seit Ausbruch der ASP in Brandenburg erlöst Karsten Ilse somit 25 Euro weniger pro Tier als Landwirte außerhalb der Restriktionszone, und das bei der ohnehin geringen Marge. Die Bauernzeitung berichtete Anfang November 2020 über Ilses Pläne, deren Umsetzung er heute abgeschlossen hat.
Verluste für Schweinehalter in ASP-Restriktionszonen
Der Landesbauernverband fasst in seiner Pressemitteilung die Ereignisse zusammen: „Bis vor einem Jahr hielt Ilse im Durchschnitt 1.500 Schweine, doch nun ist nach 24 Jahren Schluss. Dabei hatte der Landwirt aus Märkisch-Oderland noch vor drei Jahren viel Geld in die Modernisierung seines Stalls investiert. Er müsse nun die Restkredite, die auf dem Stall liegen, mit den Erlösen aus dem Ackerbau bedienen, so Ilse. Das sei ärgerlich, aber so verliere er weniger Geld, als wenn er weiter Schweine mästen würde, erklärt der Landwirt.“

Karsten Ilse und sein Vater kamen Anfang der 90er-Jahre nach Brandenburg, um einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb zu gründen. Ihre Schweine hielten sie bis zuletzt, wie es sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. Sie bauten das Futter für ihre Tiere selbst an und verwendeten deren Ausscheidungen als Dünger auf ihren Äckern. Ein gutes Beispiel für flächengebundene, moderne Tierhaltung. Die ASP ist für Karsten Ilse der Hauptgrund für die Aufgabe der Schweinehaltung. Er sieht aber auch andere Probleme. Seit einigen Jahren hat er das Gefühl, dass die Tierhaltung in Deutschland von bestimmten politischen Kräften nicht mehr gewollt ist und dass er und seine Berufskollegen deshalb bewusst in der Öffentlichkeit diskreditiert und mit immer neuen Auflagen belegt werden. „Dadurch büßen wir nach und nach unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber ausländischen Importen ein, die zu wesentlich geringeren Umwelt- und Sozialstandards produziert werden“, sagt Ilse.
+++ Alle News zu ASP in unserem Newsticker +++
In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr
Ilse: „Neue Richtlinie lediglich Kosmetik“
Die vergangene Woche vom Brandenburger Landwirtschaftsministerium vorgestellte Richtlinie zur Unterstützung von landwirtschaftlichen Betrieben in ASP-Gebieten sei zwar ein positives Zeichen, aber lediglich Kosmetik, so Ilse gegenüber dem LBV. Es werde kein Betrieb die Schweinehaltung allein wegen dieser Richtlinie fortführen. Es würden lediglich Mehrkosten (acht bis zehn Euro pro Schlachtschwein) und keine Mindererlöse (ca. 15 Euro pro Tier) erstattet. Außerdem sei die Fördersumme auf 20.000 Euro in drei Kalenderjahren begrenzt.

„Wenn wir die ASP-bedingten Schäden in der Brandenburger Landwirtschaft und in den betroffenen Regionen begrenzen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Seuche möglichst schnell getilgt wird“, so Landesbauernpräsident Henrik Wendorff.
„Dazu gehören, dass der Zaunbau endlich abgeschlossen wird, die Schwarzwildbestände in den Kernzonen und in den gefährdeten Gebieten zeitnah auf null reduziert werden und der ständige Seuchendruck aus Polen unterbrochen wird. Dafür brauchen wir neben dem Grenzzaun, der bereits errichtet wurde, einen zweiten Zaun mit etwas Abstand zum Ersten. Diese Zäune müssen auch später und für einen längeren Zeitraum regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Die dabei entstehende ,Weiße Zone‘ ist dann konsequent wildschweinfrei zu halten. So haben wir vielleicht die Chance, in eineinhalb Jahren den Status ASP-frei wiederzuerlangen und freien Handel zu betreiben“, so Wendorff in der Pressemitteilung seines Verbandes.
Verbraucher lehnen Kükentöten abJährlich werden in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken getötet. Diese Praxis soll ab 2022 verboten werden. Einige Initiativen verzichten bereits jetzt auf die Tötung der „Bruderhähne“. Gut so: 85 Prozent der Verbraucher lehnen das Töten männlicher Küken ab, besagt eine repräsentative Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der Verbraucherzentralen. Sie wünschen sich jedoch mehr Transparenz und eine eindeutige Kennzeichnung.
Es gibt derzeit zwei Wege, das Töten geschlüpfter männlicher Küken zu vermeiden. Erzeuger können die Bruderhähne trotz ihres geringen Fleischansatzes aufziehen und verkaufen. Oder sie bestimmen das Geschlecht bereits im Brutei und sortieren die Eier mit männlichen Embryonen aus. Im Handel gibt es zahlreiche Label, die Eier dieser beiden Produktionsweisen auf dem Karton kennzeichnen. Doch diese Label sind weder einheitlich, noch ist die Kennzeichnung gesetzlich geregelt. „Für Verbraucher und Verbraucherinnen ist nicht immer nachvollziehbar, welche Methode sich hinter dem jeweiligen Label verbirgt“, so Annett Reinke, Lebensmittelexpertin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg.
„Ohne Kükentöten“ reicht nicht
Diesen Eindruck bestätigen auch die Ergebnisse der repräsentativen GfK-Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentralen: „Der Hinweis ‚ohne Kükentöten‘ ist nicht verbraucherfreundlich“, so Reinke. „38 Prozent der Befragten akzeptieren diese Angabe nur, wenn damit die Aufzucht der männlichen Küken verbunden ist.“ 45 Prozent finden den Hinweis „ohne Kükentöten“ für beide Alternativen ausreichend. 73 Prozent der Befragten wünschen sich, dass zusätzlich zur Angabe „ohne Kükentöten“ auf der Verpackung die Methode angegeben wird, mit der der Kükentod vermieden wird, oder darüber hinaus noch eine Erläuterung des Verfahrens.
Wie schwer Verbrauchern die Zuordnung der Label zum Thema Kükentöten und Bruderhähne fällt, zeigte sich bei der Vorlage konkreter Eierverpackungen aus dem Handel: Nur zwei der Label („Huhn & Hahn“ mit entsprechenden Piktogrammen sowie „Hähnlein“ mit dem Wortlaut „Für diese Eier werden keine Küken getötet.“) konnten immerhin gut zwei Drittel der Befragten richtig einordnen. Die Bedeutung der beiden anderen Label „Bruderhahn-Patenschaft“ (Dein Landei) und „Ohne Kükentöten“ (respeggt) kannten 56 Prozent beziehungsweise 30 Prozent nicht. Knapp die Hälfte der Befragten nahm an, dass hinter „ohne Kükentöten“ eine Bruderhahnmast steckt, was nicht der Fall war.
für transparenz sorgen
Fazit: „85 Prozent der Befragten lehnen das Töten männlicher Küken ab, daher begrüßen wir alle Initiativen, die bereits jetzt auf tierfreundlichere Methoden setzen. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher besser erkennen können, was sie kaufen und sich kein Siegel-Wildwuchs entwickelt, fordern wir, dass Hersteller und Herstellerinnen Hühnereier eindeutig kennzeichnen und die eingesetzte Methode (Geschlechtsbestimmung im Brutei oder Bruderhahnaufzucht) angeben. Bei der Bruderhahnaufzucht sollten Erzeuger auch transparent machen, wo und wie die Bruderhähne aufgezogen werden“, fasst Annett Reinke zusammen.
Weitere Informationen zur Umfrage und zu den Ergebnissen sind zu finden unter:
www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/umfrage-kuekentoeten
Die Ausbildung von sechs ASP-Suchhunden durch den Landesjagdverband Brandenburg hat begonnen. Insgesamt werden zwölf weitere Männer und Frauen demnächst mit ihren Hunden unterwegs sein. Max Heereman ist einer von sieben ASP-Suchhundeführern, die seit November unterwegs sind. Mit seinem zweijährigen Jagdhund Ritschie, einem Curly Coated Retriever, ist er regelmäßig im Einsatz. Er hat aufgeschrieben, wie die Einsätze laufen und unterwegs Fotos gemacht. Ein spannender Bericht.
Bislang gibt es sieben ausgebildete ASP-Suchhunde in Brandenburg. Sie wurden im Oktober unter Federführung des Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit darauf trainiert. Im Dezember beauftragte das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbrauchschutz (MSGIV) den Landesjagdverband Brandenburg (LJVB), die Ausbildung zu übernehmen. Bereits kurz vor Weihnachten standen 20 Hundegespanne in den Startlöchern, so der LJVB. Bis das MSGIV die eingereichte Ausbildungs- und Prüfungsordnung bestätigte und die nötigen finanziellen Mittel bereitstanden, vergingen allerdings noch einmal drei Monate.
Landesjagdverband übernimmt die Ausbildung
Am Samstag (20.3.) haben zwölf Gespanne ihre Tauglichkeit bei der Arbeit am Schwarzwild unter Beweis gestellt. Gestern (23.3.) begann die erste Gruppe mit ihrer etwa einmonatigen Ausbildung. Sie unterteilt sich in mehrere praktische Ausbildungstage und ein konsequentes Selbststudium. Die Hunde verschiedenster Rassen sind mindestens zwölf Monate alt und haben ihre jagdliche Brauchbarkeitsprüfung bereits bestanden. Nun gibt es die Zusatzausbildung: Fallwild auch auf große Distanzen aufzuspüren, aber nicht berühren, damit eine Weiterverbreitung des Virus verhindert werden kann. Der Hundeführer muss einen gültigen Jagdschein haben.

Was die neuen Gespanne nach ihrer Ausbildung erwartet, ist für Max Heereman schon Routine. Er ist einer von sieben ASP-Suchhundeführern, die im Oktober in Brandenburg geschult wurden. Mit seinem zweijährigen Jagdhund Ritschie, einem Curly Coated Retriever, ist er seit November bei der Fallwildsuche im Einsatz. Er beschreibt den Einsatzalltag so:
Ein ASP-Suchhundeführer berichtet …
In der Regel fragt das Einsatzzentrum in Eisenhüttenstadt per E-Mail an, ob das Gespann in einem der betroffenen Landkreise einsatzbereit ist. Dann koordiniert die Technische Einsatzleitung ASP die Einsätze in den Landkreisen. Nach einer Zusage der Hundeführer nehmen die Landkreise Kontakt zu ihnen auf. In aller Frühe treffen sich der Mitarbeiter des Landkreises und die Suchgespanne entweder im Amt oder an einem vereinbarten Ort in der Nähe des Suchgebietes. Dort stattet man die Teams mit Informationen aus. Der folgende Treffpunkt ist dann in der Nähe des zu untersuchenden Einsatzgebietes. Dort sind dann auch die zuständigen Jäger und Mitarbeiter des Landkreises vor Ort.
Unterschiedliche Gebietskulissen
Die Gebietskulissen sind sehr unterschiedlich. Es gibt dichte Schilfgebiete, Dickungen und Seeufer bis hin zu landwirtschaftlichen Flächen mit Zwischenfrüchten, die zur Bewirtschaftung freigegeben werden sollen. Nach einer kurzen Einweisung geht es los. So verschieden wie die ASP-Suchhunde (Dackel, Schweißhunde, Stöberhunde, Schäferhunde, Vorstehhunde und mehr) ist auch ihr Anzeigen beim Fund eines Kadavers oder eines noch lebenden Wildschweins. Manche Hunde verbellen, andere zeigen den Fund an, indem sie ihren Hundeführer zum verendeten Stück hinführen.

Nur noch ein Skelett. 
Kadaver im Schilf 
Kadaver im Schnee 
Fundort im Wald 
Nicht viel übrig.
Die Suchen dauern je nach Gelände und Wetter zwischen drei und sechs Stunden. Der zeitliche Unterschied ergibt sich auch aus den sehr unterschiedlichen Geländeformen. Zum Beispiel ist der Einsatz im Schilf für das Gespann wesentlich zeitintensiver und kraftaufwendiger als die Suche auf landwirtschaftlichen Flächen. Oft kommen Hund und Hundeführer dabei an ihre Belastungsgrenzen.

In manchen Gebieten werden bis zu zehn Kadaver am Tag gefunden. Sichtbar kranke Stücke werden von Hundeführer oder vom begleitenden Jäger erlegt. Die Kadaver kennzeichnet der Suchhundeführer mit Flatterband. Der Fund und der Standort werden per WhatsApp an das zuständige Bergungsteam weitergeleitet. Der Zustand der Wildschweine am Fundort bewegt sich zwischen gerade verendet bis hin zu Knochenfunden von Tieren, die Wölfe, Füchse und Raben zerwirkten oder schon länger tot sind. Bevorzugte Fundorte sind Plätze am Wasser, Dickungen und Schilfpartien. Manchmal liegen die verendeten Sauen auch mitten im Hochwald. Nach getaner Arbeit gibt es eine Nachbesprechung. Die Hunde, Fahrzeuge und das Schuhwerk werden desinfiziert und für den nächsten Einsatz vorbereitet.

Max Heereman macht die Arbeit mit den ausgebildeten Hunden und den Teams viel Spaß. „Unsere Einsätze helfen bei der ASP-Bekämpfung und die Zusammenarbeit läuft gut“, sagt er. Jedoch mache es ihn oft auch traurig, durch die wunderbare Landschaft zu laufen und dort Kadaver und krächzende Raben vorzufinden. Gesunde Wildschweinrotten wären ihm lieber. „Mir als Jäger ist es immer wieder offensichtlich, dass dort in den nächsten Jahren keine Jagd auf Wildschweine stattfinden kann“, bedauert der Suchhundeführer.
+++ Alle News zu ASP in unserem Newsticker +++
In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr
Anfang der Woche wurde im Norden von Frankfurt (Oder) Bauzäune aufgestellt: Die Afrikanische Schweinepest (ASP) soll sich nicht weiter verbreiten. Vorangegangen waren drei neue Kadaverfunde von Wildschweinen. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) bestätigte gestern (18. 3.), dass es sich dabei um ASP handelt.
Seit dem Fund des ersten ASP-Kadavers in Frankfurt am 4. März arbeitet auch in der Oderstadt ein Krisenstab. Es wurde mit der Fallwildsuche begonnen und ein zweiter Kadaver gefunden. Bei einer Fallwildsuche am Dienstag (16. März) wurden bei einem Drohnenüberflug im Schilfgürtel des eingezäunten Kerngebietes weitere drei verendete Wildschweine entdeckt. Die Tiere wurden daraufhin geborgen und Proben ins Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) geschickt.
Bereits am Dienstag wurden im Norden Frankfurts zwischen dem Stadtgebiet und Lebus direkt an der Straße neben dem Radweg Bauzäune aufgestellt. Im Auftrag der Stadt leisteten das Technische Hilfswerk (THW) mit Einsatzleiter Stefan Schneider zusammen mit dem Bauhof ganze Arbeit. Das FLI bestätigte am Donnerstag (18. März) den ASP-Befund des Landeslabors. Eine weitere Probe, die noch als Verdachtsfall eingestuft ist, befindet sich derzeit in der Untersuchung des FLI.
Im Landkreis Oder-Spree sind außerhalb der bestehenden Kernzone Fälle der Afrikanischen Schweinepest aufgetreten, berichtet die Märkische Oderzeitung (MOZ). „Bei drei Frischlingen, die an der Schlaube zwischen Wirchensee und Kieselwitzer Mühle aufgefunden wurden, hat sich der ASP-Verdacht bestätigt“, hieß es vonseiten des Landkreises Oder-Spree. Ursache soll ein auf 500 Meter Länge beschädigter Zaun zwischen Treppeln und Kobbeln sein, der bereits im Januar repariert wurde. Die Gebietskulisse soll daher nicht neu ausgewiesen werden, berichtet die MOZ.
Die neue Fundstelle wurde zusätzlich durch einen Elektrozaun gesichert, intensive Fallwildsuche folgt. Ursache für die großflächige Zerstörung des Zauns sei vermutlich der Durchbruch einer Schweinerotte, so Amtsveterinärin Petra Senger.
+++ Alle News zu ASP in unserem Newsticker +++
In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr
In Brandenburg einigten sich zwei Volksinitiativen zum Insektenschutz auf eine Beschlussvereinbarung. Alle Insektenschutzmaßnahmen wurden gegengerechnet und sollen durch Fördermaßnahmen begleitet werden.
Mittlerweile geht Friedhelm Schmitz-Jersch das Wortgebilde „chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel“ locker von den Lippen, obwohl Pestizide viel kürzer ist, in Landwirtsohren aber Alarm auslösen. Schmitz-Jersch ist Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Brandenburg und einer der Köpfe der Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“. Mit neun Trägern und drei Dutzend Unterstützern war sie Mitte April 2019 angetreten, Unterschriften für ihre Vorstellung von Insektenschutz zu sammeln: Pestizidverbot in Schutzgebieten, zehn Meter breite Gewässerschutzstreifen und andere Maßnahmen, die den Landwirt Geld kosten und seine Handlungsfreiheit einschränken.

Fast zeitgleich formierte sich eine zweite Bürgerinitiative mit gleichem Ziel: Insektenschutz, jedoch mit etwas anderen Forderungen. „Mehr als nur ein Summen – Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren!“ war das Motto der Initiatoren: Landesbauernverband, Landesjagd-, Landesfischerei-, Waldbesitzer- und Landesanglerverband sowie dem Verband Familienbetriebe Land und Forst, die gemeinsam im Forum Natur Brandenburg zusammenarbeiten. Elf weitere Landnutzerverbände schlossen sich an. Ziele der Volksinitiative waren u. a. die Einrichtung eines Kulturlandschaftsbeirats und einer Koordinierungsstelle für Insektenforschung sowie Maßnahmen, die in einem Förderprogramm Artenvielfalt zusammengefasst werden. Insektenschutz ja, aber mit finanziellem Ausgleich für die Landwirte.
Unterschriften sammeln
Zunächst ging es für beide Volksinitiativen darum, mindestens 20.000 Unterstützer für ihr Anliegen zu gewinnen. Die Landnutzer-Initiative gab am 19. November 2019 ihre Unterschriften ab. Knapp 24.000 Unterstützer hatten sie über die Mitglieder der beteiligten Verbände gewinnen können. Die Naturschutzorganisationen zogen alle Register inklusive Infoständen, Bienenkostüm und Infotour mit gestyltem Doppelstockbus. Am Ende freute man sich über 73.000 Unterschriften, die am 13. Januar 2020 dem Landtag übergeben wurden. Bei der Anhörung vorm Agrar- und Umweltausschuss dann die Enttäuschung: Der Parlamentarische Beratungsdienst hatte einen Verstoß gegen formale Kriterien festgestellt. Wenig später verpflichteten sich beide Volksinitiativen, auf ein Volksbegehren zu verzichten.

Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid
Die Volksinitiative ist die erste Stufe der Volksgesetzgebung. Mit 20.000 Unterstützern wird sie dem Landtag zur Beratung vorgelegt. Schon das kann ein Erfolg sein, wenn das Anliegen bei den Abgeordneten Gehör findet. Kommt kein Gesetzentwurf o. Ä. zustande, kann ein Volksbegehren (80.000 Unterstützer) angestrebt werden, das größeres Gewicht hat. Entspricht der Landtag nicht binnen zwei Monaten dem zulässigen Volksbegehren, kann ein Volksentscheid angestrebt werden. Wenn mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten dem Anliegen zustimmt, muss es umgesetzt werden.
Kostenpunkt: 30 Millionen Euro zusätzlich
In einem moderierten Dialogprozess, von dem man bald als „Insektendialog“ sprach, sollten beide Parteien zusammenfinden und sich auf einen gemeinsamen Beschluss einigen. Regierungswechsel samt neuem, grünem Agrarminister und Corona-Maß-nahmen machten die Sache noch bunter, als sie eh schon war. Neben den Vertretern der beiden Volksinitiativen beteiligten sich auch die Agrarsprecher aller Landtagsfraktionen am Dialogprozess. Mit Erfolg. Am vergangenen Mittwoch unterschrieben die Vertreter der beiden Volksinitiativen im Potsdamer Landtag eine 31-seitige Beschlussvereinbarung. Und dass am Folgetag auch die Agrarsprecher der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen das Papier unterzeichneten, lässt hoffen, dass es kein Papiertiger bleibt.

„Die getroffene Vereinbarung öffnet die Tür für ein kooperatives Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz und hat damit auch für andere Bundesländer eine Signalwirkung“, kommentierte Johannes Funke, Agrarsprecher der SPD-Fraktion. Worauf man sich geeinigt hat, gliedert sich in drei Abteilungen: Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landeswassergesetzes, Entschließungsanträge des Landtages und die finanzielle Untersetzung der Maßnahmen. Um Letzteres vorwegzunehmen: Das ganze Paket wird etwa 30 Millionen Euro über die bestehende Förderung hinaus erfordern. Wofür? Gehen wir ins Detail.

Mehr als ein Summen – ein guter Anfang
Bei zwei gegründeten Initiativen für mehr Artenvielfalt und Insektenschutz in der Landwirtschaft bahnen sich Konflikte an. Die neu gefundene Eignung soll Bauern, Naturschützer und Landesregierung näher zusammenbringen. Ein Kommentar. mehr
Insektenschutz: Die wichtigsten Punkte
Angestrebte Gesetzesänderungen:
- Grünanlagen der öffentlichen Hand sollen möglichst biologische Vielfalt zeigen.
- In Naturschutzgebieten sind chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ab 2023 verboten, in FFH-Gebieten, die nicht als Naturschutzgebiete, sondern über Erhaltungszielverordnungen geschützt sind, ab 2028.
- In Naturschutz- und in FFH-Gebieten, die durch Erhaltungszielverordnungen geschützt sind, sind mineralische Stickstoffdünger ab 2028 verboten.
- Gewässerrandstreifen sind fünf Meter breit und müssen ab 2023 ganzjährig begrünt sein. Pflanzenschutz- und Düngemittel sind hier verboten.
- Die Verpachtung landeseigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen soll mit Mindestkriterien für eine ökologische oder anderweitige naturverträgliche Bewirtschaftung einhergehen.
Änderungen über Entschließungsanträge:
- Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Koordinierungsstelle Insektenschutz an einer wissenschaftlichen Einrichtung oder beim Landesamt für Umwelt anzusiedeln. Außerdem sollen mindestens zehn landwirtschaftliche Betriebe in verschiedenen Naturräumen als Referenzbetriebe für Insektenschutzmaßnahmen in der Agrarlandschaft fungieren.
- Die bestehende Förderung von Blüh-, Grün- und Ackerrandstreifen soll auf mehrjährige Streifen und auf weitere Strukturelemente wie Hecken sowie Blühflächen ausgerichtet werden.
- Weidetierprämie zur Unterstützung der Weidetierhaltung und damit der Anzahl und Artenvielfalt von Insekten. Voraussetzung für die Gewährung einer Weideprämie ist u. a. die Anwendung eines geeigneten Herden- und Parasitenmanagementsystems mit dem Ziel, prophylaktische Medikationen zu vermeiden.

- Die Landesregierung wird aufgefordert, bis 2022 dem Landtag eine Strategie zur deutlichen Reduzierung des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln vorzulegen. Die Strategie ist regelmäßig fortzuschreiben, dem Landtag ist alle zwei Jahre ein Fortschrittsbericht vorzulegen.
- Europäische Fördermittel, die aus der Ersten in die Zweite Säule umgeschichtet werden, sollen für die Honorierung von agrarsozialen und agrarökologischen Leistungen wie Umwelt- und Klimamaßnahmen, Tierwohl, den ökologischen Landbau und die betriebsintegrierte Beratung verwendet werden. Inhaltlich ist die Förderung von Agrar- und Umweltmaßnahmen im Grünland vorrangig auf qualitativ hochwertige Maßnahmen auszurichten und soll erfolgsorientierter angelegt werden. Die Förderung von Agrar- und Umweltmaßnahmen auf Ackerflächen ist vorrangig auf selbstbegrünende Brachflächen, die Anlage und Pflege von mehrjährigen Blühstreifen und Blühflächen, Ackerrandstreifen sowie die Schaffung dauerhafter Strukturelemente wie Feldgehölze, Hecken, Säume, Baumreihen und den Erhalt von Kleingewässern auszurichten.
- Die Landesregierung wird aufgefordert, den ökologischen Landbau in Brandenburg mit dem Ziel zu fördern und zu unterstützen, bis 2030 einen Anteil des Ökolandbaus an der landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens 20 Prozent zu erreichen. Dazu soll ein Aktionsplan Ökolandbau aufgelegt werden, um die Vermarktungsmöglichkeiten für ökologisch angebaute Produkte zu verbessern und Wertschöpfung zu sichern.
- Förderung für betriebsintegrierte Beratung: Über eine Förderrichtlinie soll eine flächendeckende Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen insbesondere zur Verbesserung der Ressourceneffizienz, des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes ermöglicht werden.
- Flächenverbrauch reduzieren: Maßnahmenpaket zur spürbaren Verringerung des Flächenverbrauchs und der Flächenzerschneidung entwickeln.
- Kommunen sollen bei der Erarbeitung insektenfreundlicher Beleuchtungskonzepte fachlich unterstützt werden.
Im Interview mit Landesbauernpräsident Henrik Wendorff erfahren Sie, wie zäh um manches Detail gerungen wurde, bis man sich einig wurde. Zu lesen in der Druckausgabe der Bauernzeitung 11/2021 oder im E-Paper.
Agrarausschuss am Mittwoch im Livestream
Am Mittwoch (10. 3.) findet ab 13.30 Uhr die 20. Sitzung des Agrar- und Umweltausschusses statt. Die Videokonferenz wird per Livestream übertragen. 14 Punkte sollen besprochen werden. Die Themenpalette ist breit gefächert, sodass für manchen landwirtschaftlich Interessierten etwas dabei sein dürfte.
Die Sitzung beginnt mit einem Fachgespräch zum Thema „Bioökonomie in Brandenburg – Wege hin zu einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und biobasierten Wirtschaftsweise“. Eingeladen wurden zwei Experten: Prof. Dr.-Ing. Daniela Thrän, Vorsitzende des Bioökonomierates und Systemwissenschaftlerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und am Deutschen Biomasseforschungszentrum GmbH (DBFZ) und Prof. Dr. agr. Iris Lewandowski, Vorsitzende des Bioökonomierates und Expertin für nachwachsende Rohstoffe in der Bioökonomie an der Fakultät Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim. Sie werden die Fragen aus den Fraktionen beantworten. Die Linke stellt in Verbindung damit den Antrag, die Biomassestrategie für Brandenburg fortzuschreiben.
Weitere Themen sind unter anderem:
- der Stand der Ansiedlung von Tesla am Standort
- die aktuelle Situation der Afrikanischen Schweinepest
- die aktuelle Situation der Geflügelgrippe
- die Vorstellung des Niedrigwasserkonzepts für Brandenburg
- Möglichkeiten des Einsatzes von Saisonarbeitskräften in Land- und Forstwirtschaft
- der Hochwasserschutz an der Oder und der Zustand der Deiche
- Auswirkungen der Werksschließung der Zuckerfabrik in Brottewitz auf die Bauern mit Rübenanbau in Brandenburg
- Tierkörperbeseitigung im Land Brandenburg
- Mittelabfluss bei der GAK-Förderrichtlinie zur Bewältigung von Schäden durch Extremwetterereignisse im Wald
- Stand der Umsetzung des Leitbildes Siedlungswasserwirtschaft
- das weitere Vorgehen beim Insektenschutzprogramm
- der Umgang mit der Klage der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Nicht-Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen der FFH-Richtlinie
Den Livestream finden Sie unter:
20. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz – Landtag Brandenburg
Am Mittwoch wurden in der Neuzeller Niederung im ASP-Kerngebiet knapp vier Hektar Schilfgürtel kontrolliert abgebrannt. Wildschweinen soll die Rückzugsmöglichkeit genommen werden. Eine Mahd wäre nicht nur aus Gründen des Emissionsschutzes besser gewesen, mahnt der Landesjagdverband an. Alles nur eine Frage der Kosten?
Die Aufregung am Mittwoch ist groß. Ein Schilfgürtel steht in Flammen, Rauch steigt zum Himmel, übrig bleibt eine verkohlte Fläche. Die Fläche gehört dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu), der mit der Aktion einverstanden ist. Sie soll der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) dienen, indem Wildschweinen die Rückzugsmöglichkeiten genommen wird. Im ASP-Kerngebiet, das nach dem ersten ASP-Fund Anfang September 2020 ausgewiesen wurde, wurden seitdem über 300 positiv auf ASP beprobte Wildschweinkadaver gefunden und geborgen. Die gesamte Fläche umfasst etwa 150 km², grenzt im Osten direkt an die Oder und beinhaltet neben dem Dorchetal auch die Neuzeller Niederung. Diese beiden Gebiete sind besonders von dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest betroffen. Bereits am 24. Februar hatte der Landkreis die Maßnahme angekündigt.
Der örtliche Jagdverband Eisenhüttenstadt habe der Maßnahme bereits bei Beginn der Planung skeptisch gegenübergestanden, heißt es vonseiten des Landesjagdverbandes Brandenburg e. V.. Im weiteren Planungsverlauf seien Landwirte, Naturschutzverbände und der regionale Jagdverband zur Lösungsfindung mit eingebunden worden. „Besonders der geplante Zeitansatz war im Hinblick auf die anstehende Brut- und Setzzeit als kritisch einzuschätzen“, so der LJV. Die aufgeführten Bedenken seitens der örtlichen Jägerschaft hätten dazu geführt, dass die Ausmaße der zum Abbrennen vorgesehenen Flächen um 90 Prozent reduziert wurden. Das Ergebnis zeige die Kooperationsbereitschaft der zuständigen Behörden mit den Partnern vor Ort.
++ ASP-Newsticker ++
In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr
Verjüngung der Schilfflächen erwünscht
Die jetzige Versuchsfläche ist Eigentum des Naturschutzbund Deutschland (NABU), der das Abbrennen des Altschilfes befürwortet. Der Landkreis Oder-Spree erläutert: „Die Maßnahme wurde bereits im Vorfeld mit der staatlichen Vogelschutzwarte Nennhausen, mit den anerkannten Naturschutzverbänden, dem Naturschutzbeirat des Landkreises sowie der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Auch aus ornithologischer Sicht wird eine Entbuschung und Verjüngung der Schilfflächen für einen langfristigen Erhalt des Schilfbestandes und somit der Erhalt von Nistgebieten der schilfbrütenden Vogelarten (unter anderem Wiesenbrüter) begrüßt.“
Weiter heißt es: „In der Neuzeller Niederung, die Teil des europäischen Vogelschutzgebietes (SPA) Mittlere Oder ist, arbeitet seit einigen Jahren eine Gruppe ehrenamtlichen Ornithologen mit der unteren Naturschutzbehörde und der bewirtschaftenden Agrargenossenschaft aktiv in einem Projekt zum Wiesenbrüterschutz zusammen. Hierbei wird das Brutgeschehen systematisch beobachtet und dokumentiert. Zunehmend musste in den vergangenen Jahren festgestellt werden, dass der hohe Schwarzwildbestand eine ernstzunehmende Gefahr für die Bruterfolge der Wiesenbrüter darstellte. Um die bekannten Brutflächen zu schützen, wurde im Jahr 2020 damit begonnen, diese elektrisch einzuzäunen und die Wildschweine somit von den Gelegen der am Boden brütenden Wiesenbrüter fernzuhalten. Durch die Entbuschung der Schilfbestände werden die Habitatbedingungen für viele schilfbrütende Vogelarten aufgewertet, sodass eine Verbesserung der Brut- und Lebensräume im Vogelschutzgebiet erreicht wird.“

ASP: Abbrennen nicht mit Emissionsschutz vereinbar
Beim Nabu gebe es Überlegungen, die mittels Brand verjüngten Schilfbestände zukünftig in einem Rhythmus von drei bis fünf Jahren mosaikartig während der Zeit von gefrierendem Boden zu verjüngen. Damit würden die Schilfbestände langfristig so beschaffen sein, dass sie sich in unterschiedlichen Aufwuchsstadien befinden und die besten Voraussetzungen für die Artenvielfalt bieten.
Der Landesjagdverband macht darauf aufmerksam, dass das Abbrennen mit Emissionsschutz nicht vereinbar ist. „In Zukunft sollte auf die zwar kostenintensivere, aber umweltschonende Mahd zurückgegriffen werden“, sagt Mario Schüler vom Jagdverband Region Eisenhüttenstadt. Die betroffenen Jäger begrüßen die Anlage von Bejagungsschneisen, die von der Jägerschaft als deutlich zielführender bewertet wird.
Wölfe sollen in Polen Waldarbeiter angegriffen habenWölfe sollen in einem Wald bei Brzozów im Südosten Polens, rund 60 km von der Grenze zur Ukraine, Waldarbeiter angegriffen haben. Der Bürgermeister hat den Abschuss erbeten.
Die Männer hätten sich mehrere Minuten lang mit Kettensägen gegen die aggressiven Tiere wehren müssen, berichtete die polnische Presseagentur (PAP) am Dienstag (2. 3.). PAP beruft sich auf einen Mitarbeiter der Bezirksstaatsanwaltschaft. Marcin Bobola habe mit einem der angegriffenen Männer gesprochen. Dieser habe ausgesagt, dass ihn zwei Wölfe von vorne, ein dritter von hinten angegriffen hätte. Sein Freund sei ihm zu Hilfe geeilt, die Männer warfen ihre Kettensägen an und verscheuchten die Wölfe. Sie hätten die ganze Zeit geknurrt, die Situation sei wirklich gefährlich gewesen. Am Ende kamen die Waldarbeiter mit dem Schrecken davon. Die Regionaldirektion des polnischen Landesforstes in Krosno habe den Vorfall bestätigt, so PAP.
„Ungewöhnlich und beispiellos“ oder „übertrieben“?
Bobola bezeichnete PAP zufolge den Wolfsangriff auf Menschen ungewöhnlich und beispiellos. Die örtliche Polizei werde den Fall weiter untersuchen, unter anderem die Frage, ob es wirklich Wölfe gewesen seine. Es gebe Hinweise aus der Bevölkerung, dass das Wolfsrudel von Brzozów keine Angst vor Menschen habe. „Es muss etwas getan werden, bevor es warm wird und mehr Leute in die Wälder gehen“, sagt Bobola gegenüber der polnischen Presseagentur.
Die Retourkutsche kam umgehend: Er habe seine Kompetenzen überschritten, den Medien unrechtmäßig Informationen gegeben. Zudem hätten Internetnutzer herausgefunden, dass er selbst ein Jäger ist, schreibt wiadomosci.onet.pl gestern. Der Fall des „Angriffs der Wölfe in Brzozów“ habe sehr schnell großes Interesse in den Medien gefunden. Viele Menschen würden aber glauben, das Wort „Angriff“ sei übertrieben, heißt es auf der Plattform, die zum Springer-Konzern gehört. Hier kommt auch Dr. Sabina Nowak zu Wort. Sie ist Präsidentin des polnischen Vereins „Wolf für Natur“ und bezeichnet die Vorstellung, dass Wölfe in Polen bald Menschen töten werden, als unbegründet. Im Europa der Nachkriegszeit habe es keine Fälle von menschlichen Todesfällen durch Wölfe gegeben, sagte sie gegenüber wiadomosci.onet.pl.
Entscheidung fällt in Warschau
Soll anders als mit Kettensägen gegen die mutmaßlich menschengefährdenden Wölfe vorgegangen werden, müsse das laut PAP bei der zentralen Umweltbehörde in Warschau beantragt werden. Das hat der Bürgermeister von Brzozów Simon Stapinski heute (04.03.2021) getan. Er habe die Generaldirektion Umweltschutz in Warschau um Erlaubnis gebeten, Wölfe zu erschießen, schreibt er in einem Brief an die Bürger der Gemeinde und bittet sie, vorsichtig zu sein. Hunde sollen nachts weggesperrt und im Wald angeleint werden.
ASP: Leitfaden für Landwirte in Restriktionszonen
Landwirte, die von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) betroffen sind, sehen der Frühjahrsbestellung mit Sorge entgegen. Heute veröffentlichte das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) in Potsdam einen Leitfaden für das Wirtschaften in ASP-Restriktionszonen. Der Landesbauernverband bezweifelt, dass er die gewünschte Klarheit bringt.
Wer sucht, der findet. Das gilt auch für Wildschweine, die an oder mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verendet sind. Insgesamt wurden in Brandenburg 668 Fälle amtlich bestätigt. Mit Stand vom 19. Februar sind es in Spree-Neiße 50, Oder-Spree 406, Märkisch-Oderland 211 und in Dahme-Spreewald einer. Insgesamt sind in Brandenburg 1.650 km² Fläche als gefährdete Gebiete ausgewiesen. Landwirte, die hier wirtschaften, mussten bereits im September nach Ausbruch der ASP viele Einschränkungen hinnehmen. Jetzt sollen die, die innerhalb der eingezäunten weißen Zonen agieren, sich an einen Leitfaden halten. Sie sollen möglichst wenig Mais anbauen und möglichst viele Bejagungsschneisen anlegen.
Ziel: Seuchenbekämpfung bei landwirtschaftlicher Nutzung
Dem MLUK zufolge gilt der Leitfaden für Flächen, die in fest abgegrenzten (eingezäunten) Kernzonen und weißen Zonen der ASP-Restriktionszonen liegen. Ziel der Anbauregeln sei es, die Seuchenbekämpfung ohne große Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung vornehmen zu können. Dies gelinge nur im Miteinander von Landwirten, Grundstückseigentümern und Jägern.
„Vorzugsweise sind durch die Unternehmen die Ökologischen Vorrangflächen wie beispielsweise Brachen in die weißen Zonen zu legen“, so die Verfasser. Der Maisanbau solle möglichst auf Flächen außerhalb der Kernzone verlagert und dafür innerhalb der Kernzone Sommergetreide oder Körnerleguminosen bzw. niedrig wachsende Kulturen angebaut werden. Gegebenenfalls könne auf den Anbau von Sorghumhirse zur Biogasnutzung ausgewichen werden. „Darüber hinaus sollte für die Rohstoffversorgung von Biogasanlagen auf alternative Substrate wie Gülle, Festmist, gegebenenfalls Grünlandaufwuchs, zurückgegriffen werden.“ Getreide (Wintergetreide) könne in begrenztem Maße Mais ergänzen bzw. ersetzen.
Bejagungsschneisen ab zehn Hektar Fläche
In Mais, Sonnenblume, Sorghumhirse, Sudangras und Winterraps sollen ab einer Größe von zehn Hektar Bejagungsschneisen angelegt werden, um Jägern das Handwerk zu erleichtern. „Soweit Flächen bereits im Vorjahr bestellt wurden, sind die Jagdschneisen in Abstimmung mit dem zuständigen Jagdausübungsberechtigten in den wachsenden Bestand einzubringen. Alternativ kann durch eine blockweise Ernte die zielgerichtete Bejagung gewährleistet werden.“ Geerntet werden soll bei Tageslicht. Außerdem sind Landwirte angehalten, das natürliche Wechselverhalten der Wildschweine hinsichtlich der Erntezeitpunkte der Kulturen und der bevorzugten Einstände berücksichtigen. Dazu sollen sie sich mit den Jagdausübungsberechtigten abstimmen.
Die Studie des Bundeslandwirtschaftsministeriums „Schwarzwildbewirtschaftung in der Agrarlandschaft“ hat sich 2012 mit der optimalen Bejagungsschneise beschäftigt. Demnach solle sie folgendermaßen beschaffen sein:
- Anlage bei der Einsaat durch Auslassen von Saatlegung,
- Duldung von auflaufender Begrünung der Schneise,
- Abstand mindestens 30 m, höchstens 50 m vom Rand der Kultur,
- vorzugsweise Anlage 90 Grad zur Saatreihe,
- Breite 15 bis 25 m,
- Schneise nach vier Seiten durch Kultur begrenzt,
- Anbindung der Schneisen an Hauptwechsel und vom Schwarzwild bevorzugte Strukturen.
Rundum schneisen für die Erntejagd
Zusätzlich zu den Bejagungsschneisen sei um den Schlag eine umlaufende Schneise von mindestens 20 m Breite freizuhalten, heißt es im Leitfaden. „Diese dient neben der Erlegung von Schwarzwild der Errichtung mobiler Anlagen (z. B. Zäune während einer Erntejagd) zur Unterstützung der Entnahme von Schwarzwild.“ Schneisen sollen zudem vom Einstand des Schwarzwilds (z. B. Wald, Schilf) zum Feld und zu Bachläufen und Gewässern angelegt werden. Auch zur Sicherung der Agrarförderung gibt das MLUK in seinem Leitfaden ausführliche Hinweise.
LBV Gegen pauschales Schneisenschlagen
Landesbauernpräsident Henrik Wendorff kritisierte gegenüber der Bauernzeitung zum einen die unklaren Begriffe: „Was denn nun: Leitfaden oder Anbauregelung?“, fragt er: „Soll dieses Papier der Seuchenbekämpfung dienen oder will es beschreiben, wie man Wildschweine bekämpft?“ Zum anderen seien Empfehlungen kontraproduktiv, die dazu führen, dass betroffene Landwirte landwirtschaftliche Flächen ohne Schadensausgleich ungenutzt lassen sollen, so Wendorff. In Märkisch-Oderland sehe die derzeitige Allgemeinverfügung keine Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung vor. Man habe die Frostphase für die Wildfeststellung genutzt und gehe davon aus, dass von den derzeit rund 100 Wildschweinen im April nur noch Einzeltiere in den gefährdeten Gebieten unterwegs sind. Wenn dann im Einzelfall Bejagungsschneisen nötig seien, müsse das abgestimmt werden. Ein pauschales Schneisenschlagen lehnt der Landesbauernpräsident ab. (mil)
Alles Gute: Landesbauernverband Brandenburg wird 30Am 22. Februar 1991, also auf den Tag genau vor 30 Jahren, schlossen sich in Kyritz der Bauernverband und der Genossenschaftsverband der LPG zum Landesbauernverband Brandenburg e. V. (LBV) zusammen. Im Gespräch mit dem ersten Präsidenten des LBV Heinz-Dieter Nieschke erfuhren wir brisante Details.
Das Gespräch führte Wolfgang Herklotz
Am 22. Februar 1991, also vor genau 30 Jahren, wurde in Kyritz der Landesbauernverband Brandenburg gegründet. Welche Erinnerung haben Sie an diesen Tag?
Zunächst eine wenig erfreuliche. Ich war auf dem Weg nach Kyritz, landete dann auf dem Berliner Ring im Stau. Ein Lastkraftwagen war in Brand geraten, was eine Vollsperrung zur Folge hatte. Als ich endlich am Versammlungsort ankam, war meine Rede bereits verlesen. Ich konnte mich nur entschuldigen und dachte mir: Das fängt ja gut an!
Sie wurden dann aber dennoch zum Präsidenten gewählt. Wie kam es?
Ich hatte mich zur Diskussion gemeldet und meine Argumente für das Zusammengehen von Genossenschaftsverband und Bauernverband noch mal frei vorgetragen. Das fand offensichtlich Zuspruch.
Wie war Ihnen bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses zumute? Konnten Sie sich freuen oder gab es doch erste Bedenken angesichts der immensen Aufgaben, die anstanden?
Ich hatte mich damit bereits sehr ausgiebig beschäftigt, ehe ich mich für die Kandidatur entschied. Dass dann das Ergebnis so ausfiel …. Ich habe mich gefreut, keine Frage.
Wenn Sie an Ihre aktive Zeit als Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes zurückdenken: Was war Ihnen damals besonders wichtig?
Mir ging es darum, die richtigen Mitstreiter zu finden. Es gab zwar reichlich kompetente Landwirte, oft an der Spitze von landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaften. Aber viele hatten genug damit zu tun, ihren Betrieb über die Nachwende-Wirren zu bringen. Sich obendrein noch für einen Verband zu engagieren war damals nicht selbstverständlich. Es gab also viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Mein wichtigstes Argument war: Wir müssen die LPG-Zeit mit Anstand zu einem guten Ende bringen und etwas Neues aufbauen. Wir haben dazu gute Voraussetzungen, aber eines muss klar sein: Das Eigentum ist das A und O!
Zu dieser Zeit war das nicht so selbstverständlich.
Unsere Genossenschaften bewirtschafteten zwar große Flächen, die jedoch von den Mitgliedern eingebracht worden waren, oftmals unter Zwang. Nun sollten die Eigentümer wieder frei darüber entscheiden dürfen. Es war ihr gutes Recht, die Flächen und den eingebrachten Bestand an Tieren, Technik und Gebäuden zurückzubekommen. Das alles musste sauber geklärt werden, das LPG-Anpassungsgesetz gab den Rahmen dafür.

(c) Archiv Bauernzeitung 
(c) Holger Brantsch
Die Umwandlung sorgte noch jahrelang für Diskussion, ja harte Auseinandersetzungen. Gab es Momente, wo Sie sich wünschten, weniger Verantwortung zu haben?
Nein, obwohl die Schlagzeilen mancher Medien für böses Blut sorgten. Immer wieder war von „roten Baronen“ die Rede war, die Landeinbringer über den Tisch gezogen hätten. Zweifellos gab es Probleme bei der Vermögensauseinandersetzung, aber solche Pauschalverurteilungen gingen an der Realität vorbei. Wir mussten uns als Verband dieser Diskussion offensiv stellen, die nicht einfach war. Aber es gelang uns immer besser, weil wir mittlerweile viele Mitstreiter im Verband und auch Verbündete hatten. Unser gemeinsames Ziel war es, die ostdeutschen Strukturen zu erhalten und wettbewerbsfähig zu machen.
Was aber auch heute noch immer umstritten ist.
Für uns war nach der Wende endlich die Gelegenheit, andere Länder westlich der Elbe zu bereisen und uns mit den Berufskollegen auszutauschen. Ich vergesse nie meine Reise nach England, wo mir ein Landwirt seine Höchstertragskonzeption erklärte. Als Insulaner habe er keine Chance, als jeden Quadratmeter Boden intensiv zu nutzen, meinte er. Und gab zu, dass er die ostdeutschen Betriebe schon beneide. „Ihr habt aufgrund der großen Flächen bessere Voraussetzungen, deshalb glaubt denen nicht, die euch kleinbäuerliche Strukturen schmackhaft machen wollen!“
Immerhin, die ostdeutsche Landwirtschaft hat sich mit ihrer Vielfalt an Betriebsformen und -größen in all den Jahren behaupten können …
… zweifellos auch ein gehöriges Verdienst berufsständischer Interessenvertretung.
Leider ist die Anzahl der Beschäftigten seit der Wende immens zurückgegangen. Die Zahl der Betriebe blieb zwar annähernd stabil, doch angesichts der katastrophalen Preise für Milch und Fleisch steigen immer mehr aus der Tierhaltung aus.
Das ist ein Dilemma, da kann man nicht drumherum reden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das mit Mechanismen der Marktwirtschaft zu tun hat. Überangebot drückt die Preise, da werden auch Hilferufe an die Politik kaum was bewirken. Aber diese hat eine Verantwortung dafür, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu sichern, dass die Landwirtschaft und damit der ländliche Raum erhalten bleibt. Und darauf muss der Bauernverband sehr genau achten.
Was wünschen Sie dem Landesbauernverband für die nächsten Jahre?
Dass er weiterhin eine lebendige, streitbare Interessenvertretung bleibt. Und auf den engen Schulterschluss mit den anderen Landesbauernverbänden und dem Deutschen Bauernverband achtet. Denn Einigkeit macht stark! Eine Binsenweisheit, aber aktueller denn je!
Das vollständige Interview können Sie auf den Brandenburgseiten in der nächsten Ausgabe der Bauernzeitung lesen. Das beste Geschenk hat sich der Landesbauernverband übrigens selbst gemacht: eine neue Webseite. Herzlichen Glückwunsch!

















