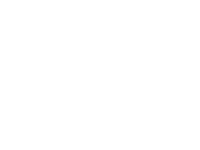Der Ausbau der Nutzung von Windenergie soll in Brandenburg nur außerhalb eines Radius von 1.000 Metern zur Wohnbebauung erfolgen. Das beschloss die rot-schwarz-grüne Koalition gestern in Potsdam.
Den Entwurf zum Windenergieanlagenabstandsgesetz hatte Infrastrukturminister Guido Beermann gestern vorgelegt, das Kabinett stimmte zu. Die Landesregierung nehme die Sorgen der Brandenburgerinnen und Brandenburger vor einer landschaftsverändernden Zunahme von Windrädern ernst, hieß es vonseiten der Regierung. Nun muss noch das Landesparlament zustimmen.
Landesflächen nutzbar machen
Der Ausbau erneuerbarer Energien könne nur gelingen, wenn in Brandenburg ein hinreichendes Angebot an geeigneten Flächen für Windenergieanlagen und für PV Anlagen zur Verfügung steht, ist sich die Regierung einig. Daher müsse es zunächst vor allem darum gehen, die zur Sicherung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbaus von 10,5 GW für die Windenergie erforderlichen Landesflächen tatsächlich nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang werde auch geprüft, welche Optimierungsmöglichkeiten für die Verfahren der Regionalplanung z. B. durch Einführung zusätzlicher Planungsinstrumente bestehen.
Akzeptanz für den Windkraftausbau stärken
„Wind und Wohnen – für diese beiden bedeutsamen Themen gilt es, in Brandenburg einen Ausgleich und einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen. Mit dem Gesetzentwurf zu den Abstandsregelungen für Windkraftanlagen nehmen wir die berechtigten Interessen der Wohnbevölkerung auf und schaffen gleichzeitig Planungssicherheit beim Ausbau der Windkraft in unserem Land. Mit einem Schutzabstand von 1.000 Metern zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen mit Wohnnutzungen wollen wir den Rahmen der Bundesgesetzgebung für die Brandenburgerinnen und Brandenburger nutzen. Die Mindestabstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung trägt dazu bei, Akzeptanz für den Windkraftausbau im Land zu stärken. Das ist ein wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen Energieversorgung in Deutschland“, so Bauminister Beermann.
Für die Zeit nach 2030 werden vor dem Hintergrund des klimapolitisch notwendigen verstärkten Ausbaus der Erneuerbaren Energien und in Übereinstimmung mit den in der Energiestrategie 2040 festzulegenden Ausbauzielen weitere Maßnahmen zu ergreifen sein. mil
Mehr zum Thema Windenergie

Windenergie: Faire Pacht als Ziel
Sobald auch nur die leiseste Chance besteht, dass ein neues Windenergiegebiet ausgewiesen wird, schwärmen die Projektplaner aus und wollen sich die Flächen sichern. Die Eigentümer bekommen dann Verträge vorgelegt, die verlockende Einnahmen versprechen. Doch Papier ist geduldig und die Materie kompliziert. mehr

Windkraftanlagen nur zu einem Fünftel ausgelastet
Mit mehr als 2.800 Windkraftanlagen liegt Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich auf Platz fünf. Diese erzeugen im Jahresverlauf aber nur 19 % der maximal möglichen Strommenge. mehr
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Auf dem Meistertag traf sich Brandenburgs grüne Elite 2021Am vergangenen Freitag wurde in Brandenburg nach einem Jahr Coronapause wieder der traditionelle Meistertag zelebriert. Absolventen der Grünen Berufe erhielten ihre Meisterbriefe, die besten Azubis wurden ausgezeichnet.
Er habe das Glück, von seinem Platz aus das Gros der Elite der Grünen Berufe vor sich zu haben, so Dr. Gernot Bilke. Der Leiter des Referats Berufliche Bildung im Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) sprach zum Auftakt des Brandenburger Meistertages.
Vom Pult aus hatte er am vergangenen Freitagnachmittag den Saal voller junger Leute in der Heimvolkshochschule am Seddiner See gut im Blick. Erst recht glücklich waren die, an die er seine Worte richtete. Im Laufe des Nachmittags wurden sie nach und nach nach vorn gerufen, um die Lorbeeren für Schufterei und Fleiß in den vergangenen Jahren in Empfang zu nehmen. Und glücklich auch die Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Oberstufenzentren, Landwirtschaftsschulen und Prüfungskommissionen, die ihre Schützlinge begleiteten.
Die Jahrgangsbesten unter den Auszubildenden
Zuerst durften die Jahrgangsbesten unter den Jungfacharbeitern staatliche Urkunden und Präsente der Berufsverbände in Empfang nehmen. Neben den besten Land- und Tierwirten sowie den Fachkräften Agrarservice, deren Bilder es in die gedruckte Ausgabe der Bauernzeitung geschafft haben, wurden auch die besten Gärtner, Forst- und Pferdewirte, Milchtechnologen und -laboranten bedacht. Jede Menge strahlende Gesichter, geschüttelte Hände, wertschätzende Worte und Applaus erwarteten sie.



Für gute Stimmung sorgte nicht nur Robby Schulze mit seinen Songs zur Westerngitarre. Auch die Reden der Vertreter von Verbänden und Schulen waren kurz, präzise und gut platziert. Heiko Terno, Vizepräsident des Landesbauernverbandes, nutzte seine Rede, um zur Teilnahme an der Demonstration am Donnerstag (18. 11.) in Potsdam aufzurufen. „Wir brauchen die Freiheit, selbst zu entscheiden“, begründete Terno den Aufruf. Vieles vonseiten der Politik sei fachlich nicht mehr nachzuvollziehen.
Brandenburg aktuell
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr
Ein Tag, es mal richtig krachen lassen
Frank Wasem, der als bester Landwirtschaftsmeister zu seinen Mitstreitern sprach, plädierte dafür, die Probleme für diesen Tag beiseitezuschieben und es „mal richtig krachen zu lassen“. Und so geschah es. Insgesamt nahmen 25 Landwirte, zehn Förster, sechs Pferdewirte und zwei Gärtner ihre Meisterurkunden in Empfang.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Zweiter Fall von Geflügelpest bei privater Geflügelhaltung in Spree-Neiße bestätigtIm Landkreis Spree-Neiße wurde erneut der Geflügelpesterreger H5N1 (Geflügelpest, Vogelgrippe) in einem Nutzgeflügelbestand nachgewiesen.
In der Kleinsthaltung mit rund 80 Hühnern und Enten waren erhebliche Tierverluste aufgetreten. Der Bestand liegt unweit der Geflügelhaltung, in der bereits am Sonntag (31.10.) der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt wurde. Zunächst hatte das Landeslabor Berlin-Brandenburg das Aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat gestern (3.11.) den Verdacht bestätigt.
Die bereits bestehende Schutzzone im Radius von drei Kilometern und die Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern um die Ausbruchsbestände wurden entsprechend erweitert. Unter anderem gilt in beiden Zonen eine Aufstallungspflicht für mindestens dreißig Tage. Die genauen Grenzen der Restriktionsgebiete wurden durch das zuständige Veterinäramt des Landkreises Spree-Neiße per Allgemeinverfügung festgelegt. Die betroffenen Geflügelhalter werden durch den Landkreis über die erforderlichen Maßnahmen in diesen Gebieten informiert.
erster fall in nutzgeflügelhaltung am sonntag
Bereits am Sonntag (31.10.) wurde der Erreger der Geflügelpest H5N1 in einem Nutzgeflügelbestand im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße nachgewiesen. Die Infektion in einer Haltung mit knapp 200 Enten, Gänsen und Hühnern wurde vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) labordiagnostisch bestätigt. Zuvor waren in dem Bestand in wenigen Tagen mehrere Tiere verendet. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg untersuchte die Tiere. Die Infektion mit dem Erreger des Typs H5N1 konnte dabei nachgewiesen werden, teilt der Landkreis mit. Bereits am Sonntag waren alle Tiere des Geflügelbestandes getötet und unschädlich beseitigt worden.
was passiert, wenn die geflügelpest ausbricht?
Bricht die Geflügelpest aus, wird eine Sperrzone eingerichtet. Sie besteht aus einer Schutzzone von drei Kilometern Radius und einer Überwachungszone von insgesamt mindestens zehn Kilometern Radius um den Ausbruchsbetrieb. Die genauen Grenzen der Restriktionsgebiete werden durch das zuständige Veterinäramt festgelegt. Die betroffenen Geflügelhalter werden durch den Landkreis über die erforderlichen Maßnahmen in diesen Gebieten informiert.
Die in dieser Sperrzone gehaltenen Vögel müssen aufgestallt werden und Kontrollen durch die zuständige Behörde sind von jedem betroffenen Geflügelhalter zu dulden. Tiere, die sich sonst in einem Grünauslauf unter freiem Himmel bewegen, müssen so aufgestallt werden, dass sie keinen Kontakt zu Wildtieren haben. Hierfür können überdachte Ausläufe oder Voliere mit Einzäunungen zum Einsatz kommen. Wichtig ist, dass kein Vogel durch den Zaun passt und der Stall zuverlässig vor Kot von Wildvögeln geschützt ist. Die Vorschriften sind rechtsbindend.
Geflügelhalter müssen bestände anmelden
Im Falle von vermehrten Erkrankungen im Geflügelbestand oder Auftreten von erhöhten Tierverlusten ist unverzüglich der Amtstierarzt hinzuzuziehen. Das Ministerium weist erneut auf die Pflicht aller Geflügelhalter zur Anmeldung ihrer Geflügelbestände bei dem zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hin, sofern dies noch nicht erfolgt ist.
Brandenburg aktuell
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr
Verbraucherschutzministerin Nonnemacher besorgt
„Dass die Seuche so früh im Herbst auftritt und zudem Nutzgeflügel betroffen ist, noch bevor das Virus bei Wildvögeln in Brandenburg nachgewiesen werden konnte, bereitet mir große Sorgen“, so Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Die Ursache für die Infektionen in Spree-Neiße sind derzeit noch unklar. Die notwendigen Ermittlungen sind eingeleitet.
Das Veterinäramt des Landkreises Spree-Neiße wird dabei vom Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes unterstützt. „Ich appelliere eindringlich an alle Geflügelhalter im Land: Halten Sie die Biosicherheitsmaßnahmen ein und vermeiden Sie Kontakt zwischen Wildvögeln und dem gehaltenen Geflügel“, so Nonnemacher. red
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Schäfer Knut Kucznik mit Landes-Naturschutzpreis ausgezeichnetBrandenburgs Umweltminister Axel Vogel hat heute Schäfermeister Knut Kucznik aus Altlandsberg mit dem Naturschutzpreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet.
Schäfermeister Knut Kucznik aus Altlandsberg wurde heute mit dem Naturschutzpreis des Landes Brandenburg geehrt. Knut Kucznik setze sich als Weidetierhalter in beispielhafter Weise für die Natur und für den Artenschutz im Raum Altlandsberg ein, fasst das Ministerium zusammen.
„Knut Kucznik denkt Bewirtschaftung und Naturschutz zusammen. Sein besonderer Verdienst besteht darin, dass er Beweidungskonzepte ausdrücklich zum Schutz von Lebensräumen und Arten entwickelt“, lobt Agrar- und Umweltminister Axel Vogel den Schäfermeister. „Die von ihm bewirtschafteten Flächen zählen heute zu den wertvollsten in Brandenburg.
Knut Kucznik ist zudem ein Brückenbauer zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Mit seinem Einsatz für den Herdenschutz beweist er seit vielen Jahren, dass ein gutes Nebeneinander von Tierhaltung und Wolf möglich ist“, so Vogel.

Ein Jahr nach dem Shitstorm
Fast genau ein Jahr ist es her, dass Knut Kucznik vom Bundesverband der Berufsschäfer ausgeschlossen worden war. Kucznik hatte den Umgang der Berufskollegen mit der Wolfsproblematik kritisiert. Die Bauernzeitung hatte dazu ein ausführliches Interview mit ihm gemacht. Darin legt der Schäfermeister ausführlich dar, wie und warum er seine Einstellung zum Wolf verändert hat. Das Ministerium begründet die Auszeichnung aber mit anderen Aspekten des Naturschutzes:
Seit 1997 bewirtschaftet Knut Kucznik mit seinen Schafen artenreiche Trockenrasen und Niedermoore im Raum Altlandsberg. Um darüber hinaus auch besonders feuchte und nasse Moorflächen pflegen zu können, setzt er neben Schafen auch Wasserbüffel für die Biotoppflege von feuchten Moorwiesen ein. 2012 zunächst mit vier Tieren im Projekt LIFE Kalkmoore gestartet, grasen inzwischen mehr als 50 der exotischen Wiederkäuer auf den wertvollen Moorflächen rund um Altlandsberg.
So sorgen die Wasserbüffel im Naturschutzgebiet „Langes Elsenfließ und Wegendorfer Mühlenfließ“ für mehr Blütenvielfalt. Mit ihrem Appetit lichten die robusten Tiere die geschlossenen Bestände von Schilf und Großseggen auf und geben den typischen Blühpflanzen der Moorwiesen wie dem Großen Wiesenknopf, der Prachtnelke oder dem Sumpfstorchschnabel Licht und Raum zum Wachsen zurück.
Wasserbüffel für stark bedrohte Falter
Von der Landschaftspflege der Wasserbüffel profitieren zwei stark bedrohte und europaweit geschützte Schmetterlingsarten in besonderem Maße: Durch die Beweidung wachsen deutlich mehr Exemplare des Großen Wiesenknopfes. An dieser Pflanze spielt sich nahezu das ganze Leben des Dunklen und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ab. Diese seltenen Schmetterlinge kommen auf Knut Kuczniks Flächen nun wieder in größerer Zahl vor.
Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass es sich bei den Bläulingen auf den Moorflächen um Altlandsberg um die nördlichsten Vorkommen der beiden Arten in Deutschland und Mitteleuropa insgesamt handelt.
„Dass hier Wasserbüffel gezielt eingesetzt werden, um die Lebensräume dieser Falter extensiv zu pflegen und damit ihr Überleben zu sichern, ist deutschlandweit neu. Diese Form der Biotoppflege kann für andere Moorgebiete in Deutschland und Europa richtungsweisend sein“, sagt Umweltminister Axel Vogel bei der Preisverleihung.
Mit seiner Arbeit liefert Knut Kucznik außerdem wichtige Impulse für eine nachhaltige Tierzucht und Tierhaltung. Die Wasserbüffel werden in der Region geschlachtet, regional vermarktet oder zum Aufbau weiterer Wasserbüffelherden für die Landschaftspflege in Brandenburg und deutschlandweit verkauft.
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Deutscher Sojaförderring: Freunde der SojabohneSeine 40. Lehrfahrt unternahm der Deutsche Sojaförderring in den Nordosten Deutschlands. Die mageren Böden sind für den Anbau der anspruchsvollen Hülsenfrucht nicht gerade prädestiniert. Dennoch gab es einige Aha-Erlebnisse …
Da staunten die knapp 40 Teilnehmer der „Sojalehrfahrt 2021“ nicht schlecht, dass in der Brandenburgischen Streusandbüchse überhaupt Soja wächst. Es war die 40. Jahresexkursion, die der Deutsche Sojaförderring e. V. vergangene Woche unternahm und die erste, die ihn in den Nordosten Deutschlands führte. Sitz des Vereins ist Emmendingen im Südwesten Baden-Württembergs nördlich von Freiburg im Breisgau. Seit 1980 – mit einer coronabedingten Unterbrechung im vergangenen Jahr – machen sich sojaaffine Landwirte, Berater und Forscher auf mehrtägige Erkundungstouren, die der Verein organisiert.
Feldbesichtigung am Zalf in Müncheberg
Erste Station am vergangenen Montag: das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg. Interessierte aus ganz Deutschland, Österreich und Luxemburg waren angereist, um mehr über den Sojaanbau auf eher sandigen Böden unter kontinentalen Klimabedingungen zu erfahren. Dr. Moritz Reckling vom Zalf hat zur Wiederbelebung des Leguminosenanbaus in Europa promoviert, dafür 2019 den Forschungspreis der Stadt Müncheberg erhalten und erläutert der Gruppe die aktuellen Versuche der Arbeitsgruppe Ressourceneffiziente Anbausysteme (Schwerpunkt Soja).
Themen waren Anbaudiversifizierung, Bodenbearbeitung und Beregnung bzw. Trockenstress, ein Sortenversuch mit Soja, Lupinen und Ackerbohnen zur Ertragsleistung im Vergleich, Trockenheitsresistenz, Mischanbau mit Winterweizen, Soja-Anbauverfahren mit Zwischenfrüchten bzw. Untersaaten zur Reduzierung der Herbst-Nmin-Gehalte und Untersuchungen zur Präsenz von Knöllchenbakterien in Böden Nordostdeutschlands, die bisher noch keine Sojabohnen trugen.
Rechts: Jürgen Recknagel
(c) Heike Mildner
Eindrücke eines Soja-Spezialisten
Jürgen Recknagel, seit 20 Jahren geschäftsführender Vorsitzender des Sojaförderrings und Leiter des Sachgebiets Ökologischer Landbau des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ) mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Soja-Versuchsanbau Soja hat seine Eindrücke in einem Bericht zusammengefasst:
„Frappierend war der Unterschied zwischen zwei benachbarten Parzellen der Sorte Merlin, die am selben Tag gesät wurden: Während die nach Pflugfurche mit herkömmlicher Saatbettbereitung bestellte Parzelle einen schönen, bereits mit der Abreife beginnenden Bestand aufwies, präsentierte die in Mulchsaat bestellte Nachbarparzelle einen eher lückigen, heterogenen, schwach entwickelten Bestand, der noch keine Anzeichen der Reife aufwies. Dies unterstrich eindrücklich, wie wichtig eine erfolgreiche Bestandesetablierung für den Anbauerfolg ist“, schreibt Recknagel.
Recknagel weiter: „Bei den Sortenversuchen zeigten die Sojasorten der Reifegruppe 000 (lt. Sojaring geeignet für nicht so günstige Standorte mit deutlich früherer Ernte, Anm. der Red.) erfreuliche Bestände, von denen die frühesten in der Abreife bereits weit fortgeschritten waren. Aber auch die späteren lassen bei günstiger Herbstwitterung eine Abreife in den nächsten vier Wochen erwarten.
Im Mittel der Jahre 2018 bis 2020 lagen die Sojaerträge in diesem Versuch bei Beregnung immer deutlich über denen der Lupinen. In den Jahren 2017 bis 2019 gilt dies auch für die unberegneten Bestände. Ohne Beregnung lagen die Lupinenerträge lediglich im Jahr 2020 über den Sojaerträgen, trotz Ackerzahlen zwischen 25 und 35. Bei den Untersaaten zur Reduzierung des Nitratauswaschungsrisikos nach Sojabohnen gab lediglich die Untersaat von Weidelgras Anlass zur Hoffnung auf einen gewissen Erfolg“, vermerkt Recknagel.

Knöllchenbakterien sorgen für Überraschung
Mosab Halwani und Dr. Richard Omari sorgten mit ihren Ausführungen zum Einfluss von lokal isolierten Bradyrhizobium-Stämmen auf Kornertrag und Knöllchenbildung für Erstaunen in der Runde. Recknagel fasst zusammen:
„Die Untersuchung von Böden Nordostdeutschlands, auf denen noch nie Soja angebaut wurde, zeigte erstaunlicherweise Spuren von 400 verschiedenen Stämmen an Soja-Knöllchenbakterien der Gattung Bradyrhizobium japonicum. Davon werden nun einige in Japan auf ihre N-Fixierungsleistung untersucht und ggf. für die Entwicklung von Impfmitteln verwendet. Da sie in hiesigen Böden natürlicherweise nur in äußerst geringer Konzentration vorkommen, lässt sich daraus nicht schlussfolgern, dass auf eine Impfung von Sojabohnen mit bewährten Impfmitteln verzichtet werden kann.“

20 Autominuten von Münchberg entfernt stellte Marcel Budras, Pflanzenbauleiter der Komturei Lietzen, den Soja-Anbau des Betriebes auf zwölf Hektar am Standort Tempelberg vor. Zudem geht es um den Soja, den der Betrieb im Rahmen des Zalf-Projektes PatchCROP auf quadratischen Schlägen von je 0,5 ha im Versuchsanbau heranwächst.

Budras ist ein Soja-Einsteiger. Der Betrieb baut erst seit zwei Jahren Soja an. Fürs nächste Jahr ist eine Erweiterung der Anbaufläche auf 40 ha geplant. Budras’ bisherigen Erfahrungen sind durchwachsen: Den Anbau auf Flächen unter 30er Bodenwertzahl erachtet er als wenig sinnvoll. Pech hatte er im vergangenen Anbaujahr auch mit dem Impfmittel: Radicin wurde inzwischen vom Markt genommen. Mit HiStick, dem Impfmittel der Wahl in diesem Jahr, hofft er, bessere Erträge zu erzielen. Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen Budras als Praxispartner des PatchCROP-Projektes kämpft – zum Beispiel mit der Landtechnik bei den kleinen Feldgrößen auf Touren zu kommen –, zollten ihm die Teilnehmer der Sojalehrfahrt Respekt. Dass sich jemand im Osten damit herumschlagen muss, war für sie ein Grund mehr, sich zu wundern.
Brandenburg aktuell
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr
Erzeugergemeinschaft Fürstenberg: Soja für Legehennen
Tags drauf ging es für die Gruppe weiter nach Mecklenburg. An dieser Stelle übergeben wir ganz an Jürgen Recknagel, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender des Deutschen Sojaförderinges e. V.:
„Der zweite Tag begann mit der Vorstellung der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, einem Zusammenschluss von 28 ökologisch wirtschaftenden Legehennenbetrieben zwischen Rostock und Anklam, mit gemeinschaftlicher Vermarktung und Außenwirtschaft durch den Verantwortlichen für die Feldbewirtschaftung von 5.000 ha, Christian Littmann. Auch dort sind die Ackerböden häufig sehr heterogen mit Ackerzahlen zwischen 12 und 60, je nach Sand- bzw. Schluff- und Tonanteil. Erste Versuche mit dem Anbau von Sojabohnen erfolgten bereits 2009. Rückschläge gab es vor allem infolge von ungenügendem Erfolg bei der Unkrautregulierung sowie auf Böden geringer Wasserspeicherfähigkeit in Trockenjahren.
Soja nur noch auf Flächen mit Ackerzahlen über 30
Eine Konsequenz daraus ist, dass Sojabohnen nicht mehr auf Flächen mit Ackerzahlen unter 30 angebaut werden. 2021 umfasst der Anbau 35 ha, aufgeteilt in die vier Sorten Aurelina, Abelina, Alicia und Marquise. Mit Blindstriegeln und zweimaligem Hacken mit einer kameragesteuerten 12-m-Hacke (50 cm Reihenabstand) wurden sehr saubere Bestände erreicht, die auch bereits mehr oder weniger ausgeprägte Zeichen der Abreife aufwiesen. In ungünstigen Jahren mit später Abreife wird aber auch ab 20 % Kornfeuchte gedroschen, da dank einer eigenen Biogasanlage kostengünstig getrocknet werden kann.
Hühnerfutter: Die Mischung machts
Für die Versorgung der Legehennen sind neben dem Anbau von Getreide und Sonnenblumen (1.000 ha) aktuell beim Anbau der 20-35% Körnerleguminosen die Ackerbohnen (570 ha; Sommer- und Winterform; 1,5-4,5 t/ha), Blaue Süßlupinen (550 ha; 2-2,5 t/ha) und Erbsen (360 ha; 2,5-5 t/ha) noch weitaus bedeutender als die Sojabohnen (1-2,7 t/ha). Deren Anbaufläche soll aber wegen der hohen Eiweißgehalte und -qualitäten ausgeweitet werden. Zur Ermittlung der für den Standort am besten geeigneten Sorten werden in einem Streifenversuch neben den vier Sorten des Feldanbaus weitere vier Sojasorten und auch zwei Sorten Kichererbsen getestet. Eine Toastanlage für die Aufbereitung von Sojabohnen zu Hühnerfutter ist in Planung.
Versuche zu Kälte- und Trockenheitstoleranz
Nach einem Mittagsimbiss am Feldrand ging es weiter nach Groß-Lüsewitz bei Rostock, zum Versuchsfeld des Julius-Kühn-Institut auf ebenfalls eher sandigen Böden. Dort arbeitet Dr. Christiane Balko bereits seit 2011 mit Sojabohnen, u. a. zu Fragen der Kälte- und Trockenheitstoleranz. Während sich bei der Kältetoleranz zum Teil gravierende Sortenunterschiede zeigten, sind diese bezüglich der Trockenheitstoleranz geringer. Seit 2021 untersucht sie die Reaktion von 39 Sojasorten auf Ertrag und Reife bei früher (21.04.2021) und später Aussaat (10.05.21).
Gesucht sind kälteresistente Sorten, die früh gesät werden können und dank kurzer Abreifephase in einer somit verlängerten Vegetationsphase höhere Erträge bringen und dies möglichst zuverlässig. Obwohl der früh gesäte Block mit eigentlich zu niedrigen Bodentemperaturen konfrontiert war (aber ohne Nässe), zeigte er auch Anfang September noch einen erkennbaren Entwicklungsvorsprung und eine 5-10 cm größere Bestandeshöhe, wobei sich auch Unterschiede zwischen den Sorten zeigten. Entscheidend werden aber die Ernteergebnisse sein.
Sojabohnen – siliert oder gedroschen
Nach Übernachtung in Güstrow wurden am dritten Tag noch zwei Betriebe im Raum Schwerin besucht: Der vorwiegend biologisch wirtschaftende Agrarhof Brüel mit 1200 Kühen der Rasse Jersey bewirtschaftet 3000 ha mit Ackerzahlen zwischen 18 und 55. Neben Winterroggen, Winterweizen, Lupinen, Erbsen, Ackerbohnen und Hafer werden 2021 auch 50 ha Sojabohnen der Sorte Marquise angebaut.
Da der Ertrag in der Fütterung von Milchvieh Verwendung findet, entscheidet sich Anfang Oktober, ob die Sojabohnen siliert oder gedroschen werden: Sind die Blätter noch an den Pflanzen, wird in Folienschläuche siliert; sind sie ab, wird gedroschen. Anfang September zeigte sich der nach Landsberger Gemenge gesäte Bestand nach zweimaligem Blindstriegeln und einmaligem Hacken sehr sauber und bereits gelb verfärbt, sodass er vermutlich gedroschen werden kann. Für überwiegend süddeutsche Augen war der neue Offenstall für 600 Kühe mit acht Melkrobotern und halbtäglich abwechselnder Weidegelegenheit ein ungewohnter Anblick, aufgrund seiner Sauberkeit, Helligkeit, guten Luft und dem äußerst friedlichen Tierbestand jedoch durchaus überzeugend.
Abellina und Marquise mit schönem Hülsenansatz
Letzter Besichtigungspunkt war die Agrarproduktionsgesellschaft Lübesse mit 2.250 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, davon ca. 1.725 ha Ackerland, meist Sand mit Ackerzahlen von 17-22. Davon werden ca. 320 ha beregnet, meist jedoch nur Kartoffeln und Zwiebeln. Die anderen Feldfrüchte, darunter auch die Sojabohne, müssen in der Regel ohne Bewässerung auskommen. Hauptkulturen mit je 500 ha sind Winterroggen (25-50 dt/ha) und Silomais (6-10 t TM/ha), daneben Winterweizen, Kartoffeln, Erbsen und Zwiebeln. Soja wird auf 19-100 ha angebaut (6-20 dt/ha; beregnet 34 dt/ha). Dabei zeigten die Hauptsorten Abellina und Marquise auf dem extrem sandigen Standort einen schönen Hülsenansatz und beachtlichen Reifefortschritt.
Einige andere in einer Sortendemonstration gezeigte Sorten hatten dagegen einen deutlich schwächeren Hülsensatz. Dies zeigt, wie wichtig standortspezifische Sortenversuche gerade auf extremen Standorten sind.
Mittels Kalttest die Triebkraft untersuchen
Bei dieser Gelegenheit wies Christian Gaisböck, Geschäftsführer der MFG-Deutsche Saatgut, auch auf die Bedeutung einer guten Saatgutqualität für einen erfolgreichen Sojaanbau hin: Gerade bei Partien mit Keimfähigkeiten unter 85 % ist es wichtig, mit einem Kalttest auch die Triebkraft zu untersuchen, da diese hier noch deutlicher unter dem Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Keimfähigkeitsuntersuchung liegen kann. Im Extremfall konnten Differenzen um bis zu 30 % festgestellt werden. Was bei günstigen Auflaufbedingungen noch gut gehen mag, kann unter schwierigen Auflaufbedingungen auch in der Praxis zu sehr schwachen Beständen führen. In der Folge können solche Bestände stark verunkrauten und müssen im schlimmsten Fall letztlich umgebrochen werden. Deshalb verzichtet die Firma MFG auf die Auslieferung von Partien mit schlechten Ergebnissen im Kalttest, auch wenn diese aufgrund des Ergebnisses der Keimfähigkeitsuntersuchung von über 80 % verkehrsfähig wären.„
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Wolfsangriffe: Bis die Polizei kommt …Mit einer provokanten Installation machte Jens Schreinicke aus dem brandenburgischen Dorf Stücken am Freitag auf die Lage der Weidetierhalter aufmerksam. Die Aktion dauerte nur bis zum Nachmittag, schlug aber dennoch Wellen.
Allein in diesem Jahr hatte der Wolf im 500-Seelen-Dorf Stücken schon dreimal zugeschlagen. Fünf Kamerunschafe und drei Weiße Gotlandschafe sind als Nummer 30, 73 und 230 in der Statistik der Wolfsrisse in Brandenburg verzeichnet. In der Nacht zum vergangenen Freitag fiel nun ein Wolf auf einer Koppel im Dorf eine zehn Monate alte Färse an. „Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es nach Begutachtung durch den Tierarzt getötet werden musste“, sagt Jens Schreinicke.
Gesicherten Erhaltungszustand anerkennen
Der Haupterwerbslandwirt mit hundert Mutterkühen ist Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark und Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes Brandenburg. In dieser Funktion hatte er soeben die aktuelle Rissstatistik für Brandenburg ausgewertet und in einer Pressemitteilung des Landesbauernverbandes Umweltminister Axel Vogel aufgefordert, „sich bei seiner Amtskollegin auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass sie gemeinsam mit ihren baltisch-osteuropäischen Ministerkollegen den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes nach Brüssel meldet.“ Ein Schritt hin zum aktiven Wolfsmanagement, den Schreinicke und der LBV Brandenburg als längst überfällig erachten.
Provokante Installation
Als es für Schreinicke mit dem Wolfsübergriff auf sein Jungrind keine drei Tage später persönlich wird, lässt er sich zu einem drastischen Schritt hinreißen: Zusammen mit seinem Vater bindet er dem toten Tier paarweise die Läufe zusammen und hängt es kopfüber an die Gabel des Teleskopladers.
Er schreibt „Wolfsopfer! Dank den Träumern in diesem Land“ auf ein Stück Pappe, bringt es über dem Tier an und fährt die provokante Installation in die Höhe. So kann man sie über den Zaun hinweg von der gut befahrenen Straße aus gut sehen.

Die Polizei kommt am späten Nachmittag. Schreinicke soll das Tier abhängen. Damit hatte er gerechnet, kommt der Aufforderung sofort nach und entgeht so einer Anzeige. Zudem habe er einen Auffangbehälter unter den Kadaver gestellt, damit ihm von dieser Seite kein Vergehen angelastet werden könne, so Schreinicke gegenüber der Bauernzeitung.
„Wir wollten den Leuten zeigen, dass hinter den Zahlen in den Rissstatistiken solche Bilder stehen“, sagt Schreinicke der Regionalzeitung. „Als Weidetierhalter fühlt man sich wie jemand, der gefesselt ist und auch noch verprügelt wird“, steht im Beitrag unter Schreinickes Foto. Andere Zeitungen übernehmen die Nachricht, auch das Regionalfernsehen zeigt Schreineckes Bilder. Im Internet findet sich unter „Dorfgeschichte(n) – Stücken bloggt“ eine ausführliche Version.

Stücken liegt im Naturpark Nuthe-Nieplitz. Die Weidetierhalter dort sind gebeutelt. Seit Januar haben sie über 30 Wolfsrisse gezählt und auf einer Landkarte im Internet vermerkt. Insgesamt wurden in Brandenburg in diesem Zeitraum 219 Wolfsrisse offiziell registriert, 627 Nutztiere wurden dabei getötet oder verletzt.
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Neuer Rahmenlehrplan für Brandenburger Landwirtschafts-AzubisDen Schulterschluss zur Praxis sucht der neue Rahmenlehrplan für Landwirtschafts-Azubis. Er wird ab August 2022 in Brandenburg eingeführt und orientiert sich am Lernfeldkonzept. Das Konzept verlangt ein völlig neues Herangehen an die Vermittlung der Inhalte. Die Feinabstimmung läuft.
Über die Diskussion zu Lehren aus den Corona-Lockdowns berichteten wir in der vergangenen Woche. Zweites großes Thema des 2. Märkischen Ausbildertages am 18. August in Kemlitz war die Vorstellung des neuen Rahmenlehrplans für Landwirte. Er soll ab Ausbildungsjahr 2022/23 in Kraft treten und zunächst für das erste Ausbildungsjahr gelten. Derzeit läuft die Feinabstimmung der Inhalte.
Hintergrund der Initiative des Brandenburgischen Bildungsministeriums ist die längst überfällige Anpassung an einen Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK). Er besagt, man möge für die duale Berufsausbildung Rahmenlehrpläne nach dem Lernfeldkonzept entwickeln. In den meisten Handwerksberufen ist das bereits Gang und Gäbe.
Überfällige Anpassung an KMK-Beschluss
„Endlich wird der Rahmenlehrplan, der bisher nach Fächern aufgeteilt ist, überarbeitet“, begrüßt Sabine Baum (Agrarministerium) die Initiative aus dem Bildungsministerium. Und anders als bei den Gärtnern, lasse man sich bei den Landwirten mehr Zeit für die Abstimmung. Berufsstand und Lehrerschaft seien von Anfang an mit im Boot. Im März habe man vom Bildungsministerium einen ersten Entwurf bekommen. Dazu habe es von Bauernverband, Ausbildungsnetzwerken und überbetrieblichen Ausbildungsstätten konstruktive Hinweise gegeben. Sie habe zudem erreicht, dass der neue Plan erst ab August 2022 gelten wird. „So haben alle Zeit, sich darauf einzustellen“, begründet Sabine Baum.
Sandra Engels, im Brandenburgischen Bildungsministerium für den Entwurf des Rahmenlehrplanes zuständig, war verhindert. Darum stellte ihn Berufsschullehrerin Andrea Präger, die in der Arbeitsgruppe dabei war, in Kemlitz vor. Auf Bundesebene habe es seit dem Beschluss der Ausbildungsverordnung für Landwirte von 1995 keine gesetzliche Änderung mehr gegeben. Die 26 Jahre alte Verordnung sei bindend: „Wir konnten keine komplett neuen Inhalte einbinden und keine alten rausschmeißen“, so Präger. „Wir haben versucht, einen Brandenburger Weg zu finden, um die bundesweite Verordnung für uns gangbar zu machen.“
Brandenburg aktuell
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr
Lernfeldkonzept fordert komplettes Umdenken
Deutlich wurde: Die Umsetzung des Lernfeldkonzepts fordert ein komplettes Umdenken an den Berufsschulen. Grundlage des neuen Herangehens ist eine Erkenntnis: Auszubildende erlangen ihre berufliche Handlungsfähigkeit am besten über die Lösungsfindung für bestimmte Probleme. Schubladen mit Faktenwissen haben ausgedient. Vielmehr sollen sich die Fachinhalte in Handlungsfeldern wiederfinden, die die Berufsschüler im Idealfall schon aus dem Ausbildungsbetrieb kennen. Voraussetzung dafür sind eine engere Zusammenarbeit der Berufsschulen mit den Ausbildungsbetrieben und fächerübergreifendes Agieren der Berufsschullehrer.
Autorin eines interessanten, wenn auch schon zehn Jahre alten Beitrags zur Einführung des Lernfeldkonzepts bei der Fachkraft Agrarservice ist Dr. Ilona Paul-Pollack, heute Leiterin des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). Sie beschreibt darin u. a. die Konsequenz des Lernfeldkonzepts für Schüler und Lehrer. „Die Erarbeitung anwendungsbereiten Wissens ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch ein gedankliches Nachvollziehen berufstypischer Handlungsabläufe, die in praxisrelevante Problemsituationen eingebettet werden. Ein weiteres Merkmal … besteht in der zunehmend selbstständigen Steuerung der Lernprozesse durch die Schüler“, so Paul-Pollack in ihrem Beitrag und nennt Informieren, Planen, Entscheiden, Durchführen, Kontrollieren und Auswerten als Phasen dieses neuen, handlungsbezogenen Lernens.
LEHRER WERDEN ZU BEGLEITERN DER LERNPROZESSE
„Die Lehrkräfte müssen sich bei der Ausgestaltung des Unterrichts einerseits an konkreten beruflichen Handlungen orientieren und andererseits dem Schüler genügend Raum zum selbst gesteuerten Planen, Nachvollziehen und Reflektieren geben“, so Paul-Pollack. Die Lehrenden würden zu Gestaltern und Begleitern der Lernprozesse.
Viele Fragen zur Umsetzung des Lernfeldkonzepts in der Landwirtsausbildung über den neuen Rahmenlehrplan werden noch vor Ort in den Oberstufenzentren zu klären sein, denn Fakt ist: Statt Fächern werden 17 Lernfelder den Unterricht strukturieren:
1. Lehrjahr:
neuen Mitarbeiter einführen (40 h), Tiere halten und produzieren (60 h), Tiere füttern (40 h), Pflanzen erzeugen (60 h), Bodenfruchtbarkeit erhalten (60 h, siehe Kasten), Geräte, Maschinen und Anlagen (60 h).
2. Lehrjahr:
einen Betrieb ökologisch bewirtschaften (50 h), Kälber und Jungrinder erzeugen und aufziehen (80 h), Ferkel erzeugne und aufziehen (60 h), Grundfutter erzeugen und konservieren (60 h), Hackfrüchte anbauen und ernten (30 h).
3. Lehrjahr:
Pflanzen gesund erhalten (40 h), Schlachtrinder und Milch produzieren (60 h), Schweine füttern und gesund erhalten (40 h), Getreide anbauen und ernten (60 h), Öl- und Eiweißpflanzen anbauen und ernten (40 h), Betriebsmittel einkaufen und Produkte vermarkten (40 h).
Beispiel: Lernfeld 5 – Bodenfruchtbarkeit erhöhen
Im ersten Ausbildungsjahr sind 60 Stunden dem Lernfeld 5, „Bodenfruchtbarkeit erhöhen“, gewidmet. Zu den Kompetenzen, die die Berufsschüler in diesem Lernfeld erwerben sollen, heißt es: „Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Böden, fördern ihre nachhaltige Ertragsfähigkeit und düngen die angebauten Pflanzen bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und des Umweltschutzes.“
– Schüler und Schülerinnen untersuchen die Entstehung von Böden, machen sich mit der Einteilung der Bodenarten vertraut; sie untersuchen die Bodenbestandteile und ihre Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion; bestimmen Bodenarten, bewerten Böden, planen Maßnahmen, die Bodenschäden verhindern helfen;
– sie charakterisieren und vergleichen Bodenbearbeitungssysteme, wählen Bearbeitungsgeräte nach Bodenzustand und Kulturanforderungen; benennen mögliche Einstellungen an den Arbeitsgeräten, beurteilen ökologische und ökonomische Auswirkungen verschiedener Bodenbearbeitungssysteme;
– Schüler und Schülerinnen ermitteln den Nährstoffentzug durch die Landwirtschaft in natürlichen Stoffkreisläufen; sie denken über Düngung nach, machen sich diesbezüglich mit Möglichkeiten und Wirkungen vertraut;
– Schüler und Schülerinnen planen Dünge- und Bodenverbesserungsmaßnahmen; sie planen die Düngerausbringung u. a. auch nach rechtlichen Vorgaben; sie beschäftigen sich mit ökologischen, ökonomischen und rechtlichen Konsequenzen einer Fehlversorgung.
Quelle: Kemlitzer Handout zum Entwurf des Rahmenlehrplanes, teils gekürzt
In Kemlitz traf das neue Konzept auf offene Ohren. Mario Schwarze (Ausbilder Agrargenossenschaft Goßmar) hofft auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb, Dr. Gernot Bilke (Zuständige Stelle beim LELF) erinnerte an die bereits jetzt sehr komplexen Themen bei der Prüfungsgestaltung. Und Dieter Heyde (Ausbildungsnetzwerk Elbe-Elster) empfahl, Praktiker in die Berufsschulen einzuladen. Inwieweit die Umsetzung des Lernfeldkonzepts bei der Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice bereits gelungen ist, wäre ein anderes Thema.
Hast du als Fachkraft Agrarservice bereits Erfahrungen mit dem Lernfeldkonzept in der Berufsschule gemacht?
Hast du Anregungen dazu?
Schreib an brandenburg@bauernzeitung.de oder ruf uns an: (03 34 70) 40 00 95.
Wir sind gespannt, was da aus eurer Sicht besser gehen könnte. Danke!
Mehr erwartet, weniger geerntet! So lautet die Erntebilanz 2021 des Brandenburger Landesbauernverbandes auf der heutigen Pressekonferenz auf dem Syringhof in Zauchwitz bei Beelitz. Sowohl bei der Hauptkultur Winterroggen als auch beim Winterweizen blieben die Erträge unter dem Mittel der Jahre von 2015 bis 2019.
Zur Ernte in Brandenburg blieben 2021 sowohl bei der Hauptkultur Winterroggen als auch beim Winterweizen die durchschnittlichen Erträge von 38 beziehungsweise 58,3 dt/ha noch unter dem Mittel der Jahre von 2015 bis 2019. Lediglich bei der Wintergerste (61,7 dt/ha) und beim Winterraps (29,2 dt/ha) konnten im Vergleich dazu bessere Ergebnisse erzielt werden. „Wir mussten unsere optimistischen Erwartungen zum Erntestart leider korrigieren“, erklärte LBV-Präsident Henrik Wendorff auf der heutigen Pressekonferenz auf dem Syringhof in Zauchwitz bei Beelitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark. Als Ursache führte er die Trockenperiode im Juni an, die kleine Körner und ein geringes Hektolitergewicht zur Folge hatte.

Ernte in Brandenburg: Wasserdefizit und Spätfröste
„Die Lage ist nicht einfach, und das wird auch so bleiben“, resümierte Agrar- und Umweltminister Axel Vogel in Zauchwitz. Er verwies auf ein großes Wasserdefizit vor allem in den unteren Bodenschichten. Im August und September vergangenen Jahres habe es zwar günstige Bedingungen zur Bodenbearbeitung und zur Aussaat gegeben, doch durch die Frühsommertrockenheit seien die Kornerträge im konventionellen wie im ökologischen Anbau unter den Erwartungen geblieben. Einbußen bei der Ernte in Brandenburg verzeichnet auch der Obst- und Gemüsebau. Spätfröste im Frühjahr führten zu Ertragsverlusten in fast allen Obstkulturen sowie bei Gurken. „Mittlerweile haben wir jedes zweite Jahr Spätfröste, früher war das nur aller sieben Jahre der Fall“, betonte Dr. Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauerverbandes Berlin-Brandenburg e. V.
Nachdem rund 90 % der Getreide- und Rapsbestände abgeerntet sind, hoffen die Landwirte noch auf bessere Erträge beim Mais, so auch Thomas Syring aus Zauchwitz. Auf dem Hof wird die Körnerfrucht neben Spargel, Kartoffeln, Kürbissen und Roggen angebaut. „Der Mais ist für unsere Fruchtfolge unverzichtbar“, so Thomas Syring. wh
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Fallwildsuche und s im Nordosten unterwegsAm Freitag war die Leiterin des Landeskrisenstabs zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP), Verbraucherschutzstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, im Nordosten Brandenburgs unterwegs. In den Landkreisen Barnim und Uckermark machte sie sich ein Bild von den Bekämpfungsmaßnahmen. Von insgesamt rund 270 Kilometern des zweiten Schutzzauns sollen 80 stehen.
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich derzeit in Westpolen weitgehend ungebremst Richtung Norden aus. Dadurch erhöht sich auch der Infektionsdruck auf das nördliche Brandenburg. Ende Juli gab es im Landkreis Barnim den ersten bestätigten ASP-Fall beim Schwarzwild, vergangene Woche im Landkreis Uckermark. Die Leiterin des Landeskrisenstabs zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Verbraucherschutzstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer hat sich heute bei einem Besuch in den betroffenen Gebieten ein Bild von den Bekämpfungsmaßnahmen gemacht und sich mit Landrätin, Landrat und weiteren Verantwortlichen vor Ort ausgetauscht.

Sie danke den örtlichen Behörden für das schnelle und konsequente Handeln. Die Landkreise an der Grenze seien das Bollwerk gegen eine weitere Ausbreitung der ASP Richtung Westen. „Leider ist nicht zu erwarten, dass der Seuchendruck aus Polen absehbar nachlässt. Darum bin ich sehr froh, dass der Bau des zweiten festen Zauns für den Schutzkorridor entlang der Grenze zu Polen so zügig vorangeht“, so Heyer-Stuffer.
Karina Dörk, Landrätin des Landkreises Uckermark, gab zu Protokoll: „Momentan läuft in der Uckermark eine intensive Fallwildsuche unter Beteiligung von ehrenamtlichen Helfern, Mitarbeitern der Kreisverwaltung, Jägern und Vertretern aus den betroffenen Kommunen. Dabei kommen auch Drohnen zum Einsatz. Unser Dank gilt den freiwilligen Helfern, die sich sofort nach unserem Aufruf gemeldet haben. Weitere Unterstützung ist erbeten.“ Dörk nutzte die Gelegenheit, die Anwohner um Verständnis für Einschränkungen zu bitten, die sich aus der Bekämpfung der Seuchengefahr ergeben.“
Über 200 Sucheinsätze im Barnim
Daniel Kurth, Landrat des Landkreises Barnim, äußerte sich folgendermaßen gegenüber der Presse: „Wir hatten den Vorteil, dass wir uns auf den Ernstfall vorbereiten konnten. Seit dem ersten ASP-Fund im Barnim greifen in unserem Lokalen Bekämpfungszentrum viele Zahnräder ineinander, die wir zuvor in Stellung gebracht haben. Dazu gehören insbesondere die vielen freiwilligen Kräfte, die uns jetzt bei der Fallwildsuche unterstützen.“

Im Landkreis Barnim fanden Kurth zufolge in den vergangenen drei Wochen mehr als 200 Sucheinsätze statt. Sie hätten wesentlich dazu beitragen, die Ausbreitung der ASP im Landkreis Barnim und die damit verbundenen Auswirkungen bislang auf ein Mindestmaß zu reduzieren, so Kurth: „Mein ausdrücklicher Dank gilt den zahlreichen Freiwilligen, den Land- und Forstwirten, den Jägerinnen und Jägern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises Barnim für ihren unermüdlichen Einsatz. Zugleich bedanke ich mich bei Frau Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer und dem Landeskrisenstab für die tatkräftige Unterstützung bei unseren Maßnahmen.“
Zweiter ASP-Zaun entlang der Grenze: 80 von 270 km fertig
Neben dem fertiggestellten Schutzzaun entlang Oder und Neiße hatte der Landeskrisenstab im Juni den Bau eines zweiten festen Zauns beschlossen, um durch einen mindestens 500 Meter breiten wildschweinfreien Schutzkorridor die Gefahr eines ASP-Eintrags zu minimieren. Innerhalb dieser „Weißen Zone“ wird der Wildschweinbestand auf möglichst null reduziert, es findet eine intensive Suche nach Fallwild statt und schweinehaltende Betriebe werden in besonderem Maße überwacht. Landesweit seien von insgesamt rund 270 Kilometern des zweiten Schutzzauns 80 Kilometer fertig gestellt, informiert das Ministerium. mil
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Ernte 2021 in Brandenburg: Zwölf Prozent weniger als im VorjahrNach der zweiten Ernteschätzung im Juli 2021 rechnen Brandenburgs Landwirte mit einer Getreideernte (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) von 2,3 Mio. t. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg ist das im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um fast 12 Prozent.
Die Anbaufläche für Getreide ging um zwei Prozent auf 470.900 ha zurück, der Ertrag lag mit knapp 49 dt/ha um neun Prozent unter dem des Vorjahres. Negativ wirkten sich fehlende Niederschläge in der Wachstumsperiode aus.
Roggen bestimmt Gedreideanbau
Beim Roggen, der mit 160.300 ha den Getreideanbau in Brandenburg bestimmt, wird mit einem Ertrag von 39 dt/ha gerechnet. Im Jahr zuvor waren es hingegen rund 48 dt/ha. Gleichzeitig liegt der diesjährige Hektarertrag um fünf Prozent unter dem sechsjährigen Durchschnitt (2015 bis 2020). Winterweizen war auf einer Fläche von 158.500 ha zu ernten. Hier beläuft sich der Hektarertrag auf 57 dt/ha, zwölf Prozent weniger als im Vorjahr.
Nur bei Wintergerste Steigerung zum Vorjahr
Nur bei der Wintergerste wird mit 60 dt/ha ein höherer Ertrag als 2020 erwartet. Er liegt um fünf Prozent über dem sechsjährigen Durchschnitt. Für Triticale wird derzeit ein Ertrag von 43 dt/ha prognostiziert. Das würde dem Vorjahresniveau entsprechen. Die Brandenburger Landwirte erwarten beim Hafer einen Ertrag von 25 dt/ha. Damit liegt die Ertragserwartung um neun Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. Beim Winterraps, Brandenburgs bedeutendster Ölfrucht, wird von einem Ertrag von fast 29 dt/ha ausgegangen. 2020 hatte er noch 33 dt/ha betragen. Voraussichtlich werden 250.700 t Winterraps auf Brandenburgs Feldern geerntet.
Äpfel 23 Prozent unter dem langjährigen Mittel

Noch bevor die Apfelernte am 2. September offiziell eröffnet wird, ist auch für die 902 ha mit Apfelbäumen in Brandenburg die Prognose mäßig: Erste vorläufige Meldungen der Ernteberichterstatter gehen für 2021 von einem Apfelertrag von 209 dt/ha aus. Das wären nach Informationen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 59 dt/ha weniger als im Vorjahr. Dieser Ertrag läge damit um 23 % unter dem langjährigen Mittel (2015 bis 2020).
Dafür machen die Obstbauern teils extreme Kälteeinbrüche im April sowie lokale Starkregenereignisse verantwortlich. Zudem wirken sich die Ertragsschwankungen im zweijährigen Rhythmus (Alternanz) und Hagelschäden negativ auf den Ertrag aus. Derzeit sei von einer Erntemenge von rund 18 800 Tonnen Äpfel auszugehen. Im Jahr zuvor konnten in Brandenburg noch 24.565 t Äpfel gepflückt werden.
Update zur Erntepressekonferenz am Dienstag
Am Dienstag werden Agrarminister Axel Vogel, Landesbauernpräsident Henrik Wendorff und Dr. Andreas Jende, Geschäftsführer Gartenbauverbandes Berlin Brandenburg und Thomas Syring, Betriebsleiter des Syringhof die Presse über den aktuellen Ergebnisstand der Ernte informieren. mil
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Tag der Kartoffel: Wo sind die Kartoffeln hin?273 Jahre nach dem ersten Kartoffelbefehl des Preußenkönigs liegt der Selbstversorgungsgrad mit Speisekartoffeln in Brandenburg unter 30 Prozent. Anlässlich des Tages der Kartoffel hat der Landesbauernverband darüber nachgedacht.
Zwar wurde der Tag der Kartoffel in den USA erfunden, aber wie die Knolle selbst, ist auch ihr Feiertag mittlerweile in Europa angekommen. Der Landesbauernverband Brandenburg nimmt ihn zum Anlass, auf den geringen Selbstversorgungsgrad mit Speisekartoffeln in der Hauptstadtregion Berlin/Brandenburg aufmerksam zu machen. Er liegt unter 30 Prozent.
Derzeit werden im Land Brandenburg lediglich auf ca. 11.100 ha Kartoffeln angebaut. Das sind nur 0,85 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Brandenburgs. Allein im ehemaligen DDR-Bezirk Potsdam wurden bis zur Wende bis zu 60.000 ha mit Kartoffeln bepflanzt. Heute gibt es im Land nur noch wenige Agrarbetriebe, die Kartoffelanbau betreiben.
Selbstversorgungsgrad unter 30 Prozent
Für sichere Erträge benötigt die Kartoffel regelmäßig verteilte Niederschläge. Bedingt durch den Klimawandel ist Brandenburg allerdings verstärkt mit trockenen Perioden konfrontiert. Eine sinnvolle Antwort auf dieses Problem wären daher moderne Bewässerungsmöglichkeiten.
Doch nur wenige landwirtschaftliche Betriebe verfügen über eine Beregnung. Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch, weil Genehmigungen immer komplizierter und langwieriger werden und nicht immer zum Erfolg führen. Wir haben das jüngst am Beispiel der Spreewaldgurken beschrieben.
Brandenburg aktuell
Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr
Wasser aus dem Winter in den Sommer retten
Landesbauernpräsident Henrik Wendorff plädiert einmal mehr für Wasserrückhaltebecken. „Folgerichtig wäre es, im Bedarfsfall auf Niederschläge zurückzugreifen zu können, die in den regenreicheren Herbst- und Wintermonaten anfallen. Deshalb bietet sich perspektivisch die Anschaffung künstlicher Wasserrückhaltebecken an.“
Argumente dafür bietet auch die Auswertung des Berichts des Weltklimarats, der auch Prognosen für die Hauptstadtregion enthält und am Sonntag von RBB24 mit eindrucksvollen Grafiken versehen, veröffentlich wurde.

Warum gerade in Brandenburg die Trauer über den Anbaurückgang der nahrhaften Knollen so groß ist, zeigt ein Blick in die Geschichte: Die Etablierung der ursprünglich aus Südamerika stammenden Kartoffelknolle in Preußen wird Friedrich II. (1712-1786) zugeschrieben. Der Idee nach sollten mit der Kartoffel die damals herrschenden Missernten und Hungersnöte bekämpft werden. Der anfänglichen Skepsis begegnete der Preußenkönig mit den fünf sogenannten Kartoffelbefehlen. Den ersten erließ er am 18. Juli 1748. Darin wies er alle preußischen Ämter an, Kartoffeln in die Erde zu bringen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nahm der Kartoffelanbau eine positive Entwicklung, auch über Brandenburg hinaus.
Gestern vor 30 Jahren, am 17. August 1991, wurde der Sarg Friedrich II. von Marburg nach Potsdam gebracht. Den Niedergang des Kartoffelanbaus in seinen ehemaligen Provinzen konnte das nicht aufhalten. Dennoch legen Kartoffelfans „ihrem“ Friedrich auch 30 Jahre später noch Kartoffeln auf sein Grab auf der Terrasse von Sanssouci. Wir hoffen, sie achten dabei auf die regionale Herkunft aus Brandenburg.
Weitere Nachrichten aus den Bundesländern
Bei einem erlegten Frischling in der Uckermark südwestlich von Criewen ist das ASP-Virus festgestellt worden. Das Tier wurde östlich des ersten ASP-Schutzzaunes zu Polen erlegt, rund 300 Meter von der deutsch-polnischen Grenze entfernt.
Das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wurde nun erstmals im Landkreis Uckermark in Brandenburg nachgewiesen. Ein im Südwesten des Ortes Criewen erlegter Frischling hatte sich mit dem Virus infiziert. Das Wildschwein wurde östlich des ersten ASP-Schutzzaunes in etwa 300 m Entfernung zur deutsch-polnischen Grenze erlegt. Mit der Uckermark wurde ASP in Brandenburg in acht Landkreisen nachgewiesen. Neues zum Thema gab es auch gestern im Agrarausschuss. Der Landkreis Uckermark habe die erforderlichen Krisenstrukturen aktiviert und die notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet, hieß es am Donnerstagmittag aus dem Verbraucherschutzministerium. Priorität habe jetzt die flächenhafte Fallwildsuche westlich des ASP-Schutzzaunes, um eine eventuelle Ausbreitung der Tierseuche frühzeitig zu erkennen.
„Derzeit beobachten wir, dass sich die ASP in Westpolen ungebremst nach Norden ausbreitet. Ich bin froh, dass wir mit dem Bau des zweiten festen Zauns entlang der Grenze begonnen haben, um einen Schutzkorridor an Oder und Neiße zu errichten. Das sind entscheidende Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung“, kommentierte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) den neuen ASP-Fall. Dieser setzt die Chronologie der ASP-Ausbrüche fort, die Henrik Reinke vom Referat Wald und Forstwirtschaft der Obersten Jagdbehörde (MLUK) gestern im Agrarausschuss so zusammenfasste.
Chronologie der Ausbrüche von ASP in Brandenburg
• 10. September 2020 Ausbruch in Spree-Neiße,
• 30. September 2020 Ausbruch in Märkisch-Oderland,
• 26. Oktober 2020 Ausbruch in den Landkreisen Oder-Spree/Dahme-Spreewald
• 04. März 2021 Ausbruch im Norden von Frankfurt (Oder)
• März 2021 Fallwildfund östlich des Zaunes entlang der Neiße im Südosten von Spree-Neiße mit anschließendem Ausbruch im Juni 2021
• 21. Mai 2021 Ausbruch im Süden von Frankfurt (Oder)
• 15. Juni 2021 Ausbruch westlich von Müllrose (Landkreis Oder-Spree)
• 16. Juli 2021 Ausbruch in drei Hausschweinbeständen (Märkisch-Oderland, Spree-Neiße)
• 28. Juli 2021 Ausbruch im Landkreis Barnim
Und nun also ein Ausbruch in der Uckermark. Nonnemacher wies auf den regelmäßigen Diebstahl von Batterien an Elektrozäunen, ganzen Toren oder Zaunelementen hin. „Er schadet uns allen und ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat“, so Nonnemacher. „Es gibt Tierhalter, die hier um ihre Existenz kämpfen. Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest geht uns alle an! Jede und jeder ist gefordert, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu befolgen. Auch fordere ich alle Angler*innen, Spaziergänger*innen oder Radfahrer*innen auf, die installierten Tore in den Zäunen zu nutzen und nach dem Durchgang unbedingt wieder zu verschließen. Die ASP kann nur eingedämmt werden, wenn alle dabei mithelfen.“
Keine Umweltverträglichkeitsprüfung aber EU-Ausschreibung

Brandenburg hat bereits entlang der gesamten brandenburgisch-polnischen Landesgrenze zu Polen eine feste Wildschweinbarriere zum Schutz vor der ASP errichtet. Am 24. Juni 2021 hat der Landeskrisenstab außerdem die Errichtung eines ASP-Schutzkorridors beschlossen. Der Bau des zweiten Zaunes laufe, heißt es vonseiten des Verbraucherschutzministeriums. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor dem Zaunbau gebe es nicht, hatte Landestierarzt Landestierarzt Dr. Stephan Nickisch in der vergangenen Woche gegenüber der Bauernzeitung klar gestellt. Mit den Naturschutzverbänden habe man sich auf ein Wildtiermonitoring geeinigt, das parallel zum Zaunbau erfolge.
Im gestrigen Agrarausschuss räumte Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) allerdings ein, dass es Grenzen gebe, was Material und Baukapazitäten beim Zaunbau anbelangt. „Wenn es darum geht, einen zweiten Zaun an der polnischen Grenze zu errichten, haben wir das Problem, europaweite Ausschreibungen durchführen zu müssen“, so Vogel. „Das nimmt alles seine Zeit in Anspruch.“ Ausnahmen seien aber möglich, wenn Kernzonen eingezäunt werden müssen, räumte Vogel gestern ein. Insofern dürfte der Fall in der Uckermark schnell für mehr Schutz sorgen.
ASP in Brandenburg: Virus vermutlich durch kleinsäuger in den Stall gebracht
Im Agrarausschuss, in dem die ASP ein regelmäßiges Thema ist, fragten Abgeordnete zudem nach den Ursachen des Eintrags der ASP in die Hausschweinbestände. Besonders interessant der Fall in Spree-Neiße, wo ein Öko-Schweinezuchtbetrieb mit 300 Tieren betroffen war. Henrik Reinke erläuterte die Ursachenfindung in einem aufwendigen Ausschlussverfahren. Es handele sich um einen vorbildlichen Betrieb mit eingestallten Schweinen, der auch das Futter dokumentiert, so Reinke. Alle denkbaren Übertragungswege seien von Spezialisten des Friedrich-Löffler-Instituts abgeklopft worden. Am Ende sei eine Möglichkeit geblieben: Demnach hätten Kleinsäuger wie Mäuse das Virus in den Stall gebracht, so Reinke.
Agrarminister Vogel machte im Ausschuss noch einmal auf die Verantwortung des Bundes hin: Brandenburg brauche, um Schweinehalter besser zu unterstützen, für entsprechende Maßnahmen eine Notifizierung von der EU. „Wenn der Bund sich weigert, haben wir ganz schlechte Karten“, so Vogel. Die 20.000 € der De-Minimes-Regelung seien bei vielen Betrieben nach wenigen Monaten erreicht. Man brauche ein Förderprogramm für einen temporären Teilausstieg. „Was an Forderungen an den Bund formuliert werden kann, ist formuliert“, so Vogel. Aber der Bund sei bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bereit.