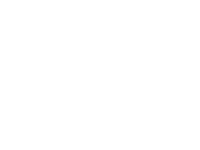Zu trockene Felder, aber glückliche Kühe
Während ausbleibender Niederschlag immer noch Thema ist, sind zwei wichtige Arbeitsprozesse im Jahreszyklus der Agrofarm Lüssow Geschichte: die Mähdruschernte und das Erstellen des neuen Anbauplans.
Nach der zurückhaltenden Ertragsprognose unmittelbar vor Erntebeginn steht nun fest, dass die Hitze und der fehlende Regen den Hauptkulturen des Betriebes nichts anhaben konnten. Mit den erreichten Ergebnissen von 86 dt/ha bei Gerste, 45 dt/ha bei Raps und 88 dt/ha bei Weizen zeigt sich Vorstandsvorsitzender Lars-Peter Loeck zufrieden. „Auch die Qualitäten passten im Großen und Ganzen. Das war so nicht zu erwarten“, sagt der Pflanzenbauer.


Unsere Top-Themen
- Herbstbestellung Raps
- Mit Schar und Scheibe
- Wasser aus dem Auspuff
- Märkte und Preise
Anbauplan: Was die Agrofarm Lüssow eG plant anzubauen
Erleichtert ist der Landwirt auch, dass er nach den jüngsten politischen Entscheidungen zu den Stilllegungsflächen endlich den Anbauplan erstellen konnte. „Kurz vor den ersten Aussaatterminen noch so im Unklaren gewesen zu sein, war ein unerträglicher Zustand. Normalerweise planen wir weit im Voraus“, berichtet Loeck. Knapp 470 ha Raps sind mittlerweile gedrillt. Weizen soll auf rund 650 ha sowohl als Konsum- und Vermehrungsware angebaut werden. Auf einer Fläche von 453 ha ist Wintergerste vorgesehen. Und 145 ha Triticale rein zum Vermehren sind ebenfalls angedacht.
Bei den Bestellarbeiten steht aktuell Weizen auf dem Programm. 170 der 650 ha Weizen sind für die frühe Aussaat geplant. Die Pflanzen haben bei der Frühsaat mehr Zeit zu wachsen. Außerdem kann Saatgut eingespart werden. „Wir setzen beim frühen Weizen wieder auf die Sorte Opal. Mit ihr sind wir im Hinblick auf Qualität und Quantität auf der sicheren Seite“, weiß Loeck. Neben Opal haben sich die Verantwortlichen in Lüssow auch für die Sorten Ponticus und Depot entschieden, die allerdings erst später gedrillt werden.
Bildergalerie: Aktuelles von der Agrofarm eG Lüssow
Bevor es ans Bestellen geht, wird der knochentrockene Boden bearbeitet. Tiefengrubber und Scheibenegge kommen auf den Feldern zum Einsatz. Die Klutenbildung und Staubentwicklung auf den Äckern sind nicht zu übersehen. Regen wird dringend benötigt. Nicht nur für den Keimprozess und damit sich der Boden erholen kann. Auch, um den aufwirbelnden Staub zu minimieren, durch den sich vorbeifahrende Autofahrer gestört fühlen. Der Chef der Agrofarm hat dafür sogar Verständnis. Deshalb sind an den Flächen des Betriebes auch Hecken zu finden. Vergeblich auf Niederschlag gewartet hat indes der Mais. Bereits die langanhaltende Trockenphase im Frühjahr hatte die Entwicklung der Pflanzen eingeschränkt. Lieferengpässe bei Pflanzenschutzmitteln und demzufolge eine nicht optimal durchgeführte Herbizidmaßnahme sorgten zudem für erhöhten Unkrautdruck.
Die Folge sind teils irreversible Dürreschäden in Form von niedrig gewachsenen und vertrockneten Pflanzen sowie gering ausgebildete Kolben. In dieser Woche starten die Lüssower mit dem Häckseln und Silieren von Mais, der auf 311 ha angebaut wurde. Lars-Peter Loeck erwartet keine gute Ernte. „Wenn ich optimistisch bin, gehe ich von 30 t/ha aus.“ Im Durchschnitt der vergangenen Jahre lag der Ertrag bei 40–42 t/ha, in Spitzenzeiten sogar bei 45 t/ha. Bei maximal einem und eher kleinen Kolben an den Pflanzen wird voraussichtlich auch die Energiedichte in der Maissilage fehlen. „Insgesamt rechnen wir beim Mais mit 25 % Verlust“, fasst Loeck zusammen. Futterengpässe zeichnen sich trotz des zu befürchtenden Ausfalles beim Mais aktuell aber nicht ab. Immerhin brachten die ersten drei Grasschnitte gute Erträge ein. Ein Silo Grassilage, was den Bedarf der Tiere für ungefähr ein halbes Jahr abdeckt, ist noch als Reserve vorhanden. Auch die Produktion von Heulageballen mit der Zielgröße von 1.000 Stück läuft nach Plan, sind doch bereits 770 eingefahren.
Auf der Suche nach Einsparpotenzialen
Auf Einsparpotenziale – wenn auch nicht beim Futter der Tiere – achten die Verantwortlichen in Lüssow dennoch. Wegen der gestiegenen Kosten im Bereich der Betriebsmittel und der möglicherweise drohenden Energiekrise. Zum Raps wurde beispielsweise nicht gepflügt, um den Dieselverbrauch zu senken. Weiterhin wurde im Betrieb innerhalb des vergangenen Jahres alles auf LED umgestellt.
Im Stall wurde kürzlich im Juni das Belüftungssystem verbessert. Die neu eingebauten Lüfter lassen sich stufenlos einstellen und regulieren ihre Aktivität aufgrund der Umgebungstemperatur automatisch und von allein. „Dieses System erhöht die Energieeffizienz und senkt damit unsere Kosten“, erläutert die stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Wencke Ladwig. Nicht nur der Geldbeutel, auch die Milchkühe freuen sich über die neuen Lüfter. Sie profitierten bereits im heißen Juli und August von mehr Komfort. So kam der Bestand gesund und gut über den Sommer und konnte die Milchleistung bei konstant hohen 38–39 Liter je Kuh halten. Ladwig hat die Werte genauestens im Blick. Ebenso wie Jessica Fibranz die Vitalität des jüngsten Zuwachses im Blick hat.
Für die Kälberfee des Betriebes, wie sie liebevoll von Vorgesetzten und Kollegen genannt wird, stehen jetzt wieder arbeitsintensivere Zeiten an. Nach einem kleinen Sommerloch nehmen die Abkalbungen wieder zu. Der gelernten Tierwirtin, die bereits ihre Ausbildung in der Agrofarm absolvierte und mittlerweile seit zehn Jahren hier tätig ist, macht das gar nichts aus. „Mit den Tieren zu arbeiten und mich um sie zu kümmern, bereitet mir noch immer viel Freude“, sagt die 26-Jährige.