Kriegstote in Brandenburg: 6.000 Pappsärge und die Last der Vergangenheit
Zwischen der politischen Auseinandersetzung um Kriegstauglichkeit und dem stillen Gedenken an vergangenes Leid steht Joachim Kozlowski. Im Osten von Brandenburg bettet er die stummen Zeugen der Schlacht um die Seelower Höhen vor 80 Jahren um. Ein Schuh, Knochensplitter – was diese Funde über das Schicksal der Kriegstoten und den Umgang mit dem Erbe des Zweiten Weltkrieges erzählen:
Beinknochen, ein Unterkiefer mit Zähnen, ein paar Stofffetzen, die Reste von einem Schuh, Splitter, die mal ein Schädel waren – Joachim Kozlowski hat die Überreste dieses Toten vor einer Woche in Georgenthal in Ostbrandenburg geborgen. An diesem Märztag liegen sie in einem kleinen grauen Pappsarg in einer Baracke neben der Kriegsgräberstätte am Rande von Lietzen bei Seelow in Ostbrandenburg. Daneben in offenen Plastiksäcken erdfeuchte Gebeine mit Anhaftungen von Baumwurzeln und Humus. Sie müssen noch trocknen, bevor Kozlowski sie reinigt, ausmisst, ihnen, wenn möglich, ihren Namen zurückgibt. So wie denen, die schon in beschrifteten Klarsichtfolientüten auf dem Arbeitstisch liegen. Joachim Kozlowski ist der einzige Umbetter, der für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Deutschland unterwegs ist – meistens in Brandenburg.

Während sich 60 km westlich von hier im politischen Berlin die Stimmen überschlagen, wenn es um die Kriegstüchtigkeit Deutschlands geht und darum, mit welchen Mitteln und mit wie viel Geld sie wiederherzustellen sei, kümmert Kozlowski sich um die Toten des vergangenen Weltkrieges, von dem sich trotz allem Geschrei immer noch die meisten Menschen wünschen, es möge der letzte gewesen sein.

© Heike Mildner
Frühjahr vor 80 Jahren
80 Jahre ist es her, dass bei der Schlacht um die Seelower Höhen vom 16. bis 19. April 1945 in nur vier Tagen 45.000 Menschen starben. Viele Tausende kommen hinzu, schließt man jene mit ein, die seit dem ersten Brückenkopf der Roten Armee über die Oder bei Kienitz am 31. Januar 1945 im Kampf um Berlin ihr Leben ließen: Deutsche und Russen, Ukrainer und Polen, Soldaten und Zivilisten, weitaus mehr Männer als Frauen. Die einen wollten die Niederlage des nationalsozialistisch regierten Deutschlands besiegeln, die anderen sollten sie verhindern. Die das nicht mehr wollten, wurden auf Befehl deutscher Offiziere als Deserteure an Straßenbäumen aufgehängt.
Die Knochen im Pappsarg sind die eines russischen Soldaten. „Sein Schädel war zertrümmert, möglicherweise wurde er erschossen“, sagt Kozlowski. 80 Jahre später wollte jemand einen Baum pflanzen und stieß beim Ausheben der Pflanzgrube auf einen Schuh mit Knochen. Polizei und Ordnungsamt wurden informiert. „Die entscheiden dann, wie es weitergeht. Das ist grundsätzlich erst mal ein toter Mensch, und wenn es ein Opfer von Krieg und Gewalt ist, dann ist es nach Gräbergesetz der Bundesrepublik Deutschland mein Auftrag, mich darum zu kümmern.“
In diesem Fall wurde Kozlowski vom Ordnungsamt beauftragt und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst begleitet. Etwa bei der Hälfte aller Fälle finden sich Waffen in der Nähe der Toten, bei diesem war es nur eine Patrone. Dass es sich um einen Rotarmisten handelt, habe er anhand der Dentalstruktur erkannt. Wie immer in so einem Fall hat Kozlowski die russische Botschaft informiert. Wahrscheinlich werden diese Gebeine in der russischen Kriegsgräberstätte in Lebus, seit 1994 der „Zubettungsfriedhof“ für Gefallene der Sowjetarmee, eingebettet.
Kowalke und Kozlowski
Zubettungsfriedhof für deutsche Kriegstote im Osten von Brandenburg ist die Kriegsgräberstätte bei Lietzen. In einer Ecke der Baracke, die Kozlowskis Arbeitsstätte ist, stehen 6.000 Pappsärge, die er in den nächsten Jahren auseinanderfalten wird, 15.000 waren es in den vergangenen 16 Jahren, eingeschlossen die Rotarmisten, Funde in Halbe und Spremberg. 2009 war Erwin Kowalke in den Ruhestand gegangen, der sich mit seiner Frau Gisela seit der Wende um würdevolle Umbettungen von Kriegstoten in Deutschland gekümmert hatte.

Vom Rettungssanitäter zum Umbetter
Bevor Kozlowski das Amt von Kowalke übernahm, bildete er bei der Bundeswehr Rettungssanitäter aus. Als solcher begleitete er damals eine zweiwöchige Ausbettungsaktion bei Schönfließ in der Nähe von Frankfurt (Oder). „Ich war für die medizinische Sicherstellung verantwortlich, für den Fall, dass irgendwas passiert im Rahmen der Ausbettung. Erwin Kowalke war der hauptamtliche Umbetter. Von ihm habe ich fast alles gelernt“, erinnert sich Kozlowski.
Kriegstote in Brandenburg: Die Suche nach den Angehörigen
Kowalke habe ihm vermittelt, dass über allem Wissen und Können – von Geschichte über Anthropologie und Anatomie, von den juristischen Grundlagen über die körperliche Arbeit bis hin zur Dokumentation, – dass über alldem der Dienst am Menschen, am einzelnen Toten und an dessen Angehörigen, steht.
Denn wenn Kozlowskis Arbeit getan ist, der Tote einen Namen hat und alle Formulare ausgefüllt sind, versucht das Bundesarchiv Berlin, dessen Angehörigen ausfindig zu machen. „Um die Angehörigen zu finden, ist es wichtig, dass sie eine Anfrage gestellt und eine aktuelle Adresse angegeben haben“, sagt Kozlowski. Das gehe ganz einfach online unter gräbersuche-online.de und gelte auch für Zehntausende Umbettungen, die der Volksbund alljährlich außerhalb von Deutschland vornimmt. Kozlowskis Brandenburger sind nur die Spitze des Eisbergs, der die deutsche Expansionswut vor 80 Jahren markiert.

Zwischen individuellem Gedenken und anonymen Gräbern
Zurück nach Lietzen. Die Kriegsgräberstätte ist zweigeteilt: Schaut man von unten den Hügel hinauf, liegen auf der linken Seite 429 Soldaten der Wehrmacht, die im Frühling 1945 von ihren Kameraden bestattet wurden. Sie haben kleine Namensschilder, auf denen Geburts- und Sterbedatum zu lesen sind. Die meisten sind junge Leute, die das Leben noch vor sich gehabt hätten, Jahrgänge 1920–1927, gerade alt genug, um in einem sinnlosen Krieg verheizt zu werden. Einer wäre am Tag nach seinem Tod 20 geworden, ein anderer ist genau an seinem 25. Geburtstag gefallen. Es sind solche Details der Kriegstoten in Brandenburg, die über den ganzen großen Irrsinn hinaus anrühren.


Zweigeteilte Kriegsgräberstätte: der Hügel mit den Kreuzen und der Friedhof mit 429 Gräbern (v. l.).
© Heike Mildner
Orientierungslos im Gräberfeld: Wo Nummern die Namen ersetzen
Auf der rechten Seite ist der Hügel kahl. Nur ein paar Steinkreuze stehen auf dem Rasen. Neben dem Weg Steine mit Nummern, die die Grabreihen kennzeichnen. Welcher Kriegstote in Brandenburg an welcher Stelle liegt, ist nur anhand eines Planes ausfindig zu machen. Ein individuelles Gedenken ist kaum mehr möglich, seitdem dieser Teil – der, auf dem die neu aufgefundenen Toten eingebettet werden – umgestaltet wurde. Deren Namen und Daten sind in große Stelen graviert, die neben einem Kreuz auf der Hügelkuppe aufgestellt wurden. Der Einzelne geht hier erneut in der Masse auf.
Wie auf anderen Friedhöfen auch spielen hier die Kosten eine größere Rolle als die Möglichkeit, den Platz des Einzelnen auszuweisen. „Wenn Angehörige kommen, die einen Brief bekommen haben, in dem zum Beispiel ‚Block 1, Reihe 7, Grab 200‘ steht, sind sie ratlos, wenden sich an mich, und ich hole dann den Plan raus“, sagt Kozlowski, den auch eine persönliche und bisher erfolglose Suche an das Thema bindet. „Ich glaube, in jeder deutschen Familie ist irgendjemand im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen, ein Bruder, ein Vater, ein Sohn …“

Sparen: Abstriche beim würdevollen Gedenken
Das zentrale Gedenken ereignet sich meist in zeitlicher Nähe zum nächsten Volkstrauertag oder zum Kriegsende, manchmal in Verbindung mit der Einbettung der ausgebetteten Toten eines Jahres. Auch hier soll möglichst gespart werden, einmal in zwei Jahren wäre aus Kostengründen besser, hat man Kozlowski wissen lassen. Ein Unding für ihn, der wie alle Christen die Toten vor Beginn der Weihnachtszeit würdig unter die Erde gebracht sehen möchte.
Kriegstote in Brandenburg: Neue Funde durch Bau von Windrädern und PV-Anlagen
Seit Windräder und Photovoltaikanlagen auf den Äckern wachsen, hat die Anzahl der Ausbettungen zugenommen. „Wir sind hier mitten in einem Kampfgebiet“, kommentiert Kozlowski, der selten weiß, wie sein nächster Arbeitstag aussieht. Montag (31.3.) fährt er zur Feststellung von Gräbern mit Euthanasieopfern nach Lüneburg, häufig ist er in Dresden. Und manchmal melden sich Zeitzeugen, die ihm sagen, wo damals Kriegstote in Brandenburg begraben wurden. Diese bekommen dann nach 80 Jahren ein Grab und vielleicht ihren Namen zurück. Was Kozlowski mit dem Blick in die Geschichte überhaupt nicht versteht: wenn Politiker, Waffenlobby und Medien den Krieg befeuern: „Es reicht nicht, sich alle paar Jahre am Volkstrauertag oder bei einer Einbettung auf den Friedhof zu stellen und zu sagen: Nie wieder Krieg!“
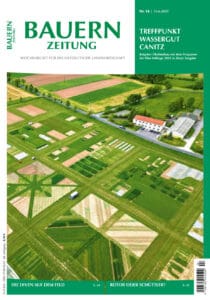
Unsere Top-Themen
- Ratgeber Ökolandbau und Ökofeldtage
- Heilpflanzen – Diven auf dem Feld
- Neue Mähdrescher im Vergleich
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!



