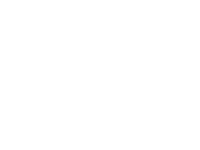In der Vergangenheit wurden Agrarbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder zum Ziel von Diebstahlshandlungen. Besonders begehrt bei den Tätern: Pflanzenschutzmittel und landwirtschaftliche Technik. Die Stehlschäden lagen dabei nicht selten im sechsstelligen Bereich. Erst im vergangenen März ließen Einbrecher in einer Firma in Ducherow Pflanzenschutzmittel für rund 50.000 Euro mitgehen.
Diebstahl von Landtechnik in Mecklenburg-Vorpommern verhindert
Nun hat die Kriminalpolizeiinspektion Anklam, nach umfangreichen Ermittlungen und mit erheblichem Kräfteansatz, einer dreiköpfigen polnischen Diebesbande das Handwerk gelegt. Über einen Zeitraum von fast zwei Wochen observierten sie die Täter und warteten geduldig auf den richtigen Moment.
In der Nacht vom 22. Juni auf den 23. Juni war es dann so weit. Die drei männlichen polnischen Tatverdächtigen im Alter von 36, 44 und 63 Jahren brachen in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Tutow ein und entwendeten landwirtschaftliches Gerät im Wert von 12.000 Euro. Beim Diebstahl der Landtechnik wurden sie von den Ermittlern beobachtet und konnten im Anschluss auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden.
Haftbefehl erlassen
Bereits am Folgetag, dem 24. Juni wurden die drei Tatverdächtigen, auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund, dem Haftrichter am Amtsgericht Stralsund vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei Männer.
Zuletzt sorgte eine andere Polizeimeldung aus Mecklenburg-Vorpommern bundesweit in mehreren Medien für Schlagzeilen. Unbekannte Täter hätten Mitte Juni tiefgekühltes Bullensperma im Wert von 30.000 Euro aus einem Milchzuchtviehbetrieb in Löcknitz-Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) gestohlen. Wenige Tage später revidierte die Polizei die Meldung wieder.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Nach der diesjährigen Gurkenernte steht das Traditionsunternehmen Spreewaldkonserve in Golßen (Brandenburg) vor einem tiefgreifenden Umbruch. Wie Geschäftsführer Till Alvermann gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt gab, werden ab Ende Oktober 200 Stammmitarbeiter und -mitarbeiterinnen ihren Arbeitsplatz verlieren. Dieser drastische Schritt sei notwendig, um das Unternehmen, das eigenen Angaben zufolge jährlich zweistellige Millionenbeträge verlor, wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen.
Umstellung auf reinen Saisonbetrieb
Alvermann zufolge ist das bisherige Geschäftsmodell der Spreewaldkonserve nicht mehr tragbar. „Wir werden uns zukünftig auf unsere Marke Spreewaldhof fokussieren und im Bereich Handelsmarke keine Sauerkonserve produzieren“, teilte auch Pressesprecherin Andrea Steinkamp auf Anfrage der Bauernzeitung mit. Konkret bedeutet dies, dass der Ganzjahresbetrieb, der bislang neben Gurken auch Rote Bete, Rotkohl und Sauerkraut produzierte, künftig zu einem reinen Saisonbetrieb für Gurken umgestellt wird.
Rettung des Standorts Golßen, Schließung in Schöneiche
Trotz des massiven Stellenabbaus betont Geschäftsführer Alvermann: „Wir stellen die Spreewaldgurke nicht infrage.“ Die Haupterntezeit für das Gemüse, das per Hand vom Feld geholt wird, ist im Juli und August, die Saison endet im Oktober.
Eine ursprünglich im Januar vorgesehene Schließung des Traditionsstandorts Golßen im Kreis Dahme-Spreewald wird es nicht geben. Stattdessen soll der nur wenige Kilometer entfernte zweite Standort in Schöneiche aufgegeben werden. „Der Standort Schöneiche wird zum Ende des Jahres geschlossen, da wir uns auf den Hauptstandort Golßen fokussieren werden. Der geplante Personalabbau von ca. 200 Personen ist darin enthalten“, so Andrea Steinkamp.
Diese Kurskorrektur erfolgte nach Protesten gegen die drohende Schließung in Golßen, in die sich auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) einschaltete. Till Alvermann, seit Dezember 2024 Geschäftsführer der Obst- und Gemüseverarbeitung Spreewaldkonserve Golßen GmbH, räumte ein: „Golßen ist die Urstätte der Spreewaldgurke. Das war mir vorher nicht bewusst, sonst hätten wir das gleich berücksichtigt.“
Spreewaldhof Golßen: Von 250 auf 30 Mitarbeiter
Auch wenn der Standort Golßen nun erhalten bleibt, ändert sich am künftigen Konzept und dem Abbau von Arbeitsplätzen nichts. Ende des Jahres werden noch etwa 60 Festangestellte beschäftigt sein, in der kommenden Saison nur noch 30. Zur Einordnung: Derzeit arbeiten circa 250 Festangestellte in Golßen. Alvermann zeigte sich jedoch optimistisch, dass die betroffenen Mitarbeiter in der Nähe neue Jobs finden werden. Für die Gurkenernte selbst werden weiterhin Saisonarbeiter eingesetzt.
Protest-Marsch mit 2000 Lichtern
Die Schließungspläne hatten seit Anfang des Jahres für viele Proteste gesorgt. So demonstrierten beispielsweise am Abend des 26. März rund 350 Menschen mit einem Lichtermarsch in Golßen gegen die Schließung des Standortes. Damit dort nicht die Lichter ausgehen, zeigten sie beim „Protest mit 2000 Lichtern“ ihre Solidarität mit den betroffenen Mitarbeitern. Die Nachricht, dass auch der Hofladen in Golßen geschlossen werden soll, sorgte für weitere Bestürzung unter den Beschäftigten.
Unterschriften-Aktion für Gurkenproduktion in Golßen
Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief für den Erhalt der Spreewälder Gurkenproduktion in Golßen auf. Um den Erhalt aller Arbeitsplätze zu fordern, hatte die NGG mit ihrem „Golßener Weckruf“ Anfang April bereits über 2.000 Unterschriften gesammelt. „Das sind mehr als wir Einwohner von Golßen haben“, so Bürgermeisterin Andrea Schulze.
„Ob in der örtlichen Bäckerei, im Sportverein oder in anderen Betrieben der Ernährungsindustrie: Überall gingen die Unterschriftenlisten herum“, teilte die NGG in einer dpa-Meldung mit. „Die Solidarität mit den Beschäftigten und der Region ist riesig!“
Golßen als „Gurkenstadt“
Die Stadt Golßen wird auch als „Gurkenstadt“ bezeichnet. Bürgermeisterin Andrea Schulze hatte nach Bekanntwerden der Umstrukturierungspläne im Januar gegenüber dem rbb gesagt: „Für die Stadt Golßen ist das ein Schock!“ Zehn Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner seien in dem Werk beschäftigt. „80 Jahre Spreewaldhof Golßen, im Prinzip kennt kein Golßener die Stadt ohne den Spreewaldhof“, so Schulz weiter.
Gurkenproduktion: Seit Jahren Verluste
Anfang Februar war die Schließung der Gurkenproduktion so begründet worden: „Wegen der schwierigen Marktbedingungen müssen wir das Geschäft strategisch neu ausrichten. Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, erklärte Geschäftsführer Till Alvermann.
Seit Jahren schreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben Verluste. Gründe dafür seien eine rückläufige Marktentwicklung, negative Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg sowie gestiegene Energie- und Rohstoffkosten. Mit der Anpassung der Produktionsstrukturen will das Unternehmen die Produktionskapazitäten an die Markterfordernisse anpassen.
Traditionsmarke „Spreewaldhof“
Die Traditionsmarke „Spreewaldhof“ ist mit ihrem Gurkensortiment ein vertrauter Anblick in den Konservenregalen Ostdeutschlands und ganz Deutschlands. Das Markensortiment bleibt für die Verbraucher unverändert. Der Spreewaldhof (Spreewaldkonserve Golßen GmbH) stellt seit fast 80 Jahren Obst-, Gemüse- und Gurkenkonserven her. Seit 2021 gehört das Unternehmen zur französischen ANDROS-Gruppe. Rund 32 verschiedene Obst- und Gemüsesorten verarbeitet das Unternehmen jährlich.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Mit einem vielfältigen Fachprogramm und so vielen Ausstellern wie noch nie haben die Öko-Feldtage erfolgreich ihre Premiere im Osten Deutschlands gegeben. Vom 18. bis 19. Juni zog das von der FiBL Projekte GmbH zum fünften Mal veranstaltete Ereignis Fachpublikum aus ganz Deutschland und darüber hinaus auf das 30 ha große Ausstellungsgelände in Wasewitz bei Wurzen. Gastgeber war das Wassergut Canitz.
Über 9.000 Besucher zählten die Veranstalter insgesamt. Besonders der erste Tag war mit mehr als 5.000 Besuchern stark frequentiert. Neben dem sächsischen Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU), der die 5. Öko-Feldtage eröffnete, und Vertretern der Öko-Verbände fanden sich auch Repräsentanten des Bauernverbandes ein. Kritisch wurde von Besuchern der zu Beginn der Veranstaltung unzureichende Shuttleverkehr vom mehrere Kilometer entfernten Parkplatz zum Veranstaltungsgelände bewertet.
Wassermanagement im Fokus der Öko-Feldtage
Zentrales Thema der Öko-Feldtage war das Wassermanagement. Aufgegriffen wurde dies in zahlreichen der insgesamt 300 Programmpunkte. Dr. Bernhard Wagner, Geschäftsführer der Wassergut Canitz GmbH, erklärte, man habe klar aufzeigen können, warum zum einen vorsorgender Wasserschutz honoriert werden sollte und zum anderen zeitnah Rahmenbedingungen für praxistaugliche Wassermanagementstrategien entwickelt werden müssten. „Wir sind dankbar dafür, dass wir unsere grundwasserschonende Wirtschaftsweise so vielen Besuchern nahebringen konnten“, so Wagner.
Auch Minister von Breitenbuch griff das Thema auf. Er kündigte Maßnahmen zur Stärkung des Niedrigwasserrisikomanagements und der öffentlichen Wasserversorgung in Sachsen an.
Rekordbeteiligung: Öko-Feldtage 2025 mit über 360 Ausstellern
Mit 362 Ausstellern erreichten die 5. Öko-Feldtage eine Rekordbeteiligung, wie Vera Bruder, Geschäftsführerin der FiBL Projekte GmbH, bemerkte. Die Veranstaltung sei auch eine Plattform des Austauschs zwischen den Produktionsweisen gewesen. Ein Viertel der Besucher wirtschafte konventionell.
Beim Sächsischen Abend am ersten Veranstaltungstag nahm Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) den Staffelstab für die nächsten Öko-Feldtage im Jahr 2027 in Empfang. Sie werden am 16. und 17. Juni 2027 auf dem Bauckhof Amelinghausen in der Lüneburger Heide stattfinden.
Bildergalerie: Impressionen von den Öko-Feldtagen 2025
Organic Future Camp (OFC): Forderungen zur Zukunft
Wie soll die Land- und Lebensmittelwirtschaft zukünftig aussehen, um ein attraktiver Arbeitsplatz zu sein und um hochwertige Lebensmittel in Einklang mit Ressourcen und Klima zu erzeugen? Über die Zukunft des Sektors wurde auf dem Organic Future Camp (OFC) mit denjenigen diskutiert, die es betrifft: 150 junge Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts, in unterschiedlichen Lebensabschnitten und aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. dem Handel, dem Klimaschutz und der landwirtschaftlichen Praxis aus ganz Deutschland. Herausgekommen sind 16 Forderungen, die in einem Forderungskatalog zusammengefasst sind. Diesen Katalog übergaben zwei Vertreter am Mittwoch (18.6.) an Dr. Burkhard Schmied vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, sowie an Thomas Land vom BÖLW und an den Landesbauernpräsident Sachsens, Torsten Krawczyk.
Öko-Feldtage 2025 in Canitz: Wasser, Tierwohl & mehr
Zwei Tage, vier Themenforen, über 60 Vorträge und Diskussionsrunden – die Öko-Feldtage 2025 warteten mit einem dichten Fachprogramm auf. Inhaltlich reichte die Palette von wassersparenden Anbaumethoden über den stressfreien Umgang mit Rindern bis hin zu Betriebskonzepten solidarischer Landwirtschaft
Erstmals war ein ostdeutscher Betrieb Gastgeber: Die Öko-Feldtage 2025 fanden auf dem Ökobetrieb Wassergut Canitz nahe Leipzig statt. 350 Ausstellende luden dazu ein, sich über neue Produkte, Dienstleistungsangebote sowie Forschungsergebnisse zu allen Themen rund um die nachhaltige Landwirtschaft zu informieren.

Die zweitägige Veranstaltung in Sachsen diente als zentrale Plattform für den Wissensaustausch zwischen Praktiker, Forschenden, Politik und Wirtschaft. Im Fokus der Innovationsschau stand die Frage, wo der Ökolandbau aktuell steht und welche zukunftsweisenden Wege er einschlägt.
Die Besucher erwartete ein vielfältiges Programm, das praktische Vorführungen und aktuelle Forschungsergebnisse aus dem ökologischen Pflanzenbau und der Öko-Tierhaltung kombinierte. Live-Demonstrationen ermöglichten es, Landmaschinen im Einsatz zu erleben, während innovative Beispiele, Prototypen und Neuentwicklungen präsentiert wurden.
Das Fachprogramm der Öko-Feldtage umfasste fast 300 Programmpunkte.
Schwerpunktthema Wasser auf den Öko-Feldtagen 2025
In vielen Programmangeboten der Öko-Feldtage 2025 spiegelte sich das diesjährige Schwerpunktthema Wasser wider, zum Beispiel bei den Führungen zum Wasserwerk Canitz wie auch auf der Sonderfläche Bewässerungstechnik. Allein 44 Beiträge und Führungen fokussierten das Thema Wasser.
Die diesjährige Gastgeberin, das Wassergut Canitz, ein Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke und aktueller Praxispartner der Bauernzeitung in Sachsen, präsentierte zusammen mit Projektpartnern, wie sich Landwirtschaft und Trinkwasserschutz in Einklang bringen lassen. An deren Stand „Treffpunkt Wassergut“ wurden praktische Maßnahmen zu wasserschutzgerechtem Ackerbau, umweltschonender Tierhaltung sowie aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt. Dazu zählten der Saugplattenversuch, der Kompostierungsstall sowie der energieeffiziente Einsatz von Landmaschinen.
Höhepunkt: Maschinenvorführungen an beiden Tagen
An beiden Tagen konnten Besucher der Öko-Feldtage, veranstaltet von der FiBL Projekte GmbH, auf Vorführflächen östlich des Veranstaltungsgeländes eine Auswahl an Maschinen im praktischen Einsatz erleben.
14 verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte waren zu sehen, im direkten Anschluss fünf Striegel. Ebenso konnten Interessierte13 Maschinen beim Hacken zwischen den Reihen begutachten, sowie vier In-Row-Hacken.
Auch vier Lösungen für die Futterbergung in Aktion wurden präsentiert. Am Nachmittag schlossen sich an beiden Tagen der von Prof. Thomas Herlitzius (TU Dresden) moderierte Rundgang „Autonome Landtechnik und Innovationsbeispiele“ an. Elf Maschinen wurden näher vorgestellt, darunter acht autonome Fahrzeuge und drei Geräte, die mit innovativen Ansätzen und unter Nutzung von KI zur Beikrautregulierung eingesetzt werden.
Ausstellende mit Innovationsbeispielen aus dem Bereich der digitalen und autonomen Landtechnik zeigten ihre Geräte an einer eigenen Vorführfläche am Stand.

Wassergut Canitz GmbH: Ökologische Landwirtschaft im Zeichen des Trinkwasserschutzes
Die Wassergut Canitz GmbH, ein Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke, wirtschaftet seit 1992 nach den strengen Richtlinien des Biolandverbandes. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 verfolgt die GmbH ein zentrales Ziel: den Schutz der wertvollen Trinkwasserressourcen im Einzugsgebiet ihrer Wasserwerke in Canitz, Thallwitz und Naunhof.
Auf einer Fläche von 850 Hektar setzt das Wassergut Canitz auf eine ökologische Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte. Dabei wird konsequent auf den Einsatz chemisch-synthetischer Düngemittel verzichtet, um jegliche Verunreinigung des Trinkwassers auszuschließen. Neben dem Schutz der Umwelt und der Förderung der Bodenfruchtbarkeit steht auch die Grundwasserneubildung im Mittelpunkt der nachhaltigen Bewirtschaftung.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Eine zuverlässige Mobilfunkversorgung ist für die moderne Landwirtschaft unerlässlich, da sie die Grundlage für digitale Anwendungen und eine vernetzte Arbeitsweise bildet. Doch gerade in ländlichen Gebieten gibt es oft Empfangsschwierigkeiten. Um die tatsächliche Netzverfügbarkeit in Deutschland zu erfassen und Funklöcher sichtbar zu machen, fand vom 26. Mai bis zum 1. Juni die erste Mobilfunk-Messwoche statt.
„Die Messwoche war ein großer Erfolg. Unser herzliches Dankeschön geht an alle, die sich daran beteiligt haben. Mit den Messungen konnten wir unsere Daten um etwa 145 Millionen neue Messpunkte erweitern. Damit bekommen wir ein aktuelles Bild der Mobilfunkversorgung aus Nutzerperspektive für Deutschland“, freut sich Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.
Funklöcher: Ergebnisse der Mobilfunk-Messwoche 2025
Über 150.000 Nutzerinnen und Nutzer haben während der Messwoche mit der Funkloch-App der Bundesnetzagentur Messpunkte erfasst. Der überwiegende Anteil der Messungen (rund 98 Prozent) entfiel dabei auf die modernen 4G- und 5G-Technologien. Lediglich etwas mehr als ein Prozent der Messpunkte bezogen sich auf 2G, und in weniger als einem Prozent der Fälle wurde von den Nutzern gar keine Versorgung festgestellt. Die meisten Messpunkte wurden erwartungsgemäß im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erhoben.
Tabelle: Mobilfunk-Messwoche-2025 Netzverfügbarkeit
| Bundesland | Anzahl valide Messpunkte |
|---|---|
| Bundesweit | 145.800.991 |
| Baden-Württemberg | 22.514.566 |
| Bayern | 22.494.146 |
| Berlin | 2.028.480 |
| Brandenburg | 7.349.451 |
| Bremen | 607.531 |
| Hamburg | 1.366.056 |
| Hessen | 10.689.707 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.846.519 |
| Niedersachsen | 17.558.024 |
| Nordrhein-Westfalen | 32.755.805 |
| Rheinland-Pfalz | 8.782.189 |
| Saarland | 1.145.157 |
| Sachsen | 4.275.788 |
| Sachsen-Anhalt | 3.119.996 |
| Schleswig-Holstein | 4.548.325 |
| Thüringen | 2.719.251 |
| Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/ |
Regionale Auswertung online einsehbar
Gerade für die Landwirtschaft sind detaillierte regionale Daten von hohem Interesse. Grafiken und Tabellen für die regionale Auswertungen auf Ebene der Landkreise und Gemeinden sind online einsehbar. Diese Daten werden es ermöglichen, die Mobilfunkversorgung in spezifischen Agrarregionen genauer zu beleuchten.
Mobilfunk-Messwoche: So werden die Daten genutzt
Die über die App „Breitbandmessung” der Bundesnetzagentur erfassten Messpunkte fließen anonymisiert in die interaktive Funklochkarte der Bundesnetzagentur ein. Diese wird wöchentlich aktualisiert. Die Karte zeigt, wie Nutzerinnen und Nutzer das Mobilfunknetz erleben und ermöglicht eine Filterung nach Regionen.
Die Bundesnetzagentur nutzt die erhobenen Daten außerdem, um die von den Mobilfunkanbietern im Rahmen des Mobilfunk-Monitorings gemachten Angaben zu überprüfen. Dadurch wird eine objektive Kontrolle der tatsächlichen Netzabdeckung gewährleistet.
Weitere Informationen zur Breitbandmessung und zur Funkloch-App sowie die interaktive Karte sind auf der Internetseite verfügbar. Die Daten zum Mobilfunk-Monitoring können hier eingesehen werden.
Weitere Informationen zur App und zur Mobilfunk-Messwoche gibt es hier.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Aktuell sind die Ertragsaussichten in Sachsen gut – die Erwartungen an die Zuckerrübenpreise aber eher verhalten: Mit Blick auf die kommende Kampagne haben sich Zuckerrübenerzeuger aus der Oberlausitz (Sachsen) mit Vertretern der Zuckerfabrik Dobrovice und der Agro Service GmbH Niedercunnersdorf am Rand eines Zuckerrübenschlags in Mauschwitz bei Löbau getroffen und ausgetauscht.
Mit Mindestpreis nur eine „schwarze Null“
Vertraglich zugesichert hat das tschechische Zuckerunternehmen Tereos TTD den Landwirten für diese Anbausaison einen Mindestpreis von 675 tschechischen Kronen (Kč) je Tonne Rüben, das entspricht in etwa 27,20 €/t. Basis für die zugrunde gelegte Menge ist ein standardisierter Zuckergehalt von 16 %. Hinzu kommen zwar noch diverse Boni und Zuschläge. Doch im Vorjahr lag allein der Garantiepreis noch bei 920 Kč/t. Bliebe es beim aktuellen Garantiepreis, werde man mit dem Rübenanbau im Ergebnis wohl nur bei einer schwarzen Null herauskommen, wie vor Ort von Landwirten zu hören war.
Wettbewerb am Zuckermarkt: Polnische Anbieter und Südzucker drücken Preise
Etwas Hoffnung, wenn auch mit Einschränkungen, machte Karel Chalupný, agronomischer Direktor beim tschechischen Zuckerunternehmen Tereos TTD, den Oberlausitzer Zuckerrübenanbauern. Seit vergangenem Herbst sei der Zuckerpreis um 40 % gesunken, sagte er. Zwischenzeitlich habe man Zuckerpreise von 500 €/t gesehen, inzwischen stabilisiere sich der Markt jedoch. Vom Ziel, Zucker zu 600 €/t verkaufen zu können, sei man jedoch noch entfernt, so Chalubný. Bei Ausschreibungen der Industrie würden in der Regel polnische Anbieter oder auch Südzucker die Preise derzeit unterbieten.

Ukraine-Importe fluten EU-Markt: Darum fällt der Zuckerpreis
Trotz des zuletzt mit Verlusten verbundenen Zuckergeschäfts schließe Tereos das zurückliegende Wirtschaftsjahr mit einem guten Ergebnis ab, doch liege dies lediglich bei einem Drittel des Wirtschaftsjahres 2022/23.
Grund für den großen Preisverlust sei die große Menge ukrainischen Zuckers gewesen, die in die EU floss. Vor dem Krieg habe es eine Quote von 20.000 t Zucker aus der Ukraine gegeben. Durch Aufhebung des Kontingents seien in den Jahren 2022/23 hingegen rund 900.000 t in die EU geflossen.
Dieser Zucker sei jedoch unter völlig anderen Umwelt- und Sozialstandards als in der EU erzeugt worden, sowohl bei der landwirtschaftlichen Produktion der Zuckerrüben als auch bei der Verarbeitung in der Fabrik, verdeutlichte Chalubný. Vorgesehen ist, das zollfreie Einfuhrkontingent wieder auf 20.000 t Zucker zu begrenzen. Dies sorge für Entspannung. Zudem habe man zuletzt nicht mehr den erwarteten Marktdruck erlebt, weil die Ukraine offenbar alte Verkaufskanäle offen halten und Zucker nach Libyen und in die Türkei verkaufen konnte.
Ertragsprognose Zuckerrüben: Gute Bestände, unsichere Preise
Chalubný sagte, er hoffe, dass Tereos TTD den Landwirten letztlich mehr zahlen könne als den in den Verträgen fixierten Mindestpreis. Anders als die tschechischen Anbauer, die ihre Anbaufläche um insgesamt 12 % reduziert haben, hätten die Rübenanbauer aus Sachsen ihre Fläche etwas ausgedehnt. Auf etwas mehr als 2.300 ha wachsen Zuckerrüben für die Fabrik in Dobrovice. Dies werde allerdings auch Druck aufbauen, dass die Logistik nahtlos funktioniert und man sich eng abstimmt.
Die erste Probennahme werde Anfang August erfolgen, dann würden die Abfuhrtermine geplant und den Betrieben mitgeteilt. Eine Kampagne wie die letzte, die bis zum 20. Februar und damit 142 Tage dauerte, werde es in diesem Jahr mit Sicherheit nicht geben, wie der agronomische Direktor versicherte.
Die Ernteerträge könnten indes denen des Vorjahres ähneln. Aktuell stünden die Zuckerrüben gut im Feld. Die Trockenheit im April habe sich noch nicht auf die Rübe ausgewirkt, später hätte es immer mal wieder Niederschläge und zudem kühle Nächte gegeben. Dass man – Stand heute – wieder in die Nähe der 83 t/ha vom letzten Jahr komme, sei nicht ausgeschlossen, sagten Rübenerzeuger beim Feldtag. Allerdings müsse dafür das Wetter auch im Juli und August passen.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Patrick Lukat kann es kaum erwarten. Der 40-Jährige hat schon mal in der Fahrerkabine Platz genommen, studiert das mit reichlich Technik ausgestattete Cockpit des Feldhäckslers. Manches ist ihm vertraut, manches aber nicht. Mit dem Vorgängermodell sei er gut zurechtgekommen, verrät er. Aber das hier sei doch einen ganzen Zacken größer, moderner und anspruchsvoller. „Ich bin mächtig gespannt auf den ersten Einsatz!“

Claas Jaguar Terra Trac: Technik für schonende Grünlandpflege
Zusammen mit Patrick Lukat sind Marlene Bukowski und Enrico Voigt von der Agrargenossenschaft Gülpe sowie weitere Mitarbeiter an diesem sonnigen, doch kühlen Maitag nach Rhinow gekommen. Hier in der Niederlassung der Brandenburger Landtechnik GmbH wartet die neueste Anschaffung des Betriebes auf ihre Übernahme, ein mit dem Terra-Trac-Raupenlaufwerk ausgestatteter Häcksler der Firma Claas mit dem verheißungsvollen Namen Jaguar. Dieser steht wie kein anderer für eine boden- und grünlandschonende Befahrung, versichert BLT-Niederlassungsleiter Christian Pasemann. „Eine Besonderheit ist die automatische Vorgewendeschonung dank verringerter Raupenaufstandsfläche. Dies sorgt bei Kurvenfahrten oder beim Wenden dafür, die Grasnarbe zu schützen.“ Zur Ausstattung der eigenständig agierenden Maschine gehören ein Tempomat sowie eine Anlage, die den Reifendruck der Hinterräder regelt.
Herausforderungen an der Havel: Landwirtschaft und Naturschutz
Die innovative und mehr als 650 PS starke Technik kommt der im Westhavelland unter schwierigen Bedingungen wirtschaftenden Agrargenossenschaft Gülpe sehr zugute. Denn bei ihren rund 800 ha Grünland handelt es sich zumeist um Moorflächen, erklärt Enrico Voigt, geschäftsführender Vorstand. „Diese Flächen stehen die meiste Zeit des Jahres unter Wasser und sind kaum befahrbar. Aber wenn wir sie bewirtschaften, kann sich Wurzelmasse entwickeln, die wiederum den Mooraufbau fördert.“ 740 ha vom Grünland befinden sich zudem in Naturschutzgebieten. Damit sind besondere Auflagen verbunden, beispielweise späte Mahdtermine zum Schutz der Wiesenbrüter.
Für seinen Betrieb, der mehr als 40 Frauen und Männer aus der Region Arbeit gibt und sich neben dem Feldbau auch der Haltung von 200 Mutterkühen und 50 Sauen verschrieben hat, ist der nachhaltige Umgang mit dem Boden entscheidend für den weiteren Fortbestand des Unternehmens. Weil es nicht mehr möglich war, schwarze Zahlen mit der Milchproduktion zu schreiben, war vor einiger Zeit dieser Erwerbszweig aufgegeben worden. Zwar betreibt die Genossenschaft eine funktionierende Direktvermarktung und unterhält zwei Hofläden, doch auch die Erlöse aus dem Feldbau lassen viele Wünsche offen. Wer Landwirtschaft an der Unteren Havel und am Gülper See betreibt, muss mit vielen Unwägbarkeiten rechnen.
Enrico Voigt: „Wir verstehen, dass gerade bei der immer extremer werdenden Trockenheit Wasser in der Landschaft gehalten und bei Bedarf zurückgestaut wird. Aber wir müssen doch auf die Flächen kommen, um unsere Naturschutzverträge einhalten zu können.“
Landtechnik für Moorflächen dank Förderung
Vorstand Voigt räumt ein, dass es nicht leichtfiel, in die neue, noch dazu sehr teure Technik zu investieren. Denn dafür ist eine satte Summe im sechsstelligen Bereich zu berappen. Eine Chance bot sich mit dem vom Land aufgelegten Förderprogramm, das unter anderem Investitionen in Landtechnik zum Bewirtschaften von Moorflächen bezuschusst. In diesem Falle waren es gar 80 Prozent, die Potsdam beisteuert. Doch zwischen der Idee, sich dafür zu bewerben, und dem Zuschlag lagen gut anderthalb Jahre. „Wir haben uns gründlich beraten lassen, ehe wir die Entscheidung trafen, uns am Ausschreibungsverfahren zu beteiligen“, berichtet Voigt. Und Marlene Bukowski, seit sieben Jahren im Betrieb, hätte sich sehr engagiert durch den Antragsdschungel gekämpft. Die junge Frau winkt ab. „Dafür habe ich ja studiert.“
Wirtschaftlichkeit und Moorschutz: Innovative Technik im Einsatz
Insofern ist der Übergabetermin der Landtechnik für die Bewirtschaftung der Moorflächen in Rhinow ein Anlass zur Freude, ohne jedoch in Euphorie zu verfallen. Niederlassungsleiter Pasemann wünscht dem Team der Gülper Genossenschaft viel Erfolg „und dem Jaguar viel Futter“. Es freue ihn sehr, dass der Betrieb vom Moorinvestitionsförderprogramm profitieren könne, betont Landtagsabgeordneter Johannes Funke. Er informiert darüber, dass am Vormittag in Groß Kreutz der Grundstein für ein neues Forschungszentrum zur Verwertung von Biomasse gelegt wurde. Denn das „Naturschutz- und Landschaftspflegematerial aus Feuchtwiesengräsern“, wie es im Fachjargon so sperrig heißt, birgt ein großes Potenzial.
Wenige Tage nach der Übergabe konnten die Gülpener in Rhinow den Häcksler noch mit einem Direktschneidwerk komplettieren. Es kommt zum Einsatz, wenn der Feuchtegehalt stimmt und kann somit weitere Arbeitsschritte einsparen. So lassen sich Wirtschaftlichkeit und Moorschutz noch besser verbinden.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Regionale Neuigkeiten erfahren
Nachrichten aus der Landwirtschaft in Ostdeutschland
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Ende letzten Jahres gab es nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie deutschlandweit fast 29.000 Windkraftanlagen an Land, davon rund 10.400 im Osten. Die installierte Leistung summierte sich auf 63.461 MW (Ost: 21.511 MW). Der Zubau einschließlich Repowering betrug 2024 bundesweit 635 Anlagen (Ost: 144) bzw. 3.250 MW (Ost: 770 MW) – aufgrund der Stilllegung älterer Anlagen kamen unterm Strich bundesweit tatsächlich nur 80 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2.545 MW hinzu. Brandenburg und Sachsen-Anhalt zählen bei der installierten Leistung zu den Top-fünf-Bundesländern.
Windkraftausbau in Ostdeutschland – eine hochemotionale Angelegenheit
Im ländlichen Raum, wo der Windkraftausbau stattfindet, war, ist und bleibt die Errichtung von Anlagen eine hochemotionale Angelegenheit – für Bewirtschafter von Flächen und für Flächeneigentümer insbesondere. Die vormalige Bundesregierung verabschiedete 2023 das „Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz – WindBG)“, das die Bundesländer bei der Ausweisung von neuen Flächen für Windenergieanlagen (WEA) unter Zugzwang setzte.
Windräder in Ostdeutschland: Länder unter Zugzwang
Das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz verpflichtet die Länder, bis Ende 2027 bis zu 1,8 % und bis Ende 2032 bis zu 2,2 % ihrer Landesfläche für die baurechtlich privilegierte Errichtung von WEA auszuweisen (Tabelle). Ziel war es, den Ausbau der Windenergie massiv zu beschleunigen.

Mit dem Regierungswechsel in Berlin dürfte sich an den Zielvorgaben zum Windkraftausbau in Ostdeutschland grundsätzlich nichts ändern. Bislang war zu vernehmen, dass lediglich die Flächenziele für das Jahr 2032 auf den Prüfstand gestellt werden könnten. Dies forderte zuletzt etwa die Thüringer CDU, die mit BSW und SPD im Freistaat die Regierung stellt.
Windvorranggebiete: Wo der Ausbau stattfindet
Derweil laufen die aufwendigen Planungen in den Ländern zur Ausweisung der Windvorranggebiete auf Hochtouren. Während Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen den Flächenanteil in ihren regionalen Planungsregionen gleichmäßig verteilen, sind die Vorgaben des Landes für die Regionalpläne in Sachsen-Anhalt und Thüringen nach Potenzialen abgestuft worden.
Für Thüringen heißt das etwa, dass die Region Nordthüringen bis Ende 2027 2,5 % (bis 2032: 3,0 %) ihrer Fläche als Windvorranggebiete ausweisen muss, Mittelthüringen 1,8 % (2,2 %), Südwestthüringen 1,7 % (2,0 %) und Ostthüringen 1,4 % (1,7 %). Angesichts der bisherigen Pläne lässt sich erahnen, was auf die ländlichen Gebiete nicht nur in Thüringen in naher Zukunft zukommt.
Zugleich gilt es zu betonen, dass nicht überall, wo für den Windkraftausbau in Ostdeutschland ein Vorranggebiet ausgewiesen wird oder ist, WEA installiert werden. Dem Bericht des „Bund-Länder-Kooperationsausschusses zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien“ vom Oktober 2024 zufolge waren Ende 2023 von den nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz/WindBG anrechenbaren 230.451 ha in Deutschland 36 % noch nicht mit WEA (voll) belegt.
Windräder in Ostdeutschland: Leipzig-Westsachsen plant Ausbau auf über 8.300 ha
Die vormalige Landesregierung in Sachsen gab das Ziel heraus, dass die vier Planungsregionen ihre WEA-Flächenziele von 2 % nicht erst 2032, sondern bereits 2027 erfüllen werden. Aktuell läuft für den Regionalplan Leipzig-Westsachsen die öffentliche Anhörung für die „Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“. 91 Vorranggebiete mit 8.371,68 ha Fläche listet der Entwurf auf. Damit käme die Region auf einen Anteil von 2,1 % ihrer Fläche. In der Planungsregion Chemnitz hat man jetzt den Suchraum auf 4,6 % der Regionsfläche eingegrenzt. Im nächsten Schritt geht es darum, in diesen Gebieten die Vorrangflächen zu ermitteln.
Streit in Thüringen: Windräder (nicht) im Wald
In der Nordthüringer Planungsregion liegt seit der vorigen Woche ein Entwurf über fast 10.000 ha Vorrangflächen vor. Die Ostthüringer Planungsregion veröffentlichte in der ersten Juniwoche den ersten Entwurf zum „Sachlichen Teilplan Windenergie und Sicherung des Kulturerbes“. Dieser nennt in 67 Gemeinden WEA-Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von 7.430 ha. Davon betreffen 4.164 ha Forstflächen bzw. „überwiegend“ Forstflächen. Letzteres ist für Thüringen von besonderer Bedeutung, weil die regierungstragenden Brombeer-Fraktionen Windräder im Wald ablehnen. In der vorhergehenden Legislatur wurden im Landeswaldgesetz auf Druck der seinerzeit oppositionellen CDU-Fraktion große Hürden für die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald erlassen.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Sie posten beim Melken um 5 Uhr morgens, filmen die Getreideernte live vom Mähdrescher oder zeigen, was wirklich hinter „Tierwohl“ steckt: Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte gehen in die Offensive – mit Social Media.
Was vor wenigen Jahren noch belächelt wurde, ist heute ein wertvolles Werkzeug für mehr Transparenz, Dialog und Direktvermarktung. Ein Werkzeug, das dank Smartphone in jede Hosentasche passt. Laut einer Bitkom-Studie aus dem Jahr 2024 sind 28 % der landwirtschaftlichen Betriebe in den sozialen Medien aktiv. 2022 waren es 19 %. Damit liegen die sozialen Medien sogar knapp vor der eigenen Website, die 2024 von einem Viertel (25 %) der Betriebe genutzt wurde.
Nutzung von Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp und YouTube
Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp und YouTube dienen längst nicht nur der Unterhaltung und Information nach Feierabend. Sie sind mittlerweile auch das digitale Sprachrohr der Branche. Landwirte präsentieren mittels Social Media ihre Arbeit, entkräften Vorurteile und zeigen, wie moderne Landwirtschaft wirklich aussieht.
Social Media ermöglichen es, unkompliziert und niedrigschwellig Einblicke in die Landwirtschaft, insbesondere in den Alltag und die Produktionsbedingungen zu geben. Anstatt über die Landwirtschaft zu reden, reden Landwirte selbst – und das direkt, authentisch und ja, auch ungeschönt in die Kamera. Denn auch das ist Landwirtschaft: dreckige Maschinen, matschige Wege und frisch geborene Kälber. Hier wird geackert – und das darf auch gern jeder sehen: Authentizität schlägt Hochglanz.

© Zoran Zeremski/STOCK.ADOBE.COM
Hürden und Herausforderungen
Natürlich bringt Social Media auch Arbeit mit sich: Es müssen Inhalte geplant, Kommentare beantwortet, Videos gedreht und technische Hürden überwunden werden. Und nicht jedem gefällt es, auf der digitalen Bühne zu stehen. Doch diejenigen, die den Schritt gewagt und die digitale Stalltür geöffnet haben, berichten von neuem Selbstbewusstsein. Beim Austausch mit Berufskollegen erleben sie gegenseitige Inspiration. Außerdem berichten sie von mehr Wertschätzung und Interesse bei Verbrauchern.
Direktvermarktung: Vermarktung mit Mehrwert
Social Media hat mehr zu bieten als nur Selfies und Tanzvideos. Wer die richtigen Kanäle nutzt, kann mit wenigen Klicks eine breite Öffentlichkeit erreichen, für Transparenz sorgen und neue Vermarktungswege erschließen. Gerade für Direktvermarkter kann sich der Online-Auftritt deshalb auch wirtschaftlich lohnen. Immer mehr Betriebe vermarkten ihre Produkte inzwischen direkt über soziale Kanäle. Egal, ob Weihnachtsgans, Bio-Kiste oder Landpartie: Wer sichtbar ist, wird besucht, gebucht und verkauft. Kunden schätzen Nähe und Transparenz. Mit Social Media kann dies gelingen.
Tipps für einen erfolgreichen Start: Warum nicht jeder Landwirt gleich auf TikTok tanzen muss
Ob für Image, Aufklärung oder Absatz: Social Media ist längst ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft. Und die kann jeder und jede selbst gestalten – vom kleinen Familienbetrieb bis zur großen Agrargenossenschaft. Alles, was man dazu benötigt, sind ein Smartphone mit Empfang und das richtige „Werkzeug“.
Eine, die echte Bauernschläue, aber digital vermittelt, ist Social-Media-Expertin Maja Mogwitz. Sie ist studierte Agrarwirtin und berät landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen bei ihrem digitalen Auftritt. Ihre drei wichtigsten Tipps für den erfolgreichen Start:

1. Freude haben und authentisch bleiben
Der erste Schritt ist kein Posting, kein Tweet und kein Video, sondern eine Entscheidung: Was will ich mit Social Media erreichen und wer soll mir zuhören? Wichtig: Unbedingt zuerst auf sich selbst schauen. Welche Plattform gefällt mir? Wie viel Zeit habe ich? „Man muss Spaß haben und authentisch bleiben, sonst wird man nicht erfolgreich.“ Niemand muss zwingend auf TikTok tanzen.
2. Jede Plattform hat ihre eigene Zielgruppe
Wer Ausbildungsplätze vergeben oder junge Mitarbeiter gewinnen möchte, ist auf Instagram und TikTok richtig. Hier sind viele junge Menschen und Familien unterwegs, die sich auch mit Lebensmitteln und deren Produktion auseinandersetzen. Mit Stories und Reels (kurzen Videos) kann man schnell authentische Einblicke in den Arbeitsalltag geben. Erfahrung in Kameraführung, Videodreh und Bildschnitt ist nicht notwendig.
Wer Direktvermarktung betreibt und eine regionale Kundschaft sucht, erreicht auf Facebook eine ältere Zielgruppe (über 40/50 Jahre). In den Gruppen, den digitalen Treffpunkten, tauschen sich Menschen mit gemeinsamen Interessen aus. Es gibt regionale Gruppen, in denen Direktvermarkter aktuelle Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten teilen können.
Wer sich mit Kollegen aus der Branche vernetzen oder austauschen möchte, ist auf X (ehemals Twitter) oder LinkedIn gut aufgehoben. Wer Freude am Videodreh und -schnitt hat, kann die weltweit größte Videoplattform YouTube nutzen.
3. Nicht auf allen Plattformen gleichzeitig starten
„Social Media kostet Zeit. Es ist ein sozialer Ort. Hinter den Accounts stecken echte Menschen. Diese stellen Fragen, kontaktieren einen. Man tut sich keinen Gefallen, wenn diese Fragen ins Leere laufen, weil man den Überblick verliert. Lieber auf eine oder zwei Plattformen konzentrieren und diese mit Zeit und Leidenschaft pflegen.“
Social-Media-Praxis-Checkliste
Social Media ist ein starkes Werkzeug, um Einblicke in die Landwirtschaft zu geben, Transparenz zu schaffen, Kunden zu erreichen und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Doch wo fängt man an? Unsere Praxis-Checkliste führt Schritt für Schritt vom Stall und Acker direkt ins Netz:
1. Ziele festlegen
■ Öffentlichkeitsarbeit & Aufklärung
■ Direktvermarktung & Kundenbindung
■ Nachwuchs/ Mitarbeiter gewinnen
■ Netzwerk & Austausch
■ …
Tipp: Nur ein bis zwei Ziele auswählen, um Fokus und Motivation zu bewahren.
2. Zielgruppe definieren
■ Wen will ich erreichen (Verbraucher, Kunden, Kollegen)
■ Was interessiert meine Zielgruppe?
Tipp: Mit Instagram-Umfragen kann man die Zielgruppe besser kennenlernen.
3. Kanal auswählen
■ Instagram (visuell, Storytelling, jüngere Zielgruppe)
■ Facebook (lokale Vernetzung, ältere Zielgruppe)
■ YouTube (längere Videos, Hintergrundwissen, Tutorials zu Landtechnik etc.)
■ TikTok (kurze, unterhaltsame Clips, jüngere Zielgruppe)
■ LinkedIn (berufliche Vernetzung)
4. Profil einrichten
■ eingängiger, wiedererkennbarer Profilname (Name des Hofes, Betriebes)
■ Profilbild (Logo, Person, Betrieb)
■ Kurzbeschreibung/Bio mit Ortsangabe, Schwerpunkt)
■ Kontaktdaten
■ ggf. Link zur Website
5. Content-Plan erstellen
■ Was will ich zeigen? (Alltag, Maschinen, Tiere, Ernte, Produkte)
■ Wie oft möchte ich posten? (2–3 x pro Woche)
■ Kategorien festlegen (#Feldtag, #Ernte)
6. Erste Inhalte vorbereiten
■ Themenideen sammeln
■ Fotos und/oder Videos erstellen
Tipp: Nicht nur Fakten erzählen, sondern Emotionen durch Geschichten wecken.
7. Postings gestalten
■ klare, kurze Sätze
■ Emojis und Hashtags gezielt einsetzen (#regional, #Landwirtschaft)
■ Call-to-Action einbauen („Was meint ihr?“)
Tipp: Auf Alltagssprache achten, nicht zu viele Fachbegriffe nutzen.
8. Community aufbauen
■ Kommentare zeitnah beantworten
■ anderen Landwirten folgen
■ eigene Beiträge erstellen, auf andere Beiträge reagieren
■ persönlich und authentisch bleiben
9. Rechtliches beachten
■ Urheberrechte bei Bildern und Musik beachten
■ vor dem Fotografieren um Erlaubnis fragen
■ Werbung & Kooperationen kennzeichnen
■ Impressum verlinken (z. B. über Linktree)
10. Dranbleiben & lernen
■ regelmäßig posten
■ Statistiken auswerten (Was kommt gut an?)
■ Feedback einholen (Umfragen)
■ von anderen lernen
■ Spaß haben

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein
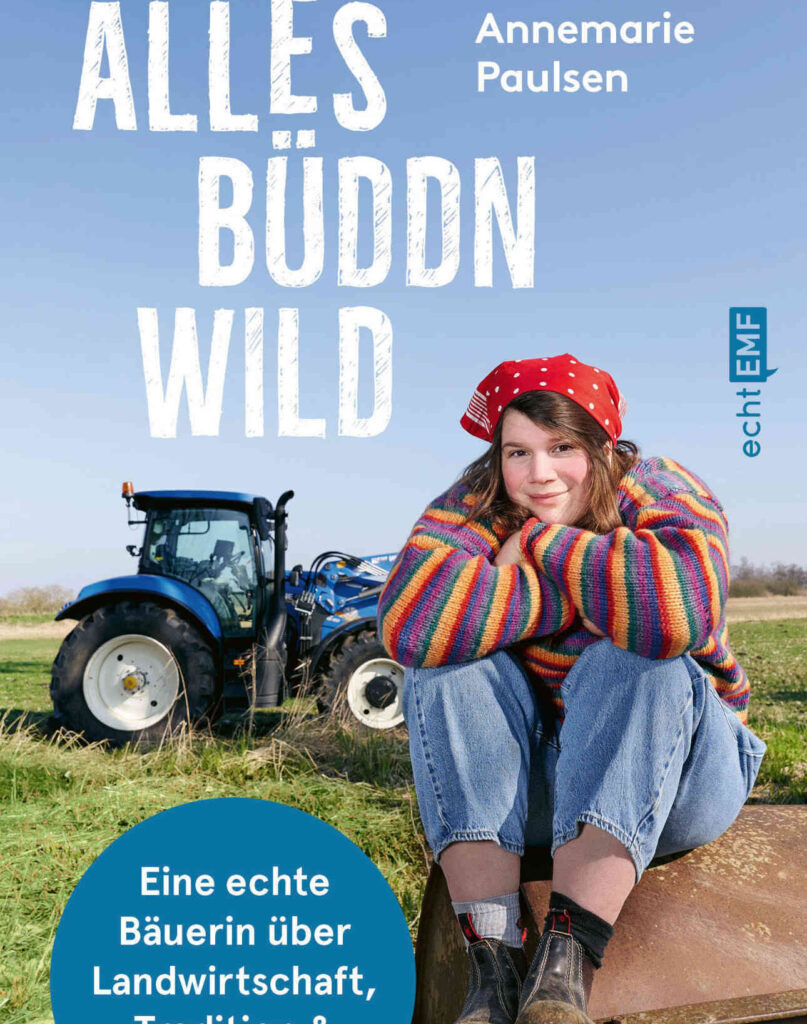
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Es ist in dieser Dimension ein bisher einmaliges Projekt: Die Dresdner Vorgebirgs Agrar AG hat in Kleincarsdorf bei Kreischa ihren „Dresdner Kuhgarten“ in Betrieb genommen. Im Beisein von Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) feierte der Betrieb die offizielle Eröffnung des neuen Milchviehstalls, der Maßstäbe für eine moderne Tierhaltung setzt und Platz für bis zu 630 Kühe bietet.
Niederländisches Konzept: Die Weide in den Stall bringen
Das aus den Niederlanden stammende Kuhgarten-Konzept beruht auf dem Gedanken, im Stall Weidebedingungen nachzuempfinden. Der sogenannte Serre-Stall des niederländischen Anbieters ID Agro ist an den Seiten offen und wird von einer besonderen Konstruktion mit Doppelmembrandach bedeckt. Dadurch wird ein optimales Stallklima mit Frischluft und Tageslicht ermöglicht. Ein spezieller Fußboden, der „High Welfare Floor“ von ID Agro, ist weich und feuchtigkeitsdurchlässig. Urin und Kot werden dadurch getrennt, was Ammoniak-Emissionen vermindert. Mehrere Entmistungsroboter, die im Stall im Einsatz sind, entfernen die Festbestandteile. Aus der abgeschiedenen Flüssigkeit könne perspektivisch Flüssigdünger gewonnen werden, wie Vorstandsvorsitzender Ingolf Schulze erklärt. Das Konzept eines Kuhgartens ist bisher nur einmal und in deutlich kleinerem Maßstab in den Niederlanden umgesetzt worden.
Im Kuhgarten in Kreischa füttern, misten und melken Roboter
Robotik wird im Kuhgarten Kreischa auch für die Fütterung und für das Melken eingesetzt. Neun Melkroboter Lely Astronaut A5 sind im Stall installiert. Die Fütterungsroboter korrespondieren miteinander, sodass den Tieren jederzeit ausreichend Futter vorgelegt wird.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Kuhgartens sind die im Stall verteilten Bepflanzungsinseln mit Bäumen und Sträuchern, die ebenfalls zur Klimaverbesserung beitragen. Man habe sich bei der Auswahl auf Arten orientiert, die auch in der Stadtbegrünung Anwendung finden, mit Schatten klarkommen und nicht zu mächtig werden, etwa Hainbuchen, Felsenbirnen oder Zimtapfel, so Vorstand Lutz Müller.
Jeder Kuh stehen zwölf Quadratmeter zur Verfügung
In dem Kuhgarten in Kreischa mit einer Grundfläche von 140 mal 70 Meter steht jedem Tier Platz von 12 m2 zur Verfügung. Die Möglichkeit des Weidegangs ist ebenfalls vorhanden sein und wird derzeit für alle Tiere ermöglicht. Damit entspricht der Standard der Haltungsstufe 4. Entsprechend werde man auch die Milch vermarkten, so Ingolf Schulze. Zum diesen Zweck hat man die Heinrichsthaler Milchwerke als Partner gewonnen.
Die ersten Kühe wurden Anfang Mai eingestallt. Für den Bestandsaufbau habe man auf Zukäufe von der Agrargenossenschaft Oberes Elbtal Reinhardtsdorf zurückgegriffen, von der man hochwertiges Milchvieh beziehen konnte, wie der Vorstandsvorsitzende betont. Die guten Haltungsbedingungen zahlten sich bereits aus, was sich in Tagesleistungen von 40 Litern je Kuh widerspiegele.
Juristische Einsprüche verzögerten den Kuhgarten in Kreischa
Die 2018/19 mit den ersten Planungen begonnene Realisierung des Kuhgartens in Kreischa hatte sich durch juristische Einsprüche immer wieder verzögert. Infolgedessen musste am alten Standort in Obernaundorf noch einmal Geld in Größenordnungen investiert werden, um die Milchproduktion aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund wird der alte Stall entgegen der ursprünglichen Absicht vorerst weiterbetrieben.
In den Kuhgarten selbst investierte die Dresdner Vorgebirgs Agrar AG 13 Mio. Euro. Laut sächsischem Landwirtschaftsministerium förderte der Freistaat das Vorhaben über die Förderrichtlinie „Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer“ mit rund 6,9 Mio. Euro. Es sei die größte Investition in der 1991 begonnenen Unternehmensgeschichte, so Ingolf Schulze. Während viele Betriebe in den vergangenen Jahren die Tierhaltung zurückgefahren hätten, gehe man den entgegengesetzten Weg. Dazu habe man sich entschlossen, etwas Neues und Richtungsweisendes zu schaffen.
Minister lobt Mut des Betriebes und innovatives Stallkonzept
Diese Entscheidung fand auch seitens des Landwirtschaftsministers Anerkennung. Mit dem Kuhgarten in Kreischa zeige die Dresdner Vorgebirgs Agrar AG, dass es Betriebe gebe, die den Mut haben, neue Wege zu gehen, und Durchhaltewillen zeigen, sagte er während der Eröffnung. „Dieser Stall ist eine zukunftsweisende Verbindung von Tierwohl, Digitalisierung, Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und Hygiene“, so der Minister. Er hoffe, dass dies auch die bisherigen Kritiker überzeuge.
Abgeschlossen sind die Pläne der Dresdner Vorgebirgs Agrar AG am Standort noch nicht. Über den neben dem Technikstützpunkt in Kleincarsdorf entstanden „Dresdner Kuhgarten“ hinaus will der Agrarbetrieb noch einen Kälberstall errichten. Dabei werde man sich wieder auf innovative Ansätze orientieren und dieses Mal dem CO2-Fußabdruck besonderes Augenmerk widmen, wie Lutz Müller erklärt.
Dresdner Vorgebirgs Agrar AG will Kompetenzzentrum vor Ort
Sehr gut vorstellen könne er sich, dass am Standort ein Kompetenzzentrum Landwirtschaft entsteht, das zum einen der Erfahrungsvermittlung mit der Pilotanlage dient und in dem zum anderen Wissen und Fähigkeiten unterschiedlicher Institutionen gebündelt werden, so Ingolf Schulze. Es gebe viel Potenzial in Sachsen, das mit Unterstützung des Freistaates an diesem Ort zusammengeführt werden könnte.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Die Meldung sorgte bundesweit in mehreren Medien für Schlagzeilen: In der Nacht zum 19. Juni hätten unbekannte Täter tiefgekühltes Bullensperma im Wert von 30.000 Euro aus einem Milchzuchtviehbetrieb in Löcknitz-Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) gestohlen, meldete die Polizei.
Zeugen haben Einbruch beobachtet
Die Täter hätten gegen 00:20 Uhr einen Zaun beschädigt, waren widerrechtlich auf das Gelände des Betriebes eingedrungen und hätten hochwertige Bullensperma aus Lagerbehältnissen mitgenommen, hieß es zunächst. Zeugen beobachteten drei Personen bei der Flucht vom Gelände.
Die Polizei begann wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung zu ermitteln – auch zu der Frage, ob die Täter das Sperma gezielt für einen Weiterverkauf gestohlen haben könnten.
Dienstagnachmittag (24.06.) revididerte die Polizeiinspektion Anklam schließlich die Diebstahlsmeldung. „Nach umfangreichen Überprüfungen der Lagerbestände durch den Milchviehzuchtbetrieb“ habe man festgestellt, dass doch kein Bullensperma entwendet worden sei. Man ermittle aber weiter wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Zeugen gesucht
Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk (Telefonnummer: 03973/220-0), die Internetwache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Anlässlich des Weltbauerntages, der alljährlich am 1. Juni begangen wird, hat das Statistische Landesamt in Halle sehr interessante, bislang unveröffentlichte Ergebnisse des Zensus 2022 zur Beschäftigung im hiesigen Agrarsektor vorgelegt.
Ackerbau, Tierhaltung & Co.: Wo die Arbeitskräfte tätig sind
Danach waren zum Stichtag der Volkszählung am 15. Mai 2022 in Sachsen-Anhalt insgesamt 20.080 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig, davon 34,6 % (6.950) als Gärtner/-innen sowie Ackerbäuerinnen und Ackerbauern. Weitere 2.430 Personen (12,1 %) waren ausschließlich in der Tierhaltung beschäftigt. Mehr als ein Viertel waren sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung landwirtschaftlich tätig (26,1 %; 5.250).
Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt: Eine Männerdomäne?
Weitere 4,1 % (820) der im grünen Sektor Beschäftigten arbeiteten in der Forstwirtschaft. Hilfsarbeiter/
-innen hatten einen Anteil von 22,5 % (4.530) an den in der Landwirtschaft Tätigen. Die übrigen Beschäftigten waren in der Fischerei und der Jagd sowie als Führungskräfte tätig. Hilfsarbeiter/-innen sowie Führungskräfte konnten dabei in allen landwirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern beschäftigt sein, hieß es.
In der Forstwirtschaft war der Anteil der Männer mit 760 von 820 Personen am höchsten (92 %). Der höchste Frauenanteil im Agrarsektor war dagegen mit 45,4 % in der Tierhaltung zu finden (1.100).
Hoher Pendleranteil in der Tierhaltung
34,7 % der landwirtschaftlich Beschäftigten lebten nicht an ihrem Arbeitsort und pendelten zur Arbeit (6.970). In der Tierhaltung war der Anteil an Pendelnden am höchsten (1.120; 46 %). Bei den Hilfsarbeiterinnen und -arbeitern war der Anteil der Pendler am geringsten, mit 1.350 von 4.530 Beschäftigten (29,8 %). Insgesamt arbeiteten 10.570 Personen (52,6 %) in ihrer Hauptwohnsitzgemeinde, zu weiteren 2.540 (12,7 %) konnte keine Aussage über das Pendlerverhalten getroffen werden.
Drei Prozent Azubis
Von den 20.080 in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt beschäftigten Arbeitskräfte befand sich mit 49,1 % (9.850) der größte Anteil in einem Angestelltenverhältnis, gefolgt von Arbeiterinnen und Arbeitern mit 21,5 % (4.310) sowie Selbstständigen mit 13,3 % (2.660). Auszubildende (3,1 %; 620) und mithelfende Familienangehörige (2,5 %; 500) machten nur einen geringen Anteil der Beschäftigten aus. Weitere im Agrarbereich beschäftigte Personen absolvierten den Bundesfreiwilligendienst oder hatten einen sonstigen Erwerbsstatus.
94,6 % der Agrar-Arbeitskräfte aus Deutschland
Von allen Arbeitskräften, die in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt beschäftigt waren, hatten 94,6 % (19.000) die deutsche Staatsbürgerschaft. Die beiden häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten waren die polnische mit 1,8 % (370) und die ukrainische mit 1,1 % (220).

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
In den vergangenen zwei Wochen hat es in Priborn und Umgebung nach langer Trockenheit endlich geregnet. 45 mm kamen im Durchschnitt vom Himmel. Ein paar Tage sollte das für die Pflanzenkulturen, die zurzeit auf den Flächen unseres Praxispartnerbetriebes wachsen, noch ausreichen. Doch Anfang Mai habe es ganz anders ausgesehen, erzählt Betriebsleiter Johannes Gawlik. „Da mussten wir schon die Kartoffeln bewässern. Sollte es in der nächsten Zeit erneut trocken und heiß werden, müssen wir damit wieder anfangen.“ Rund 50 % der ungefähr 200 ha Kartoffelanbau-Fläche unseres Praxispartners in Mecklenburg-Vorpommern können in diesem Jahr beregnet werden.

© Johannes Gawlik
Kartoffel-Anbau in Mecklenburg-Vorpommern: Seenwasser sichert Kartoffelernte
Das Wasser kommt aus den Seen in der Nachbarschaft, die zur Mecklenburgischen Seenplatte gehören. Die Wasserentnahmerechte vermindern das Ausfallrisiko und ermöglichen eine rentable Produktion. Sollte die Wasserverfügbarkeit im Laufe der Sommermonate durch Verdunstung und z. B. gesteigerte Schleusennutzung der Yachten und Fahrgastschiffe sinken, ist die behördliche Einschränkung der Entnahme für den Betrieb denkbar. Insgesamt sehen die Kartoffeln bisher gut aus. Dagegen sind Weizen, Gerste und Roggen zu ungefähr 15 % vertrocknet, so der Junglandwirt.

Selektion im Kartoffelanbau: Schlüssel zum Erfolg
An den vergangenen Tagen wurden die Pflanzkartoffeln auf dem Acker selektiert. Diese notwendige manuelle Bereinigung wurde mit einem Selektierwagen durchgeführt. Die sogenannte Selektionsarbeit, bei der kranke sowie anderen Sorten zugehörende Pflanzen aus dem Feldbestand entfernt werden, gehört zu einer der zentralen Aufgaben in dem Kartoffelanbau und -vermehrungsbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern, um gesunde und qualitativ hochwertige Pflanzkartoffeln zu erhalten.
„Als Superelite, die bereits einen hohen Ertrag verspricht, kaufen wir das zertifizierte Pflanzgut beim Züchter. Die Sorten dienen uns dann für drei Jahre zur Reproduktion. Erst dann verkaufen wir die Kartoffeln an die Verarbeitungs- oder Stärkefabrik“, erklärt Johannes Gawlik. Die Vermehrung bildet also die Grundlage des betrieblichen Kartoffelanbaus. Die Sortenwahl erfolgt nach Standorteignung und orientiert sich an den Anforderungen der Abnehmer. Sie unterliegt einem stetigen Wandel.
Organische Düngung: Ammoniak-Reduktion durch Gärrest-Ansäuerung
Vor drei Jahren ist die Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern auf den Ackerbaubetrieb zugekommen, um ein noch in der Erprobungsphase befindliches Verfahren unter Praxisbedingungen zu testen.
Im Rahmen eines Verbundprojektes, deren Projektträger die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist, geht es um eine deutliche Reduzierung der Ammoniak-Emissionen bei der organischen Düngung. Der Versuch habe weniger einen wissenschaftlichen Anspruch sondern sei eher als Demonstrationsprojekt angelegt, so Johannes Gawlik. Dabei ging es um die Ansäuerung von Gärresten mit Schwefelsäure bei der Ausbringung. Dieses Jahr dienten etwa fünf Hektar Mais als Versuchsfläche. Die Ausbringung erfolgte entgegen der betriebsüblichen Praxis nicht vor Aussaat im Strip-Till-Verfahren, sondern im Bestand.

Ein am Projekt teilnehmendes Lohnunternehmen habe die benötigte Ansäuerungstechnik und die Schwefelsäure zur Verfügung gestellt, beschreibt der Junglandwirt den Feldversuch. Für das Ansäuern wurde ein Fronttanksystem mitgeführt, das dem organischen Wirtschaftsdünger während der Ausbringung die Schwefelsäure zuführt und damit den pH-Wert des Düngers senkt. Da es bei der Vermischung der Schwefelsäure und der Gärreste zu einer erheblichen Schaumbildung und Volumenvergrößerung kommt, wird die Schwefelsäure erst unmittelbar vor der Ausbringung hinzudosiert. Erste Ergebnisse belegen, dass eine Ansäuerung ein geeignetes Mittel zur Reduzierung der Stickstoff-Emissionen darstellt, so Johannes Gawlik. Auch einige pflanzenbauliche Vorteile, wie die Erhöhung des Proteingehaltes bei Getreide, konnten gemessen werden.

© Johannes Gawlik
Nachhaltiger Ackerbau: Strategien für weniger Herbizideinsatz
Grundsätzlich ist eine verbesserte Nährstoffausnutzung in vielerlei Hinsicht erstrebenswert. „Wichtig ist, dass das Verfahren günstiger wird oder dass es eine Art ,Probierprämie‘ gibt, wie z. B. für den Verzicht auf chemisch synthetischen Pflanzenschutz. So ökologisch sinnvoll, wie dieses Verfahren auch ist – es ist finanziell zurzeit noch nicht tragbar.“
Maßnahmen zum Verzicht auf chemisch synthetischen Pflanzenschutz werden bei der Vipperow Agrar versuchsweise umgesetzt. Bei einigen Maisflächen wurde zur Unkrautregulierung mit der Hacke gearbeitet, anstatt ihn mit der Pflanzenschutzspritze zu behandeln. Leider funktioniert es nicht in jedem Jahr ohne Herbizide, sagt Johannes Gawlik. Nach zweijähriger positiver Erfahrung musste in diesem Jahr chemisch nachbehandelt werden. Ziel ist, die Kombination von mechanischen und chemischen Verfahren auf dem Betrieb auszubauen.
Agrarzahlungen: Förderungen optimal nutzen
Gerade erst ist die Liste der Empfänger von Agrarzahlungen für das Jahr 2024 herausgekommen und ist online für jeden abrufbar. „Beim Ausfüllen des Agrarantrages schaue ich regelmäßig, welche Maßnahmen wir umsetzen und ob sie den Förderungen entsprechen. Dabei sind manchmal Dinge aus dem Bereich Naturschutz, die ich sowieso schon mal ausprobieren wollte“, erklärt der Junglandwirt. Dadurch habe er die Möglichkeit, die Kosten für die Umsetzung wenigstens zu einem Teil durch die Fördersumme auszugleichen. Die Randstreifen um Landschaftselemente sind ein Beispiel dafür.

Unsere Top-Themen
- Junge Generation übergibt Zukunftsvision
- Strategien für Trockengebiete
- KI und Roboter-Innovationen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!