Automatisierung der Düngung: So können Landwirte mit Luftbildern arbeiten
Das Forschungsprojekt AutoFenster soll passgenaue Düngeempfehlungen liefern, die auf Luftbildern und Spektralanalysen basieren. Ziel ist, diese Düngekarten direkt und unkompliziert in die Praxis zu übertragen.
Ein Forschungsprojekt will zeigen, wie teilflächenspezifische Stickstoffdüngung künftig automatisiert und praxisnah umgesetzt werden kann – mithilfe von Drohnen, Bildauswertung und abgestuften Parzellen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen: Der Standort ist entscheidend für die Düngestrategie. Seit April 2024 läuft das Verbundprojekt „AutoFenster“ am Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP) auf der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Berge (Brandenburg). Gefördert vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat sollen in drei Jahren praxisnahe Lösungen zur automatisierten Ableitung von N-Düngungsempfehlungen entstehen. Neben dem IASP sind das Fraunhofer IGP, Pix4D und landwirtschaftliche Betriebe wie der Havellandhof Ribbeck beteiligt.

Vegetationsbeobachtung statt reiner Planung
Ziel ist, mithilfe von multispektralen Drohnenbildern die reale N-Aufnahme im Bestand über die Vegetationsperiode hinweg zu verfolgen. Dazu werden regelmäßige Überflüge im zweiwöchigen Rhythmus durchgeführt von der Bestellung bis zur Ernte. Dafür wird auf einem Feld ein abgestufter Stickstoffversuch (0–150 % des ermittelten Düngebedarfs in sieben Stufen) angelegt. Dieser ist über die verschiedenen Boden- und Ertragszonen verteilt. So entsteht eine Skala auf dem Schlag, anhand derer die tatsächliche N-Aufnahme des Bestandes abgelesen werden kann.
Aus diesen Werten sollen anschließend automatisierte Düngeempfehlungen abgeleitet werden. Denn insbesondere bei Winterweizen kann die Stickstoffaufnahme anhand der Grünfärbung (Chlorophyllgehalt) gut nachvollzogen werden. Dazu hat Annika Behler, Leiterin des AutoFenster-Projektes, bereits in ihrer Masterarbeit feststellen können, dass drohnenbasierte Multispektralaufnahmen und daraus errechnete Vegetationsindizes gut geeignet sind, um den Chlorophyllgehalt abzubilden. Da Winterweizen besonders stark auf Stickstoff reagiert und die Verwendung von Vegetationsindizes hierbei bereits gut erforscht ist, konzentriert sich das Projekt vorrangig auf diese Kultur.

Luftbilder durch privates Unternehmen Pix4D
Der Fokus liegt in erster Linie auf der Anwendung von pneumatischen Düngerstreuern oder Flüssigdüngung per Teilbreitenregelung, ohne dass teure Spezialtechnik notwendig ist. Am Ende soll ein System entstehen, das Vergleichsflächen automatisiert anlegt und auswertet, ohne größeren, zusätzlichen Aufwand für Landwirte. Auch bei AutoFenster sollen mehrere Parameter gleichzeitig berücksichtigt werden, darunter Bodenart, Sorte, Niederschlag, N-Menge und BBCH-Stadium – Letztere per Bildauswertung durch Softwarelösungen von Pix4D.
Pix4D ist auf Photogrammetrie spezialisiert. Mit Pix4Dfields entwickelt das Unternehmen seit einigen Jahren auch praktische Lösungen für die Landwirtschaft. Darunter das Magic Tool, das Flächenunterschiede erkennt und z.B. zur Erkennung von Beikräutern oder Wildschäden eingesetzt werden kann. Außerdem ist die Erstellung eines KI-Berichts mit Angaben zu aktuellen BBCH-Stadien und dem Gesundheitszustand der Pflanzen in der Software möglich. Beide Anwendungen sollen künftig zur Generierung von Düngeempfehlungen beitragen.
Das Fraunhofer IGP ist zuständig für die Bewertung der Technik und deren Praxistauglichkeit. Es untersucht die Genauigkeit und den Grad der Automatisierbarkeit vorhandener Applikationstechnik und welche Möglichkeiten und Grenzen sich beim Einsatz des Systems durch handelsübliche Landmaschinen ergeben.
Bewertung der Düngung erst im Rückblick möglich
Da der Startschuss für das Projekt erst im April 2024 fiel, wurde zunächst auf bereits vorhandene Flächen mit langjähriger Luftbildhistorie zurückgegriffen. Dennoch liegen nun erste Ergebnisse vor, unter anderem von einem Schlag mit Bodenpunkten zwischen 25–65 innerhalb eines 400-m-Radius. Die Unterschiede in der Stickstoffaufnahme seien gravierend, je nach Bodenart und Niederschlagsverlauf. Besonders auf leichten Böden führten hohe N-Gaben zu keinen positiveren Effekten als geringere N-Gaben.
Laut Annika Behler sei dies besonders durch das extrem trockene Frühjahr mit weniger als 50 % der üblichen Niederschlagsmenge bedingt worden. Auch die N-Aufnahme aus granulierten Düngern war deutlich verzögert: Statt der üblichen ein bis zwei Wochen dauerte es teils vier Wochen, bis erste Unterschiede in der Grünfärbung sichtbar wurden. Daraus ergeben sich nach Dr. Andreas Muskolus, Leiter der Versuchsstation in Berge, die Fragen für die Praxis: Warten auf Regen oder nachdüngen? Und: Wie viel Stickstoff wird bei Trockenheit überhaupt aufgenommen? Und wenn gedüngt wird: Wo lohnt es sich am meisten?

Ein zentrales Anliegen des Projekts ist es, Düngestrategien im Rückblick bewertbar zu machen. Die Kombination aus abgestuften Versuchen und Bildauswertung erlaube es, die tatsächliche N-Aufnahme sichtbar zu machen und das differenziert nach Ertragszone. So könnten Landwirte genau abschätzen, wo welche Strategie effizient war. Dr. Muskolus spricht in diesem Zusammenhang von einer „Skalierung auf dem Acker“. Auf jedem Schlag entsteht eine interne Referenz, die eine praxisnahe und feldspezifische Beurteilung ermöglicht. Entscheidender Unterschied zu anderen Systemen: Es wird nicht pauschal bewertet, sondern teilflächenspezifisch differenziert.
Zusammenarbeit mit Landwirten
Besonderen Wert legt das IASP auf das Einbinden von Praktikern. Nur so könne praxisnah geforscht werden. Der Havellandhof Ribbeck bringt seine Erfahrungen aus der Praxis in das Projekt ein. Zuerst hatten sich die Forscher auf Systeme zum Ausbringen von Mineraldünger konzentriert. Sie hatten sich eine präzise Düngeablage ohne Mehraufwand versprochen. Der Havellandhof Ribbeck zeigte ihnen dann, wie das System auch mit einer Teilbreitenregelung in Flüssigsystemen funktionieren kann.
Auf 5 ha des Betriebs wurde ebenfalls eine abgestufte N-Skala angelegt. Natürlich angepasst an die Standortgegebenheiten und ganz normal vom Betrieb mitbewirtschaftet, als Kontrollfläche zum Versuch des IASP. Auf den Versuchsflächen wurden aufgrund der Trockenheit nur zwei Gaben ausgebracht, im Praxisbetrieb hingegen drei. Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. „Düngung kann immer erst im Rückblick richtig bewertet werden“, betont Dr. Andreas Muskolus.
Zukünftig auch für Raps und Zuckerrüben
Wichtig sei allerdings auch, dass Landwirte die Kontrolle behalten, denn das System solle nur bei der Entwicklung einer optimalen Düngestrategie unterstützen. Langfristig könnten auch Skalenversuche ohne direkte Düngungsempfehlung in der Praxis sinnvoll sein – etwa zur dokumentierten Bewertung der eigenen Düngepraxis oder für eine automatisierte Ableitung im Betriebsmanagement. Ausgehend vom Winterweizen als fokussierte Ackerkultur, können sich die beiden Wissenschaftler auch gut vorstellen, das System auch auf andere Getreidearten sowie Raps oder Rüben zu übertragen.
Bei Mais zeigen sich noch Schwierigkeiten in der Bildauswertung, da die Bestände spektral schwerer zu erfassen seien. Die Empfehlungen sollen angepasst an Sorten, Witterung, Boden und Menge, sowie Anzahl der N-Gaben erstellt werden können. Um das Verfahren möglichst einfach und flexibel zu halten, soll es mit vorhandener Technik funktionieren. Damit Ergebnisse schnell und ohne spezielle Geräte in die Praxis übernommen werden können.
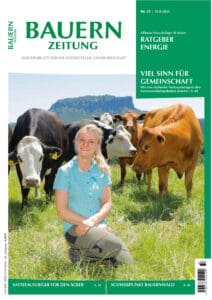
Unsere Top-Themen
- Sabine Eidam – Mit viel Sinn für Gemeinschaft
- Düngung mit Mikronährstoffen
- Schwerpunkt Bauernwald
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

