Die Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G. (Mecklenburg-Vorpommern) ist ein wichtiger Betrieb in der Region und sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Gemeinnütziges Engagement gehört für den geschäftsführenden Vorstand Wilfried Lenschow dazu. Er ist Mitglied der Jury, die über die Vergabe des Förderpreises „Wir von hier: Junge Profis in Agrargenossenschaften!“ entscheidet, den der Genoverband ausgelobt hat.
Herr Lenschow, vorweg die wichtigste Frage an einen Landwirt im Frühjahr: Wie sind Ihre Feldbestände über den Winter gekommen?
Wilfried Lenschow: Das sieht in diesem Frühjahr, verglichen mit den Vorjahren, ganz ordentlich aus. Die Bestände sind gut über den Winter gekommen und gesund. In den kommenden Wochen wäre etwas Regen wichtig, es ist bereits wieder relativ trocken. Aber kurzgefasst: Wir sind mit den Feldbeständen derzeit zufrieden.

Dann bleibt ja genügend Zeit für Ihre ehrenamtliche Arbeit als Juror des Förderpreises „Wir von hier: Junge Profis in Agrargenossenschaften“?
Für uns Mitglieder in den Agrargenossenschaften ist ehrenamtliche Tätigkeit selbstverständlich, auch wenn das Wetter mal nicht so passt oder Arbeitsspitzen uns fordern. Ich finde die Idee mit dem Förderpreis sehr gut: Glückwunsch an den Genoverband für diese Initiative. Ich übernehme sehr gerne die Aufgabe in der Jury. Es ist wichtig, dass wir zeigen, was die jungen Leute können.
Agrargenossenschaft: Alle Mitarbeiter kommen aus der Region
Ihre Agrargenossenschaft bildet aus: Wie schwierig ist es, guten Nachwuchs zu bekommen?
Wir haben derzeit vier Azubis, von denen drei in der Ausbildung zum Landwirt sind und einen angehenden Tierwirt. Worauf wir ein wenig stolz sind: Alle unsere Mitarbeiter kommen aus der Region und sind keine Saisonarbeitskräfte. Das ist gerade in großen Betrieben mit 365 Tagen im Jahr Melken längst nicht mehr überall so.
Wie machen Sie das?
Wir leben das Wir! Das ist kein Geheimrezept, sondern eine grundsätzliche Einstellung von uns allen. Wir haben das Ziel vor Augen, den Betrieb vorwärts zu bringen. Jeder hat seine Aufgabe, trägt dazu bei und weiß, dass er oder sie auch mal eine andere zusätzliche Aufgabe übernehmen muss. Dafür gibt es dann wieder einen Ausgleich. Die Agrargenossenschaft Bartelshagen I ist ein Unternehmen, das sich seiner sozialen Verantwortung bewusst ist.
Junge Landwirte: Das Team zählt
Und was bedeutet das beispielsweise für Ihren arbeitsintensiven Betriebszweig Tierhaltung?
Da kann ich ein Beispiel nennen: Bislang war das Melken so organsiert, dass die Mitarbeiter das Melken am Morgen und Abend, natürlich mit Pausen, durchgehend übernommen haben. Danach hatte sie für eine Woche frei. Das möchte das Team jetzt anders mit einer täglichen Früh- und Spätschicht. Das machen wir dann so, benötigen dafür aber zwei weitere Mitarbeiter. Bei uns wird nicht von oben nach unten entschieden. Wir sind eine eingeschworene Truppe.
Ausbildung: Mit Leidenschaft für die Tierhaltung
Grundsätzlich ist es aber schwieriger, Mitarbeiter für die Tierhaltung als für den Ackerbau zu gewinnen, oder?
Ja, das ist so und daran wird sich nichts ändern. Man darf niemanden zu seinem beruflichen Glück überreden und wir haben die richtigen Leute für alle Betriebszweige. In der Tierhaltung ist meine Erfahrung: Diese Ausbildung wollen zwar weniger junge Leute machen, aber wenn sie sich dazu entscheiden, sind sie mit Leidenschaft und Können dabei.
Agrargenossenschaft Bartelshagen
Die Agrargenossenschaft Bartelshagen I e. G., Marlow/Vorpommern, verfügt über rund 3.200 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, anteilig rund 500 ha Grünland. Im Ackerbau setzt die Genossenschaft unter anderem auf Braugerste. Der Betrieb vermehrt Gerste und Gräser. Durch den Anbau von Lupinen ist die Agrargenossenschaft in der Rinderhaltung unabhängig von Soja. Die Tierhaltung umfasst 500 Milchkühe, 600 Jungtiere mit Nachzucht und 120 Mutterkühe. Auf 16 ha wird Geflügel für die Selbstvermarktung gehalten.
Und wie sieht es mit der theoretischen Ausbildung aus?
Das könnte ich mir jetzt einfach machen und sagen, dass früher alles besser war. Das bringt aber nichts. Die theoretische Ausbildung der Azubis ist nicht immer auf dem neuesten Stand und könnte vor allem deutlich praxisnäher sein. Was nutzt es, wenn die jungen Leute in der Theorie gezeigt bekommen, wie der perfekte Pflanzenbau aussieht, aber die Realität anders ist. Mit natürlichen Bedingungen des Standortes und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen lernt man nur in der Praxis umzugehen.
Was schlagen Sie vor?
Mir ist klar, dass an den Berufsschulen die Ressourcen begrenzt sind, aber wenn die Azubis wieder häufiger unterschiedliche Betriebe besuchen würden, wäre das sehr hilfreich. Da lernen die jungen Leute mit einer Kombination aus Theorie und Praxis, wie die Landwirtschaft funktioniert. Das gilt nicht nur für die Ausbildung, sondern ebenfalls für das Studium. Die Fachhochschulen sind nahe an der Praxis, aber die Agrarfakultäten sollten wieder stärker die fachliche Nähe zur praktischen Landwirtschaft suchen.
JETZT BEWERBEN:
Förderpreis für junge Landwirte
Mit dem Förderpreis für Nachwuchskräfte „Wir von hier: Junge Profis in Agrargenossenschaften!“ zeichnet der Genoverband junge Profis und Mitglieder in Agrargenossenschaften aus und unterstützt die Gewinner mit einem Preisgeld von insgesamt 4.500 €. Gefördert werden bis zu drei Bewerbende. Die schriftliche Bewerbung per E-Mail an agrar@genoverband.de kann mit einem Video oder Podcast ergänzt werden. Der Bewerbungsschluss ist am 2. Mai 2025. Wer teilnehmen möchte, muss volljährig und darf höchstens 40 Jahre alt sein.
Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury, bestehend aus Nina Berlin (Kommunikationsleiterin Deutscher Raiffeisenverband e.V), Claudia Duda (Chefredakteurin der Bauernzeitung), Wilfried Lenschow (Vorstandsvorsitzender Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G.), Peter Götz (Vorstand Genoverband e.V.), Christopher Braun (Abteilungsleiter Agrarwirtschaft DZ Bank) und Dr. Andreas Möller (Leiter Kommunikation/Politik Trumpf SE und Buchautor. Gefördert werden bis zu drei Bewerbende. Unterstützt wird dieser Preis von der Raiffeisen-Stiftung, der R+V Versicherung, sowie den Volks- und Raiffeisenbanken mit Unterstützung der DZ Bank
Weitere Informationen: www.agrargenossenschaften.com/aktuelles/

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Feierliche Atmosphäre, strahlende Gewinner: Die Verleihung des Ceres Awards ist für alle ein besonderer Abend. Im Oktober 2024 konnten sich aus dem Erscheinungsgebiet er Bauernzeitung eine Landwirtin und ein Landwirt über die begehrte Auszeichnung freuen. So wurde Daniel Willnat aus Domsühl (Mecklenburg-Vorpommern) für sein Projekt der Bio-Waldputen als bester Geflügelhalter geehrt. Und Anja Kolbe-Nelde aus Roßleben-Wiehe (Thüringen) überzeugte mit ihrer Trüffelzucht die Jury und wurde als beste Unternehmerin ausgezeichnet.
Wettbewerb: Produkte mit hoher Qualität
Beim Ceres Award geht es um außergewöhnliche Menschen: Wer gute Betriebsergebnisse erzielt, umweltbewusst und nachhaltig wirtschaftet und das Wohl von Tier und Mensch im Auge behält, ist die ideale Kandidatin oder der ideale Kandidat für den Wettbewerb. Gesucht werden Landwirtinnen und Landwirte, die durch Unternehmergeist und Denken in Kreisläufen brillieren und Produkte in höchster Qualität erzeugen. Namenspatin für den Ceres Award ist Ceres, die römische Göttin des Ackerbaus, der Fruchtbarkeit, des Wachsens und Gedeihens.
Renommierte Auszeichnung für Landwirte
Die renommierteste Auszeichnung für Landwirte wird seit 2014 alljährlich von agrarheute vergeben. Als Gewinn winkt ein großzügiges Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro für die Landwirtin oder den Landwirt des Jahres – in seiner Höhe einmalig in der deutschen Landwirtschaft. Zusätzlich werden alle Katego-riengewinner mit 1.000 Euro belohnt.
Es gibt sieben Kategorien: Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Ackerbauer, Unternehmerin, Energielandwirt sowie Junglandwirt.
Das Bewerbungsverfahren ist ganz einfach. Jeder, der teilnehmen möchte, füllt einfach einen Fragebogen aus. Die Bewerbungsfrist wurde verlängert und endet jetzt am 13. April. Die Gewinner werden in einer feierlichen Siegerehrung am 29. Oktober in Berlin bekanntgegeben.
Ceres Award: Informationen zum Wettbewerb
Die Bewerbungsunterlagen als auch Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte direkt auf der Ceres-Award-Website unter www.ceresaward.de.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln gegen zwei Beschuldigte im Alter von 60 und 63 Jahren wegen des Verdachts des Betrugs im besonders schweren Fall. In mindestens neun Fällen sollen die beiden, die in einem Dresdner Unternehmen tätig sind, die Leistungsfähigkeit und -willigkeit ihres Unternehmens vorgetäuscht haben. Das teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch, 19.3., mit.
Sachsen: Firma ist auf PV-Anlagen spezialisiert
Die 60-jährige Beschuldigte ist Geschäftsführerin des Unternehmens, das auf den Vertrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert ist, während der 63-jährige Beschuldigte als Prokurist fungiert. Seit dem Jahr 2020 haben die Beschuldigten schlüsselfertige Photovoltaikanlagen zu einem Festpreis an potenzielle Investoren im gesamten Bundesgebiet angeboten. In den Angeboten waren auch Leistungen wie Dachsanierung, Bau der Anlage, Trassenbau zur Einspeisung ins Netz sowie die Anmeldung bei Energieversorgungsunternehmen enthalten.
Millionenbetrug: Gesamt-Schaden von 4 Millionen Euro
Anhand der vorliegenden Informationen wird den Beschuldigten vorgeworfen, die vertraglich geschuldeten Leistungen nicht oder nicht vollständig erbracht zu haben. Insbesondere fehlte es bei allen Bauprojekten an dem notwendigen Netzanschluss, was dazu führte, dass die Geschädigten erhebliche Anzahlungen des Auftragspreises leisteten, bevor die entsprechenden Leistungen erbracht wurden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Gesamtschaden von mindestens vier Millionen Euro aus.
Landeskriminalamt: Durchsuchungen in Dresden und Radebeul
Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen durchsuchten am Mittwoch mehrere Objekte in Dresden und Radebeul, darunter eine Wohnung und zwei Gewerberäume. Es wurden umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte, einschließlich mehrerer Firmenfahrzeuge, sichergestellt.
Der 63-jährige Beschuldigte wurde aufgrund eines bereits erlassenen Haftbefehls des Amtsgerichts Dresden festgenommen.
Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Sachsen dauern an und werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Die Hiobsbotschaften aus Brandenburg reißen nicht ab: Die Brandenburger Wildtiere GmbH gibt das Milchvieh auf. Das Ökodorf Brodowin trennt sich ebenfalls von den Milchkühen und auch der Ökohof Kuhhorst stoppt laut Medienberichten nach 35 Jahren die Milchproduktion. Es sind immer dieselben Gründe, die für die Aufgabe der Milchwirtschaft genannt werden: Die Haltungs- und Produktionskosten sind zu hoch, und darüber hinaus fehlt es an Arbeitskräften. Wer als Milchbauer deshalb auf Melkroboter umstellen will, muss hohe Investitionskosten stemmen, denn meist muss dafür auch der Stall erweitert oder gar neu gebaut werden. Oft wird eine solche Investition zum Risiko.
Milchbauern: Sorge um ländlichen Raum
Dass Milcherzeuger aufgeben, war daher auch Thema auf dem Verbandstag des Bauernverbandes Südbrandenburg. Dort wurde die Sorge geäußert, dass der Rückgang der Tierwirtschaft negative Auswirkungen auf die sozialen Strukturen im ländlichen Raum hat. Zwar sind die Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt und werden vermutlich sofort außerhalb beschäftigt.
Maßnahmenplan zur Rettung der Nutztierhaltung gefordert
Aber der Verlust der Arbeitsplätze vor Ort hat auch eine Schwächung der Dorfgemeinschaft zur Folge. In vielen ostdeutschen Dörfern sind die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Betriebe die letzten wackeren Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, die tatsächlich da sind, wenn’s brennt. Auch Schlachtereien und Molkereien sind vom Rückgang der tierischen Erzeugung betroffen. Selbst wenn der Großraum Berlin-Brandenburg einen riesigen Bedarf an regionalen Produkten hat, kann der kaum noch gedeckt werden. So wurde auf dem Verbandstag ein Maßnahmenplan zur Rettung der Nutztierhaltung in Brandenburg gefordert.
Milchwirtschaft: Immer weniger Milchkühe
Denn die Zahlen sind ernüchternd: Der Bestand an Milchkühen verringert sich in Deutschland immer weiter. 2024 waren bundesweit fast 100.000 Tiere weniger in der Milchkontrolle. In Ostdeutschland sank die Menge an konventioneller Kuhmilch laut BLE um mehr als 50.000 Tonnen. Vor allem Sachsen-Anhalt war betroffen, allein hier betrug das Minus fast 39.000 Tonnen. Nur in Mecklenburg-Vorpommern konnte die Produktion 2024 um 5.300 Tonnen gesteigert werden.
Milchforum: Planungssicherheit fehlt
Das Paradoxe an der Situation: Selten waren die Milchpreise so gut wie in den vergangenen drei Jahren. Das 15. Berliner Milchforum hat sich vorige Woche mit den Problemen der Milchwirtschaft beschäftigt. Der Branchentreff mit Teilnehmenden aus Praxis, Wirtschaft und Wissenschaft hat eine klare Botschaft ausgesendet: Fehlende Planungssicherheit bremst Milcherzeuger und Molkereien aus. Deshalb müsse sich die neue Bundesregierung zur Nutztierhaltung in Deutschland bekennen und den bürokratischen Aufwand verringern.
Milchbauern: Kritik an Artikel 148 und GMO
Ob die Reform der Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) samt Artikel 148 tatsächlich eine Verbesserung der Lage der Milchwirtschaft bringt, wird von vielen bezweifelt. Der Artikel 148 regelt die Beziehungen zwischen Milchbauern und Molkereien. Letztere sollen künftig für ihre Rohmilchlieferungen zu schriftlichen Verträgen verpflichtet werden, die Bestimmungen unter anderem zu Preis und Menge enthalten. Doch auch der Vorsitzende des Milchindustrie-Verbandes (MIV), Detlef Latka, meint, eine Vertragspflicht bringt nichts. Es gäbe dadurch keine besseren Erzeugerpreise und auch keinen faireren Wettbewerb. Die größte Befürchtung ist jedoch, dass die Kontrolle zur Einhaltung der Verträge den Verwaltungsaufwand noch vergrößert. Und dabei sollte die Bürokratie doch kleiner werden?!

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Der Förderpreis „Wir von hier: Junge Profis in Agrargenossenschaften!“ des Genoverband e.V. richtet sich an junge Mitglieder von Agrargenossenschaften, die sich aktiv und mit innovativen Ideen in ihrer Agrargenossenschaft engagieren.
Team-Gedanke und neue Ideen sind gefragt
Konkret geht es um Projekte, mit denen junge Profis ihre jeweilige Agrargenossenschaft organisatorisch, technisch, wirtschaftlich oder sozial weiterentwickeln. Gefragt sind Ideen, die junge Mitglieder selbst entwickelt und realisiert haben. Selbstverständlich steht dabei der genossenschaftliche Team-Gedanke im Vordergrund.
Bewerber dürfen höchstens 40 Jahre alt sein
Bewerberinnen und Bewerber, die sich innerhalb ihrer Agrargenossenschaft oder deren Umfeld sozial oder kulturell engagieren sind ebenfalls ausdrücklich aufgerufen, ihre Unterlagen einzureichen. Wer teilnehmen möchte, muss volljährig und darf höchstens 40 Jahre alt sein. Der Genoverband orientiert sich damit an den Kriterien für die öffentliche Junglandwirte-Förderung.
„Wir wollen die jungen genossenschaftlichen Macherinnen und Macher vom Land zeigen“, sagt Peter Götz. Für den Vorstand des Genoverbandes e.V. geht es darum „zu vermitteln, was gerade die jungen Mitglieder und Mit-Unternehmer in den Agrargenossenschaften leisten“.
Förderpreis für junge Landwirte: Das ist die Jury
Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury, bestehend aus Nina Berlin (Kommunikationsleiterin Deutscher Raiffeisenverband e.V), Claudia Duda (Chefredakteurin der Bauernzeitung), Wilfried Lenschow (Vorstandsvorsitzender Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G.), Peter Götz (Vorstand Genoverband e.V.), Christopher Braun (Abteilungsleiter Agrarwirtschaft DZ Bank) und Dr. Andreas Möller (Leiter Kommunikation/Politik Trumpf SE und Buchautor. Gefördert werden bis zu drei Bewerbende. Unterstützt wird dieser Preis von der Raiffeisen-Stiftung, der R+V Versicherung, sowie den Volks- und Raiffeisenbanken mit Unterstützung der DZ Bank
Der Genoverband vertritt nach eigenen Angaben mehr als 500 Agrargenossenschaften und über 400 landwirtschaftliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften. Agrargenossenschaften prägen als Mehrfamilienbetriebe die Landwirtschaft in Ostdeutschland maßgeblich. Mehr 19.000 landwirtschaftliche Mitglieder sind als Mitunternehmer aktiv. Sie bieten vielen Mitgliedern und Beschäftigten einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz.
Genoverband: Preisgeld von insgesamt 4.500 Euro
Mit dem Förderpreis für Nachwuchskräfte „Wir von hier: Junge Profis in Agrargenossenschaften!“ zeichnet der Genoverband junge Profis und Mitglieder in Agrargenossenschaften aus und unterstützt die Gewinner mit einem Preisgeld von insgesamt 4.500 €. Die Bewerbungsphase startet am 20. März 2025. Die schriftliche Bewerbung per E-Mail an agrar@genoverband.de kann mit einem Video oder Podcast ergänzt werden. Der Bewerbungsschluss ist am 2. Mai 2025. Weitere Informationen unter: www.agrargenossenschaften.com/aktuelles/

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Laut Agrarstrukturerhebung sind etwa 40 % der Agrarbetriebe in Ostdeutschland Nebenerwerbsbetriebe. Sie dienen der Einkommensdiversifizierung, sichern Arbeitsplätze und stärken regionale Wirtschaftskreisläufe. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt und tragen zur Landschaftspflege und Biodiversität bei. Kleinbäuerliche Betriebe sind für die meisten Menschen eine nachvollziehbare und erlebbare Form der Landwirtschaft. Das Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft ist daher meist gut. Hinter der idyllischen Fassade verbergen sich jedoch zahlreiche Herausforderungen, denen sich Nebenerwerbslandwirte stellen müssen.
Nebenerwerb: Pflichtversicherung für Ehefrau
Wird die Ehepartnerin eines Landwirts arbeitslos, gilt sie automatisch als mitarbeitende Familienangehörige und ist somit in der landwirtschaftlichen Krankenkasse pflichtversichert, obwohl keine Mitarbeit erfolgt, berichtete ein Obstbauer aus Brandenburg der Bauernzeitung. Für einen Nebenerwerbsbetrieb kann dies eine Belastung von mehreren Tausend Euro im Jahr bedeuten. In keiner anderen Branche gibt es eine vergleichbare automatische Pflichtversicherung.
Landwirtschaft: Steuerberater lehnt Obstbauern ab
Als florierender Nebenerwerbsbetrieb wollte der Obstbauer von der Steuerberatung für Arbeitnehmer zum Steuerberater für Land- und Forstwirte wechseln. Im Umkreis von 30 km hat er neun Anfragen gestellt und immer eine Absage erhalten, meist mit der Begründung, dass keine Kapazitäten für neue Mandanten vorhanden seien. Das zu erwartende geringere Honorarvolumen könnte aber auch ein Grund gewesen sein. Das gibt nur keiner zu.
Nebenerwerbslandwirtschaft: Fläche zu klein – keine Frosthilfe
Für viele Obstbauern bedeutete der Spätfrost im vergangenen Jahr einen totalen Ernteausfall. Es konnten deshalb Frosthilfen beantragt werden. In Brandenburg war dies jedoch nicht für alle Obstbauern möglich, da nur Obstanlagen mit einem Baumbestand von mindestens 300 Bäumen je Hektar antragsberechtigt waren, wobei die Betriebsgröße bereits durch eine Mindestförderung nach unten begrenzt war. Es erhielten also nur Plantagenbetriebe Frosthilfe, der Obstbauer mit den biodiversitätsfreundlicheren Streuobstwiesen (max. 100 Bäume/ha) konnte sehen, wo er mit seinem Verlust bleibt.
Kein Kredit für kleine Betriebe
Komplexe und umfangreiche Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Tierhaltung, Pflanzenschutz und Lebensmittelhygiene können insbesondere für kleinere Betriebe mit begrenzten Ressourcen neben dem Haupterwerb eine große Herausforderung darstellen. Der Preisdruck in der Landwirtschaft ist oft sehr hoch und kleinere Betriebe haben weniger Spielraum, um Kosten zu senken oder höhere Preise durchzusetzen. Die Landwirtschaft ist ein kapitalintensiver Sektor und Investitionen in Maschinen, Ausrüstung und Land können sehr teuer sein. Banken und andere Finanzinstitute sind oft zurückhaltend bei der Vergabe von Krediten an kleine landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere an Nebenerwerbsbetriebe, da diese als risikoreicher gelten. Nebenerwerbslandwirte haben oft weniger Zeit und Ressourcen, um sich fortzubilden, und sind daher möglicherweise weniger gut über neue Entwicklungen informiert.
Politik muss gegensteuern
Die Nebenerwerbslandwirtschaft ist aufgrund der spezifischen Bedingungen in der Landwirtschaft benachteiligt. Hier muss die Politik und damit auch die neue Bundesregierung durch weniger und gerechtere Bürokratie gegensteuern.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Gut zwei Wochen, so schätzt es der Ackerbauvorstand der Agrargenossenschaft Teichel, Eric Engelmann, habe man mit der jüngsten Klarstellung in Thüringen zum Düngeverbot aufgrund des Bodenzustandes gewonnen. Auf Drängen des Bauernverbandes (TBV) hatte das Agrarministerium Mitte Februar verfügt, dass es sich nicht um einen gefrorenen Boden handelt, wenn nach Überfrieren in der Nacht sichergestellt ist, dass die Frostschicht im Tagesverlauf auftaut und der Boden somit für organische Dünger aufnahmefähig wird.

Düngeverbot in Thüringen: Zügige Düngung möglich
„In der Vergangenheit sah es so aus, dass wir auf dem gefrorenen Boden nicht düngen konnten – nach dem Auftauen am Vormittag war dann die Befahrbarkeit nicht mehr oder nur mit tiefen Fahrspuren möglich. Jetzt konnte unser Dienstleister in den frühen Morgenstunden auf den ‚Schattenflächen‘ aufgrund des tragfähigen Bodens beginnen. Hiernach ging es auf Flächen weiter, die die Sonne abgetrocknet hat. Das hat wunderbar geklappt; es gibt keine Fahrspuren.“ Gut 170 ha, darunter Weizen-, Futterroggen- und Feldgrasflächen, konnten so zügig gedüngt werden.
Agrargenossenschaft Teichel: Frostnächte überstanden
Die strengen Frostnächte Mitte Februar überstanden die Kulturen auch ohne schützende Schneedecke schadlos. „Wir hatten Glück, dass es die Tage vor dem Frost schon recht kühl war und der Temperatursturz nicht so abrupt erfolgte.“ 70 ha konnten im Februar gepflügt werden. Mit der Saatbettbereitung kam man in der ersten Märzwoche gut voran. Bis zum 9. März waren die Erbsen gedrillt. Wie schon in den Vorjahren bereitet der Betrieb das Saatgut aus der vorjährigen Ernte für den Nachbau selbst auf. Die Sommergerste sollte im Laufe der 11. Kalenderwoche im Boden sein.
„Wir hätten die Sommergerste gern früher gedrillt, allerdings gaben das die Bedingungen nicht her: Erst war der Boden zu hart gefroren, dann war die Fläche zu feucht.“ Der Raps hat seine erste mineralische N-Gabe erhalten, die Wintergerste sollte jetzt auch versorgt sein. Auf einigen Schlägen beobachtet Engelmann auffällige Feldmausaktivitäten: „Die Löcher findet man direkt an den schön entwickelten Rapswurzeln.“ Die Frosterfahrungen der vergangenen Jahre im Gedächtnis, entschloss man sich für diese Saison, über die Vereinigte Hagel erstmals auch Spätfrostschäden abzusichern. Policen gibt es für Getreide, Raps und Erbsen.
BTV-3-Impfung für Milch- und Fleischrinder
In der 9. Kalenderwoche erhielten die Milch- und Fleischrinder ihre zweite BTV-3-Impfung. Dies ging wie beim ersten Impfdurchgang flott über die Bühne, berichtet Vorstandschef Dr. Stefan Blöttner. Bislang zeigte kein Rind problematische Reaktionen. Berichtete Blöttner vor fünf Wochen an dieser Stelle über die Wolfsaktivitäten in der Region, gibt es wenige Wochen vor Beginn der Weidesaison keine Beruhigung. Im Gegenteil: Die Präsenz der Raubtiere habe eher zugenommen. Phillip Rose, Leiter der Milchviehproduktion, konnte sie nach Feierabend auf freiem Feld Richtung Steinberg in Teichel beobachten.
Drei Wölfe auf einem Raps-Fels in Thüringen
Die Mitarbeiter des Lohnunternehmens, die im Nachbarbetrieb in Remda organischen Dünger ausbrachten, konnten drei Wölfe auf einem Rapsfeld fotografieren. In den frühen Morgenstunden des 7. März fanden sich unweit des Teichrödaer Nachbardorfes Heilsberg die Überreste eines gerissenen Mufflonwidders.

Ungeachtet dessen ist der neue französische Charolaisbulle in der Herde.
Er erfüllt hoffentlich die Erwartungen, die Mutterkuhchef Jens Schmidt an ihn hat. Im April soll der Auftrieb beginnen.

Entgegen den Planungen konnte die Biogasanlage erst Ende der ersten Märzwoche voll hochgefahren werden. Nach Verzögerungen beim Aufbau des neuen BHKW im Januar spielte der Frost bzw. der Arbeitsschutz nicht mit. Die Monteure konnten aufgrund von Glättegefahr nicht auf dem BHKW-Container arbeiten. „Alles in allem haben wir fast drei Monate verloren“, so Blöttner. Nicht zuletzt musste man sich mit den Anwohnern arrangieren, weil während der Umbauphase überschüssiges Gas abgefackelt wurde, was zu Lärmbelastung führte.
Neue Baustelle im Dorf
Während man diese Baustelle hinter sich hat, tut sich im Dorf eine neue auf: „Ein Brückenbau verlangt, für einige Anwohner eine Umleitung einzurichten. Die führt über einen Wirtschaftsweg, wofür Ausweichbuchten auf unseren Flächen für den Gegenverkehr eingerichtet wurden.“ Eine größere Straßenbaumaßnahme soll in Richtung Remda starten und tangiert die Einfahrt auf das Betriebsgelände: „Hier wissen wir noch nicht, wie der Verkehr geführt wird. Für uns bahnen sich einige Hindernisse an. Nicht zuletzt ist das Betriebsgelände eine vielversprechende Abkürzung. Trotz Hinweisschildern und verschlossener Tore wird immer wieder über das Firmengelände gefahren. Gerade in Zeiten von Tierseuchen sind diese Durchfahrten Dritter sehr kritisch zu sehen und absolut nicht im Interesse der Genossenschaft.“

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Im Vorfeld einer Fachtagung des Julius-Kühn-Instituts (JKI) stellten sich Prof. Dr. Jürgen Gross, Leiter des JKI-Institutes für Obst- und Weinbau, und Dr. Sabine Andert, JKI-Leiterin des Institutes für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland, den Fragen der Journalisten. Zum Auftakt informierte Prof. Gross kurz über die Zikade, die vor allem Anbauer, Verarbeiter, Beratung und Wissenschaft angesichts ihrer rasanten Ausbreitung vor ungekannte Aufgaben stellt.
„Tatsächlich steht die Schilf-Glasflügelzikade immer noch auf der Liste der bedrohten Arten – auch wenn das inzwischen nicht mehr stimmt.“ Sie sei lange sehr selten gewesen, deshalb nicht gut erforscht, erklärte der langjährige Vektor- und Phytoplasmenforscher. Sie kam nur auf Schilfgras vor, bis sie in den 1990-ern in Burgund, Frankreich, erstmals an Zuckerrüben aufgetaucht sei und den Anbau dort sehr schnell zum Erliegen gebracht habe. Daraufhin sei sie dort wieder verschwunden.
Zikade bereitet sich seit 2008 aus
Ab 2008 jedoch habe sie sich in Deutschland, ausgehend aus dem Raum Heilbronn, sehr schnell und stark verbreitet: „An Zuckerrüben hat sie inzwischen die meisten Bundesländer erobert, 2022 ist sie auf die Kartoffel übergegangen und seit letztem Jahr auf Gemüsekulturen, allen voran Rote Bete und Karotte. Daneben gibt es Funde in weiteren Kulturen wie (Wurzel-)Gemüse, Erdbeeren, Kräuter, Kohl oder Spargel.“

Das ließe den Schluss zu, dass die Zikade offenbar extrem wenig spezialisiert ist, diese Arten seien ja zum großen Teil nicht miteinander verwandt. Als eine Erklärung könnten die riesigen Populationen dienen, die sich auf befallenen Flächen aufbauten: So gäbe es Felder, auf denen an jeder Pflanze 50 bis 100 Nymphen hängen. Dieser Druck treibe die Zikade möglicherweise dazu, weitere Pflanzenarten zu besiedeln.
Lebenszyklus der Zikade
Folgendes, erklärte Prof. Gross weiter, sei über den Lebenszyklus der Schilf-Glasflügelzikade bislang bekannt: Nach einer zwei- bis dreimonatigen Flugphase, beginnend etwa Mitte/Ende Mai, legt sie Eier im Boden ab. Die Larven, Nymphen genannt, fressen an den Kartoffeln oder Rüben und bleiben nach der Ernte im Boden, wo sie schnell in tiefere Bodenschichten abwandern. Sie überdauern an den Wurzeln des meist folgenden Winterweizens oder anderer Nachfrüchte, bis im Folgejahr adulte Zikaden schlüpfen, die in neue Zuckerrüben- oder Kartoffelbestände einfliegen. Dort übertragen sie bei ihrer Saugtätigkeit sehr schnell zwei Erreger: das Stolbur-Phytoplasma (Candidatus Phytoplasma solani, kurz PHYPSO) sowie ein Proteobakterium (Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus, kurz ARSEPH). Nicht infizierte Zikaden nehmen die Erreger von befallenen Pflanzen auf und übertragen sie weiter, ARSEPH kann sogar über die Eier an die Nachkommen übertragen werden.
SBR und Stolbur: Befallsflächen und Bekämpfungsstrategien
Dr. Sabine Andert vom JKI-Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland konnte neue Zahlen zu den Befallsflächen in Deutschland bereitstellen: Danach sind SBR- und Stolburbefall im vergangenen Jahr auf 85.000 ha Zuckerrübenflächen und 22.000 ha Kartoffeln nachgewiesen worden. Zu befallenen Gemüseflächen gibt es bislang keine Befallszahlen. „Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein haben wir in allen Bundesländern Fänge an Klebefallen zu verzeichnen. Im Norden und Osten noch wenige, aber es gibt dort auch schon ‚Hotspots‘. Wir erwarten die weitere Ausbreitung in den kommenden Jahren“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen. Um so wichtiger sei es daher, dass Forschung, Beratung und Wirtschaft sich gemeinsam um Bekämpfungs- und Kontrollstrategien bemühen.

Zahlreiche Kooperationen haben hier vor allem im vergangenen Jahr angesetzt, um nach solchen Strategien zu suchen. Dabei habe sich herauskristallisiert, dass die Fruchtfolge derzeit die effizienteste Möglichkeit zur Unterbrechung der Populationsdynamik der Zikade sei: „Klassisch steht nach der Zuckerrübe Winterweizen, dessen Wurzeln bieten den Nymphen Nahrung. Auch weitere Winterkulturen einschließlich Zwischenfrüchten tun das. Topfversuche am LTZ Augustenberg haben ergeben, dass die Überlebensraten der Nymphen im Boden unter Zuckerrüben bei 60 % liegen, an Weizenwurzeln bei 50 %, an Gerste bei 30 %, an Senf und Soja bei 10 %, an Ölrettich und Ramtillkraut noch bei etwa 5 %. Leider sind derzeit keine Zwischenfrüchte bekannt, die einen vergrämenden oder abtötenden Effekt haben könnten.“
Einzig die Schwarzbrache, fährt sie fort, sorgt für eine deutlich erhöhte Mortalität der Nymphen, weil Nahrung fehlt. Hier liege die Überlebensrate bei nur 2 %. „Damit ist Schwarzbrache die einzige uns momentan bekannte Strategie zur Populationsbegrenzung.“

„Natürlich“, fügte Prof. Gross im weiteren Verlauf des Gespräches an, „ist uns die Brisanz dieses Ergebnisses sowohl aus regulatorischer als auch aus ackerbaulicher Sicht bewusst. Das kann keine langfristige Strategie sein. Aber wir Wissenschaftler können eben nur Daten liefern, am Ende muss die Politik entscheiden.“
Zu eventuell positiven Auswirkungen verschiedener Bodenbearbeitungsvarianten konnte Dr. Andert noch keine belastbaren Ergebnisse liefern. „Die Tiere wandern nach der Ernte schnell in die Tiefe. Möglicherweise kann eine Pflugfurche unmittelbar nach der Ernte die Nymphen schädigen, da braucht es aber weitere Untersuchungen.“
JKI: Streifenversuche zu Bekämpfungsstrategien
In Streifenversuchen an 41 Standorten hat das JKI im vergangenen Jahr gemeinsam mit weiteren Akteuren Insektizide und verschiedene Pflanzenhilfsstoffe und -stärkungsmittel auf ihre Wirksamkeit untersucht. Hier gibt es, kann Dr. Andert konstatieren, vielversprechende Ergebnisse durch den Einsatz von Insektiziden. Eine Bekämpfung wird jedoch immer schwierig sein, weil der Zuflugzeitraum sehr lang ist und die Krankheit schon mit den ersten Probestichen übertragen werden kann. „Wir setzen die Versuche fort, am Ende dieses Versuchsjahres werden wir auskunftsfähiger sein. Uns ist allerdings daran gelegen, auch geeignete biologische Produkte zu untersuchen, denn wir wissen, dass die geprüften Präparate – Pyrethroide, Flonicamid und Acetamiprid – aus gesellschaftlicher Sicht diskussionswürdig sind.“ So hätten einjährige Versuche mit insektiziden und biologischen Beizvarianten an Folgekulturen auch ertragsrelevante Effekte ergeben, auch hier ist weitere Forschung nötig.
Schilf-Glasflügelzikade: Kein Pflanzenschutzmittel zugelassen
Derzeit sei kein Pflanzenschutzmittel gegen die Schilf-Glasflügelzikade zugelassen. Jedoch gäbe es sowohl für Zuckerrüben als auch Kartoffeln Anträge auf Notfallzulassungen, die derzeit geprüft würden. Dr. Andert bremst allerdings zu hohe Erwartungen: „Wegen des langen Zuflugzeitraumes und der schnellen Übertragung ist nicht damit zu rechnen, dass eine Notfallzulassung in diesem Jahr erfolgversprechend ist.“
Obstbau: Pilz Pandora Cacopsyllae
Neben den konventionellen Strategien befasst sich die Wissenschaft auch mit alternativen Bekämpfungsmöglichkeiten, die stellte im Anschluss Prof. Gross vor. Da wäre zum einen der entomopathogene Pilz Pandora Cacopsyllae. Dieser aus dem Obstbau bekannte Pilz befällt Schaderreger, in diesem Fall die Nymphen der Zikade, und bringt sie zum Absterben. „Ich stelle mir eine biologische Bekämpfung etwa mithilfe eines Granulates vor, das in den Boden eingearbeitet wird und die Nymphen abtötet. Aber natürlich ist das noch ganz am Anfang.“
Ein weiteres spannendes Projekt, ergänzt der Wissenschaftler, befasse sich mit den Gesängen der Zikaden. Hier gäbe es Untersuchungen aus den USA an dortigen Rebzikaden: „Wir könnten eine Art künstlichen Rivalengesang erzeugen, der die Männchen dazu treibt, immer weiterzusingen, anstatt die Weibchen zu befruchten. Bei den Rebzikaden klappt das, da singen die Männchen, bis sie vor Erschöpfung tot vom Blatt fallen.“
Schilf-Glasflügelzikade: Notfallzulassungen gefordert
Auch Lock- oder Repellentstoffe werden auf ihre Eignung als biologisches Hilfsmittel untersucht, ebenso Mikroorganismen. Hier, sagt Prof. Gross, „könnten die Kulturen mit Stoffen besprüht werden, die die Zikaden daran hindern, in die Bestände einzufliegen. All diese Projekte sind aber ausnahmslos sehr langfristig gedacht. Bis dahin brauchen wir Notfallzulassungen und Schwarzbrache, um den Anbau zu erhalten.“
Ebenso, auch diese Entdeckung wurde wie alle anderen auf dem Fachgespräch vorgestellt, gibt es eine Wildkartoffelart, die für die Zikade tödliche Inhaltsstoffe enthält. Sie könnte unter Umständen als Fangpflanze eingesetzt werden, aber auch hier sind die Untersuchungen noch nicht weit fortgeschritten.
Angesprochen auf züchterische Erfolge in den Kulturen selbst, gab sich Prof. Gross eher zurückhaltend: „Wir haben in Zuckerrüben Sorten mit einer Toleranz gegen das Proteobakterium gefunden, aber es gibt keine gegen das Stolbur-Phytoplasma. Generell ist die Rübe genetisch eher eng, da sehe ich auch nicht wirklich, dass wir etwas finden. Stand jetzt gibt es keine Sorten mit einer Überlegenheit gegenüber anderen. Das Genom der Kartoffel ist deutlich breiter, da gibt es durchaus Kandidaten, die bei Befall ertragsstabiler sind als andere. Da sind die Züchter aber noch viel zu sehr am Anfang. Wenn sie moderne Züchtungstechniken nutzen dürften, wäre sicher eher eine Lösung in Sicht.“
Fazit: JKI fordert Strategien zur Kontrolle
Die weitere Entwicklung sei nicht vorhersehbar, wurde deutlich. In Hessen sei bereits der Saatkartoffelanbau eingestellt worden. Wenn das in Bundesländern mit viel Saatkartoffelerzeugung passiere, sei das ein ernstes Problem. Zudem treten neue Symptome an Lagerkartoffeln auf, die als eigentlich gesund ins Lager gingen. Sie zeigten Druckstellen, die Abschläge zur Folge haben können. In Sachen Bekämpfungsstrategien sei man zu dem Schluss gekommen, dass es keine Einzelmaßnahmen gebe, die empfohlen werden können. Das JKI spreche sich für einen kombinierten, komplexen, integrativen Bekämpfungsansatz aus, mit dem das Problem kurzfristig angegangen werden könne. Kontrollstrategien müssten über die gesamte Fruchtfolge gedacht werden.
Ein solcher kombinierter Ansatz aus Fruchtfolgegestaltung, Düngung, Insektizidbehandlung und weiteren Maßnahmen wurde im vergangenen Jahr in einer großflächigen Modellregion in Baden-Württemberg und Bayern ausprobiert. Laut Dr. Andert war zu erkennen, dass im Inneren der Modellregion die Erträge positiv auf die Maßnahmen reagierten.
Mehr Informationen über die Zikade und die Krankheiten finden Sie auch auf der Seite des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft unter www.praxis-agrar.de

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Aus ganz Mecklenburg-Vorpommern wird immer wieder gemeldet, dass Wölfe gesichtet wurden. Mitte Januar waren es innerhalb weniger Tage sogar zwei Wolfssichtungen in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. Da einer der Wölfe ohne Scheu und seelenruhig durch das Dorf gelaufen sei, wurde der Vorfall an die Gemeinde gemeldet, die daraufhin einen Antrag auf Entnahme an die Untere Naturschutzbehörde geschickt hat.
Möglicher Wolfsriss von acht Schafen
Anfang März waren in Pankelow, südöstlich von Rostock, sechs Mutterschafe und zwei Lämmer mutmaßlich von Wölfen gerissen worden. Nach Angaben des betroffenen Landwirts war die Weide durch einen 1,20 Meter hohen Stacheldrahtzaun gesichert. Ein Rissgutachter untersuchte die Tiere und entnahm DNA-Proben. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen jedoch erst in ein paar Wochen vor.
Wolfsrudel nahe Rostock aufgezeichnet
Erst vor ein paar Tagen zeichnete eine Wärmebildkamera bei Groß Lüsewitz nahe Rostock ein Wolfsrudel mit sechs Tieren auf. Jäger der dortigen Hegegemeinschaft vermuten ein neues Rudel. Allerdings könnte es sich auch um ein bereits registriertes Rudel handeln, das lediglich weitergezogen ist, so Dr. Norman Stier, Koordinator des Wolfsmonitorings www.wolf-mv.de
Forderung nach Regulierung des Wolfsbestandes
Mit der steigenden Zahl der Wölfe und den Sichtungen wächst nicht nur die Sorge der Weidetierhalter, sondern auch die der ländlichen Bevölkerung.
Das hat die CDU-Fraktion zum Anlass genommen, einen Antrag zur Regulierung des Wolfsbestandes auf die Tagesordnung der 99. Sitzung des Schweriner Landtages am 12. März 2025 zu setzen.
Die seit vielen Jahren durch das Land MV und das Bundesamt für Naturschutz veröffentlichten Zahlen zur Ausbreitung des Wolfes in Deutschland und MV entsprechen nicht der Realität. Das zumindest behauptet die Fraktion der CDU in ihrem Antrag.
CDU: Sorgen werden nicht ernst genommen
Laut Verfasser des Antrages Daniel Peters, CDU-Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Landtages MV, sei die Zahl der Wölfe im Land nicht exakt bekannt. Weder das Wolfsmonitoring noch die Aussagen des zuständigen Ministers für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt lieferten klare Angaben, sodass lediglich Schätzungen vorlägen. In der öffentlichen Kommunikation werde die Sorge der Bevölkerung über Wolfssichtungen in der Nähe menschlicher Siedlungen häufig als unbegründet oder übertrieben dargestellt. Die kritische Urteilsfähigkeit der Menschen werde dabei pauschal infrage gestellt. Es bestehe ein offensichtlicher Mangel an Transparenz und Genauigkeit bei der Bewertung von Wolfsrissen, insbesondere bei toten Wildtieren, wodurch die tatsächliche Gefährdungslage unzureichend erfasst werde.
Schutzstatus des Wolfes herabgesetzt
Die Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfes durch die Europäische Union eröffnet laut Peters neue Möglichkeiten für eine regulierte Bejagung. Es sei jedoch zu befürchten, dass bestehende ideologische Vorbehalte innerhalb der Landesregierung und insbesondere im Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt eine pragmatische und wirksame landesrechtliche Regelung weiterhin behindern. Der günstige Erhaltungszustand gemäß Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) sei in Deutschland bereits erreicht und gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe e der FFH-Richtlinie sei eine Reduzierung des Wolfsbestandes schon jetzt möglich.
Wolfsmanagement in MV
Daher werde die Landesregierung aufgefordert, aktuelle Bestandszahlen zur Ausbreitung des Wolfes in MV, die Sichtungen und Meldungen berücksichtigen, sofort zu veröffentlichen. Der Wolfsmanagementplan des Landes müsse bis zum 1. Januar 2025 korrigiert werden und an die neuen Bestandszahlen angepasst werden. Alle rechtlichen Möglichkeiten zur Reduzierung des Wolfsbestandes in MV seien sofort umzusetzen und das Wolfsmonitoring in MV gehöre überprüft.
LSZV-Wolfsbeauftragter: Woher sollen solide Zahlen kommen?
Laut Jürgen Lückhoff, ehemaliger Landesvorsitzender des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes (LSZV) MV und Wolfsbeauftragter des Verbandes, ist der Antrag der CDU MV zum großen Teil ein reines Scheingefecht.
Dass die durch das Wolfsmonitoring erhobenen Zahlen die Wirklichkeit nur bedingt abbilden, sei zumindest Weidetierhaltern, Jägerschaft und auch der Landbevölkerung seit langem bekannt. Wer klare Angaben fordere, solle auch sagen, wie solide Zahlen konkret festgestellt werden können.
Unabhängig davon dürften die öffentlichen Zahlen zum Wolfsbestand und die jährlichen Rissvorfälle im Land ausreichend sein, um zu einem umsetzbaren Reaktions- und Bestandsmanagement zu kommen, so die Meinung von Lückhoff.
Praxisleitfaden Wolf kaum umsetzbar
Der auf Vorschlag der Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) von allen Landesumweltministern beschlossene Praxisleitfaden Wolf und seine Empfehlungen zur schnelleren Entnahme habe sich bisher eher als viel zu bürokratisch gezeigt. Er sei von den zuständigen Behörden kaum umsetzbar und Entscheidungen auf dieser Grundlage seien wiederholt vor Gerichten gescheitert. Ein wirkliches Reaktionsmanagement auf Übergriffe fehle.
Plan zur Bestandsregulierung muss vorbereitet werden
Auch wenn die EU-Kommission erste positive Reaktionen zeige, müsse sowohl der EU-Rat als auch das EU-Parlament einer Änderung der FFH-Richtlinie zustimmen. Das brauche Zeit. Diese Zeit könne die neue Bundesregierung nutzen, um die notwendigen Gesetzesänderungen vorzubereiten, den guten Erhaltungszustandes des Wolfs in Deutschland oder zumindest regional nachzuweisen und Wege zur notwendigen Bestandsregulierung vorzubereiten. Diese Forderungen haben laut Lückhoff die Ministerpräsidenten aller Bundesländer bereits im letzten Sommer an die Bundesregierung gestellt.
Mangelnde Kenntnisse europarechtlicher Grundlagen
Der erste Wolfsmanagementplan in Mecklenburg-Vorpommern stamme aus dem Jahr 2010 und sei 2021 überarbeitet worden. „Man kann ihn erneut aktualisieren. Aber mit welchem Ziel? Wäre es nicht wichtiger, den vorliegenden Plan daraufhin zu überprüfen, welche Ziele oder Festlegungen mit welchem Ergebnis umgesetzt oder warum sie nicht umgesetzt wurden?“, so Lückhoff.
„Die Forderung, die Landesregierung solle eine Obergrenze für Mecklenburg-Vorpommern festlegen und wolfsfreie Zonen ausweisen, weist eher auf eine mangelnde Kenntnis der europarechtlichen Grundlagen und der bisher dazu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes hin“, kritisiert Lückhoff den CDU-Antrag.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Der QS-Sanktionsbeirat hat in einer kurzfristigen Sondersitzung am 25. Februar 2025 das Sanktionsverfahren gegen die RVZ-Raiffeisen Viehzentrale GmbH (RVZ) abgeschlossen. Grund für das Verfahren waren mehrere gravierende Unregelmäßigkeiten bei der Lieferung von Rindern, die von QS (Qualität und Sicherheit GmbH) festgestellt wurden. Die RVZ habe im Rahmen des Verfahrens die Möglichkeit zur Stellungnahme, heißt es von QS auf Anfrage der Bauernzeitung.
Konsequenzen für RVZ und verbundene Unternehmen
Auf Empfehlung des Sanktionsbeirats beendet QS die Zusammenarbeit mit der RVZ und den konzernverbundenen Unternehmen NVG-bovex GmbH, probovi GmbH und Anilog GmbH.
- Die RVZ ist seit dem 3. März 2025 für die Stufe Tiertransport im QS-System gesperrt.
- Die Zulassung der Unternehmen Anilog GmbH, NVG-bovex GmbH und probovi GmbH endet zum Ablauf des 30. Juni 2025.
- Die RVZ ist noch bis zum 25. April 2025 als landwirtschaftlicher Bündler zugelassen.
RVZ nimmt Stellung
In einem Schreiben an Kunden und Geschäftspartner hat die Raiffeisen Viehzentrale GmbH (RVZ) auf die Mitteilung der QS Qualität und Sicherheit GmbH reagiert. In einer Mitteilung vom 26. Februar 2025 hieß es, dass dies mit sofortiger Wirkung für die RVZ gilt, während für Bündler eine Frist bis Ende April und für den Transportbereich bis Ende Juni 2025 vorgesehen ist. Der Ausschluss basiere auf Widersprüchlichkeiten bei Lieferungen im Bereich Großvieh, die zwischen November 2023 und Januar 2024 aufgetreten sind.
Laut RVZ geht es um Widersprüchlichkeiten in den Lieferpapieren der früheren Gesellschaft RVG, die nach der Fusion mit der VZ Südwest in der RVZ aufgegangen ist. Im oben genannten Zeitraum sei es in der damals verantwortlichen RVG offensichtlich zu widersprüchlichen Angaben auf Lieferscheinen gekommen – konkret stimmten Angaben bei Lieferung von Schlachtbullen nicht mit den dazugehörigen Lieferpapieren überein, gibt RVZ zu.
Unstimmigkeiten auf Lieferscheinen
Die RVZ habe umgehend nach Bekanntwerden der Problematik eine unabhängige Prüfung durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunternehmen sowie eine interne Überprüfung ihrer Systeme veranlasst. Dabei sei festgestellt worden, dass es in dem betreffenden Zeitraum tatsächlich zu Unstimmigkeiten auf Lieferscheinen gekommen ist. Um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, habe die RVZ ihr Qualitätsmanagement überarbeitet und Schulungen zu den internen Abläufen initiiert.
Aktuell sei die RVZ bis auf Weiteres handlungsfähig und arbeitsfähig. Sowohl als Bündler, als auch in der Logistik verfüge man weiterhin über eine QS-Zertifizierung und werde alle Verpflichtungen gegenüber Kunden und Partnern sowie Einsender erfüllen können, so die RVZ.
Auswirkungen auf Landwirte und Tiertransportunternehmen
Landwirtschaftliche Betriebe und gebündelte Tiertransportunternehmen, die bisher über die RVZ am QS-System teilnehmen, sollen sich frühzeitig um die Bündelung durch einen anderen zugelassenen QS-Bündler bemühen, heißt es bei QS. Andernfalls gefährden sie ihren Status als QS- und gegebenenfalls ITW-Betrieb, teilt QS mit. Eine Liste der zugelassenen Bündler ist auf der QS-Webseite unter www.q-s.de einsehbar.
Auswirkungen auf andere Unternehmen
Auch andere Unternehmen, die im Rahmen des QS-Systems geschäftliche Beziehungen mit der RVZ oder den genannten Tochterunternehmen unterhalten, sind von den Konsequenzen betroffen.
QS-Bündler Tierproduktion im Osten
QS-Bündler Tierproduktion im Osten sind die LMS Agrarberatung (MV), der pro-agro-Verband (BB), der Landeskontrollverband (ST), der Landesbauernverband (SN) und die TBV-Service und Marketing GmbH (TH) sowie einige Verbände und Unternehmen: Biopark-Marktgesellschaft (MV), Plukon Agri Deutschland GmbH (MV), Fläminger Entenspezialitäten GmbH & Co. KG (ST), Wimex Agrarprodukte Import & Export GmbH (ST).
Keine öffentliche Stellungnahme von QS zu Details
RVZ habe im vertraglich vorgesehenen Sanktionsverfahren bei QS Einspruch eingelegt und stehe mit QS in Gesprächen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit QS gute Lösungen für die Zukunft zu finden, um auch nach Ablauf der von QS genannten Fristen weiter unsere volle Geschäftstätigkeit aufrechterhalten können“, heißt es in der Stellungnahme von RVZ. QS nimmt zu weiteren Details der Vorwürfe, die zur Sperrung geführt haben, öffentlich nicht Stellung, heißt es auf Anfrage.
QS: Prüfsystem für Lebensmittel
Das QS-Prüfsystem für Lebensmittel ist der führende Standard für Lebensmittelsicherheit in Deutschland. Es steht für Qualitätssicherung vom Landwirt bis zur Ladentheke. Das QS-System definiert nach eigenen Angaben die Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung entlang der gesamten Wertschöpfungsketten für Fleisch, Obst, Gemüse und Kartoffeln.
Das sagt der ISN
Der ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. teilte mit: „Im Rinderbereich haben höhere Haltungsstufen seit 2023 eine enorme Nachfrage erfahren. Mit einem Ausschluß aus dem QS-System schwebt ein sehr scharfes Schwert über der Branche, sollte es zu Unregelmäßigkeiten auf den jeweiligen Ebenen kommen.“ Andererseits gelte es aber auch, eine Verhältnismäßigkeit im Auge zu behalten. „Nach Angaben der RVZ sollen bei gut 1.100 Bullen falsche Angaben zur Haltungsform gemacht worden sein. Das ist selbstredend lückenlos aufzuklären!“ Ein solcher Vorfall dürfe aber nicht zum Anlass genommen werden, bäuerliche (genossenschaftliche) Vermarktungsstrukturen zu zerschlagen.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Eine Münze hat über das Leben von Jana Gäbert entschieden. Als sie sich nicht sicher war, welches Studienfach sie wählen sollte, warf die junge Frau ein Geldstück – und mit dem Studium der Nutztierhaltung wurde aus dem Stadtkind eine Landwirtin aus Leidenschaft! Heute ist sie Geschäftsführerin der Tierproduktion in der Agrargenossenschaft Trebbin und trägt zusammen mit dem Vorstand die Verantwortung für einen 4.000-Hektar-Betrieb mit 120 Mitarbeitenden in Brandenburg. Im Interview berichtet sie von ihrem Leben als Dreifachmutter in einer noch immer von Männern dominierten Branche.
Jana Gäbert: Vorbild für Frauen
Jana Gäbert ist eine echte Powerfrau und dabei ungeheuer bescheiden. Wenn sie davon berichtet, wie schwer es für sie war, wenn sie ihre Kinder als letzte aus der Kita abholte, dann hofft sie nicht auf Mitleid. Die Brandenburgerin sieht im Leben und in der Arbeit eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Sie ist damit Beispiel und Vorbild für Tausende Frauen in der Landwirtschaft. Ohne sie würde im ländlichen Raum viel dörfliches Leben einschlafen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihren Alltag meistern, ringt Respekt und Hochachtung ab. Doch gerade daran mangelt es häufig.
Frauentag: Zu wenig Wertschätzung
Wenn am 8. März der Internationale Frauentag begangen wird, muss an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Landwirtinnen oft unterbezahlt und viel zu wenig wertgeschätzt sind. Das Verrückte daran: In traditionellen Familienbetrieben ist das teilweise noch schlimmer als in größeren Einheiten, wo feste Verträge das Einkommen, Arbeitszeiten und auch Fehltage eindeutig regeln. Dazu kommt, dass es laut der Studie „Frauen in der Landwirtschaft“ aus dem Jahr 2022 in der Agrarbranche auch weiterhin erhebliche Zugangsbarrieren für Frauen gibt.
Studie zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen
Demnach stellen veraltete Geschlechterbilder und traditionelle Vererbungsmuster strukturelle Hindernisse für Frauen dar. Die erste gesamtdeutsche Studie zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft seit der Wiedervereinigung hatte nachgewiesen, dass die Gleichstellung von Frauen auf den landwirtschaftlichen Betrieben noch lange nicht erreicht ist. Darüber hinaus haben insbesondere Mütter oft keine Zeit, sich zu vernetzen oder in beruflichen und politischen Gremien zu engagieren, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen.
Viele Frauen kurz vor dem Burnout
Die enorme Arbeitsbelastung, der Kostendruck, die Unsicherheit und Existenzängste führen laut der Umfrage unter mehr als 7.000 Landwirtinnen dazu, dass 21 % der Frauen das Gefühl haben, kurz vor dem Burnout zu stehen. Oder sie sind dauernd müde. Womit wir bei einem zweiten Thema der Ausgabe 10/2025 sind.
Depression: Noch immer ein Tabu-Thema
Weil mittlerweile viele Landwirtinnen und Landwirte an ihre psychische Belastungsgrenze stoßen, fordert der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) konkrete Hilfsangebote und vor allem einen anderen Umgang mit dem Thema Depression. Psychische Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft ein Tabu-Thema. Besonders in der Agrarbranche passt es nicht zu dem Bild vom starken Mann (oder der Powerfrau). Der Acker will zur rechten Zeit bearbeitet, Tiere müssen täglich versorgt werden. Für Krankheit oder gar Schwäche ist keine Zeit.
Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die mentale Gesundheit gestärkt werden muss. Untereinander – in den Familien und Betrieben – aber auch in der Gesellschaft. Nur dann bleibt die Leidenschaft für den Beruf, so wie ihn Jana Gäbert praktiziert, auch erhalten.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein
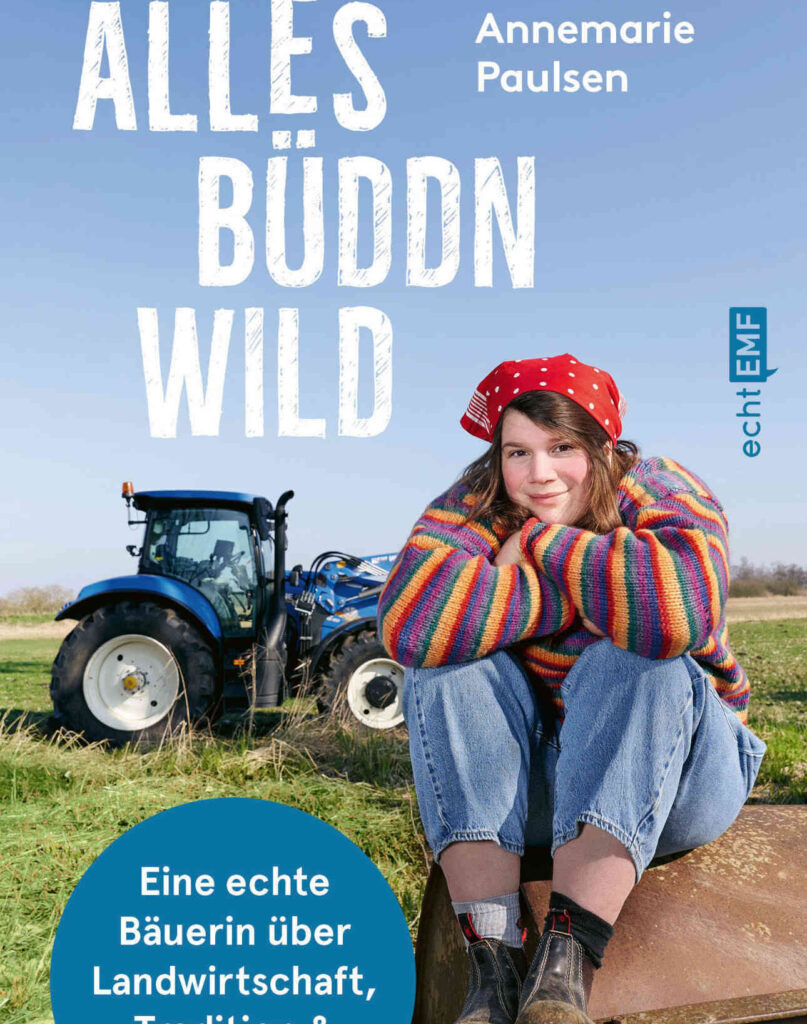
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Nach der Bundestagswahl steht der Regierungswechsel an. Erste Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD laufen bereits. Das war Anlass genug für das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB), getragen vom Bundesverband Bioenergie, dem Deutschen Bauernverband, dem Fachverband Biogas und dem Fachverband Holzenergie, an die künftigen Regierungsparteien zu appellieren, ihre Koalitionsverhandlungen auch mit konkreten und kurzfristig wirksamen Maßnahmen für eine Stärkung der Bioenergie zügig und erfolgreich voranzutreiben.
Bioenergie: Weiterhin unverzichtbar
„Biogas, Holzenergie und Biokraftstoffe sind ein zentrales Element für eine sichere und klimaneutrale Energieversorgung Deutschlands und unverzichtbar für kosteneffizienten Klimaschutz und soziale Akzeptanz“, betont Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüros.
„Der politische Handlungsbedarf bei der Bioenergie ist enorm. Es braucht von der nächsten Bundesregierung nicht nur ein klares politisches Bekenntnis zur Holzenergie, zu Biogas und Biokraftstoffen als essenzielle erneuerbare Energien, sondern ein sofortiges Maßnahmenpaket für die Bioenergie. Die zehn wichtigsten Handlungsfelder und konkrete Vorschläge haben wir vorgelegt. Deren Umsetzung sollte schon im Koalitionsvertrag verankert und zügig nach der Regierungsbildung angegangen werden.“
Nachbesserungen am EEG: Übergangsregeln gefordert
Sehr dringend sind kurzfristige Nachbesserungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). „Mit dem im Januar vom Bundestag verabschiedeten ‚Biomassepaket‘ wurden im EEG zwar wichtige Verbesserungen für die Strom- und Wärmeerzeugung aus Biogas und Holzenergie vorgenommen, doch wurden gleichzeitig ambitionierte Anforderungen an den Anlagenbetrieb eingeführt, die für manche Anlagen ohne einen Übergangszeitraum nicht umsetzbar sind oder zum Teil auch über das Ziel hinausschießen.“
Hier wie in vielen anderen EEG-Regelungen zur Bioenergie bestehe dringender Handlungsbedarf. So brauche es Übergangsregeln für bestehende Anlagen, deren EEG-Vergütung bereits 2025 oder 2026 ausläuft, Verbesserungen, die besonders Kleinanlagen, güllebetonte Biogasanlagen und wärmegeführte Anlagen betreffen sowie Anhebung der EEG-Ausschreibungsvolumina für die Jahre ab 2027. Laut der Verbände sollte auch die unsinnige Diskriminierung bestimmter Substrate durch den erneut abgesenkten Maisdeckel überdacht werden.
Nachbesserungen am EEG: Garant für Energiewende
Darüber hinaus sei die Bioenergie Garant einer kosteneffizienten und sozial akzeptierten Energie- und Wärmewende. Unverzichtbar sei die Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen für alle erneuerbare Energiearten in allen zukünftigen Gesetzestexten. Eine einseitige Priorisierung von Elektrolyse-Wasserstoff oder Diskriminierung von Holzenergie und Biogas, zum Beispiel bei regulatorischen Anforderungen, Anreizsystemen, der kommunalen Wärmeplanung oder in den Förderprogrammen für Wärmenetze und industrielle Prozesswärme, dürfe es nicht geben.
Bioenergie: Jobs im Dorf
Zudem dürfte nicht vergessen werden, dass die Bioenergie nach wie vor ein gewaltiger Innovations- und Jobmotor im ländlichen Raum sei. Sie sichere wichtige heimische Wertschöpfung und zahlreiche Arbeitsplätze in den Dörfern. Rostek forderte von der nächsten Bundesregierung nicht nur ein klares politisches Bekenntnis zur Holzenergie, zu Biogas und Biokraftstoffen als essenzielle erneuerbare Energien, sondern auch ein aktives und wirkungsvolles Handeln gegen Betrug bei Importen und ausländischen Klimaschutzprojekten! „Betrugsfälle müssen konsequent aufgeklärt und der entgangene Klimaschutz nachgeholt werden“, schließt Rostek.
Das Positionspapier mit den zehn Empfehlungen der Bioenergiebranche für die nächste Legislaturperiode steht auf der HBB-Hompage.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!


