Verlängerte Laktation: Was Tierhalter aus der Praxis berichten
Welche Auswirkungen hat eine verlängerte Zwischenkalbezeit und eine verlängerte Laktation auf die Kuh, Milchmenge und andere Faktoren? Das hat das Forschungsprojekt VerLak auf Praxisbetrieben in der Landwirtschaft untersucht.
Eine längere Laktation mit selektivem Trockenstellen spart nicht nur Antibiotika, sondern bringt auch keine Einbußen bei der Milchmenge mit sich. Auch sonstige negative Auswirkungen konnten nicht festgestellt werden, auch nicht aus Praktikersicht. Das sind die wesentlichen Ergebnisse des Forschungsprojektes VerLak, das nach über vier Jahren zu Ende geht. Im Haus der Ernährung und Landwirtschaft in Berlin präsentierten die beteiligten Forschungsinstitute am 1. August unter der Leitung von Dr. Anke Römer zusammen mit beteiligten Praktikern die überzeugenden Ergebnisse.

Was steckt hinter VerLak?
Zentrum steht eine verlängerte Laktationsperiode mit selektivem Trockenstellen zum Senken des Antibiotikaeinsatzes bei Milchkühen. Dabei funktioniert es recht einfach: Durch ein freiwilliges späteres Besamen wird die Laktationsperiode verlängert. Zwar stand die Senkung des Antibiotikaeinsatzes im Zentrum des Projektes, jedoch wurden auch alle weiteren und für Praktiker interessanten Parameter mit untersucht. Dazu zählen unter anderem die Effekte auf die Fruchtbarkeit, Eutergesundheit und Körperkondition sowie Abgangsursachen und -häufigkeit. Für das Projekt wurden zehn Betriebe mit einem frühen Besamungstermin von 42–60 Tagen ausgesucht. Das Konzept war simpel: Es sollten 65 Tiere als Kontrolle betriebsüblich besamt werden und 65 auf Grundlage des tierindividuellen Besamungsstart-Rechners (TBS-Rechner). Das bedeutete in der Regel eine längere Wartezeit. Die Tiere sollten gemischt in den normalen Gruppen mitlaufen, sodass andere Gründe, wie beispielsweise ein anderer Umgang oder Unterschiede im Futter, ausgeschlossen werden können.
So funktioniert der TBS-Rechner
Am Forschungsprojekt waren auf wissenschaftlicher Seite neben der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA MV) auch die Frankenförder Forschungsgesellschaft (FFG Berlin) und das Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere (IFN Schönow) beteiligt. Auf Praktikerseite beteiligten sich zehn Milchvieh-Betriebe in Mittel- und Norddeutschland.
Der TBS-Rechner wurde von Tim Kuhlow und Sierk Terpstra von der LFA MV entwickelt. Dieser berechnet auf Grundlage des sieben-Tage-Durchschnitts der Milchleistung, der angestrebten Milchmenge zum Trockenstellen und ob es sich um Erstlaktierende oder Kühe ab der 2. Laktation handelt, den Besamungszeitpunkt ganz tierindividuell.
Dabei gibt es allerdings noch einige Schwachstellen bei der Berechnung. Da eine Standard-Laktationskurve einer durchschnittlichen Milchkuh die statistische Grundlage für den Rechner bildet, sind die Empfehlungen umso genauer, je näher sich die Leistung des einzelnen Tieres an dieser Standardkurve befindet. Je weiter entfernt, also mit einer höheren oder niedrigeren Milchmenge, umso ungenauer das Ergebnis.
An dieser Schwachstelle soll zukünftig gearbeitet werden. Dafür benötige es zwar noch mehr Daten aus der Praxis, aber je mehr Betriebe den TBS-Rechner tatsächlich anwenden, desto mehr Daten stünden für eine Weiterentwicklung zur Verfügung. Eine weitere Schwäche laut Praktikererfahrungen, ist die fehlende Schnittstelle zwischen TBS-Rechner und gängigen Programmen zum Herdenmanagement. Der Rechner steht als Computer- und Handy-APP zur Verfügung.

Entwicklung der Parameter
Das Hauptziel des Projektes war es, den Antibiotikaeinsatz zu minimieren. Diese Auswertung brachte laut Prof. Volker Krömker von der Hochschule Hannover zwar kein statistisch eindeutiges Ergebnis, lege aber den Trend nahe, dass eine verlängerte Laktationsperiode und damit verlängerte Zwischenkalbezeit auch den Antibiotikaeinsatz reduziert. Das liege vermutlich daran, dass die Tage unmittelbar nach der Kalbung die risikoreichsten für eine Eutererkrankung sind. Dieses Risiko sinkt über die Dauer der Laktation immer weiter. Wenn eine Kuh nun weniger Kälber gebärt, dann sinkt gleichzeitig auch die Summe der Tage mit einem hohen Risiko.
Für die Fruchtbarkeit und die Eutergesundheit zeige sich auch ein insgesamt positives Bild. Beides wurde vom IFN Schönow ausgewertet und von Dr. Christian Fidelak vorgestellt. Der Erstbesamungserfolg lag bei den Erstlaktierenden in der Versuchsgruppe bei nur 43 % im Vergleich zu 50,7 % in der Kontrollgruppe. Dafür war dieser bei den Altkühen ab der zweiten Laktation mit 41,9 % in der Versuchsgruppe um 15 % höher als in der Kontrollgruppe. Der Besamungsindex schnitt in der Versuchsgruppe mit 2,7 leicht besser ab als die Kontrollgruppe mit 3,1.
Der aufgeschlüsselte Besamungsaufwand ist bei Erstlaktierenden in der Versuchsgruppe mit 3,0 höher als in der Kontrollgruppe mit 2,3. Bei den Altkühen war das Bild wieder andersherum: 2,7 in der Versuchsgruppe und 3,7 in der Kontrollgruppe. Im Durchschnitt lagen die beiden Gruppen allerdings nahe zusammen, auch wenn die Versuchsgruppe mit 2,1 besser abschnitt als die Kontrollgruppe bei 2,3. Das Fazit: Erstlaktierende profitieren von einem früheren Zeitpunkt mehr als die Altkühe in Anbetracht der Fruchtbarkeit.
Eutergesundheit insgesamt nicht optimal
Die Laktationen waren in den Versuchsgruppen im Durchschnitt um 41 Tage länger bei den Erstlaktierenden und um 48 Tage länger bei den Altkühen. Die bakteriologische Untersuchung zum Trockenstellen zeigte, dass rund 70 % der Versuchsgruppe und rund 75 % der Kontrollgruppe unauffällig waren. Als infizierte Kühe wurden zwar 16 % der Versuchsgruppe und 11 % in der Kontrollgruppe festgestellt, allerdings zeige dieses Ergebnis keinen statistischen Zusammenhang zur verlängerten Laktation. Insgesamt konnten wenige Effekte durch die Verlängerung der Laktation auf die Eutergesundheit beobachtet werden. Ein Fazit sei, dass die Eutergesundheit auf allen Betrieben nicht optimal war, aber nur wenige Infektionen mit pathogenen Mikroorganismen zum Trockenstellen vorlagen.

Auswirkungen auf den Body-Condition-Score (BCS)
Die Körperkondition wertete Anna-Luise Böhm von der FFG Berlin mithilfe eines vereinfachten Body-Condition-Scores (BCS) aus. Dieser bestand aus drei Stufen, wobei eins für unterernährt und drei für zu fett stand. Dabei konnten auch Noten in 0,25-Schritten vergeben werden. Die Betriebe ermittelten den BCS zum Zeitpunkt des Trockenstellens, zur Kalbung und fünf bis zehn Tage nach der Kalbung.
Dabei zeigte sich, dass Tiere mit kürzerer Zwischenkalbezeit zu einem leicht niedrigeren BCS tendierten. Trotzdem betonte Frau Böhm, dass es zwischen den Betrieben starke Unterschiede gegeben habe. Daraus ließe sich schließen, dass der Effekt des Betriebes (Haltung, Futter, u. ä.) einen größeren Einfluss als die Zwischenkalbezeit habe.
Beeinflusst eine verlängerte Laktation die Abgangsraten und -ursachen?
Die Abgangsraten und -ursachen der Kühe wertete Emmeline Wahls für ihre Masterarbeit aus. Von den insgesamt 1.216 untersuchten Kühen gingen im Laufe der Untersuchung 263 ab. In der Kontrollgruppe gingen 22 % und in der Versuchsgruppe 21 % der Tiere ab. Unterteilt wurde die Untersuchung in die Startlaktation und Folgelaktationen.
In der Startlaktation gingen 133 Tiere der Kontrollgruppe und 130 Tiere der Versuchsgruppe ab. Hauptursache hierfür war Unfruchtbarkeit, gefolgt von Eutererkrankungen und Stoffwechselerkrankungen. In allen Kategorien schnitt die Versuchsgruppe besser ab, außer bei den Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen. Hier lagen die Abgänge in der Versuchsgruppe (4,25 %) prozentual fast doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe (2,15 %). Auf die Anzahl der Tieren gerechnet, bedeutet das allerdings, dass 2,8 Kühe in der Kontrollgruppe und 5,2 in der Versuchsgruppe wegen Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen abgingen.
Für die ersten 30 Tage der Folgelaktation zeigte sich ein ähnliches Bild: In der Kontrollgruppe waren Stoffwechselstörungen der häufigste Abgangsgrund, in der Versuchsgruppe gab es deswegen keinen Abgang. Danach folgten Euter-, Stoffwechsel- und Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen. Bei Letzterem wies wieder die Versuchsgruppe mehr Abgänge als die Kontrollgruppe auf. Als Fazit der Untersuchung der Abgangswahrscheinlichkeit stellte Frau Wahls fest, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass eine längere Laktation zu höheren Abgangsraten führe. Vielmehr könne der Trend zu weniger Abgängen beobachtet werden. Trotzdem sei die Stichprobe für eine statistisch eindeutige Aussagekraft zu klein.

Milchviehhalter sind überzeugt
Teilnehmende Betriebe wie die Agrargenossenschaft Uckermark agrar eG Göritz sind überzeugt von VerLak. Die Herdenmanagerin Alice Nack teilte auf der Tagung ihre Erfahrungen unter der Überschrift „Mut zur Veränderung?“ mit.
Nach eigenem Empfinden sei sie aber gar nicht mutig gewesen, denn bei einem Tierbestand von über 1.000 Kühen die geforderten 130 für den Versuch bereitzustellen, sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Die freiwillige Wartezeit war in der Versuchsgruppe mit 128 Tagen rund 78 Tage länger als bei der Kontrolle. Die Zwischenkalbezeit unterschied sich um 51 Tage von 403 Tagen in der Kontrolle zu 454 Tagen in der Versuchsgruppe. Aber die Ergebnisse haben sie überzeugt. Die Milchmenge je Laktationstag sei in der Versuchsgruppe im Vergleich um 1,8 kg gesunken, aber im 305-Tage-Schnitt wiesen die Erstlaktierenden ein Plus von 100 kg und die Altkühe von 44 kg auf. Ein Faktor, der die Herdenmanagerin überraschte, denn die Leistung der Jungkühe sei auch nach 100 Tagen noch nicht beim Maximum gewesen.
Durch die Betriebsgröße werde mehr auf Durchschnitte geachtet. So wurde die Wartezeit immer für gesamte Stallgruppen erhöht und das von Sommer zu Sommer. Denn die TBS-Empfehlungen für die einzelnen Tiere hätte die Herdenmanagerin noch neben ihren regulären Tätigkeiten vorbereiten und in das Herdenmanagementsystem einpflegen müssen. Ohne eine Schnittstelle zwischen dem TBS-Rechner und gängigen Systemen sei das zusätzlich zur normalen Arbeit unrealistisch. Den Sommer wählte sie als Zeitpunkt, da es in diesen Monaten eh einen schlechteren Besamungserfolg gebe. Dabei sei der Besamungsindex mit steigender Wartezeit kontinuierlich gesunken, vom Ausgangswert 2,4 auf jetzt 2,0–2,1.
Wie gelingt selektives Trockenstellen?
Eine der größten Herausforderungen für Alice Nack war das selektive Trockenstellen und das Eingehen auf das Einzeltier. Das selektive Trockenstellen probierte Alice Nack schon vor ein paar Jahren in den Betriebsalltag zu integrieren. Dieser Versuch scheiterte allerdings und daher wollte sie bei einem Neustart des Vorhabens eine gute Unterstützung. Und diese habe sie im Rahmen des Projektes bekommen. Mit Beratung zum selektiven Trockenstellen gelang es dem Betrieb, dieses erfolgreich einzusetzen.
Zwar hatte der Betrieb im Winter 2023/2024 erneut Probleme mit verschiedenen Erkrankungen, sodass wieder auf das bewährte Trockenstellen mit Antibiotika zurückgegriffen wurde, aber nach wenigen Wochen war wieder alles unter Kontrolle. Dann setzte der Betrieb zum zweiten Mal an und hatte seitdem keine größeren Probleme. Entscheidend war es, auf die Umstände beim Trockenstellen zu achten.
Dazu gehören unter anderem: Trockenstellen erst ab einer Milchleistung unter 30 l/Tag, Zitzenversiegler und das Etablieren von Schalmtests. Letzteres habe vermutlich den größten Mehrwert gebracht, um schnell auf Infektionsgeschehen reagieren zu können. Alice Nack ist von VerLak überzeugt und empfiehlt anderen Betrieben es auszuprobieren. Dafür brauche es, wie bei ihr gar nicht mal so viel Mut, wenn mit kleinen Schritten angefangen wird. Jegliche Befürchtungen seien ausgeblieben und sie sei besonders von der Persistenz der Erstlaktierenden beeindruckt.
Der TBS-Rechner steht auch unter dem folgenden QR-Code zur Verfügung:

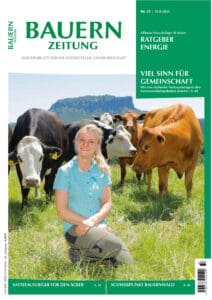
Unsere Top-Themen
- Sabine Eidam – Mit viel Sinn für Gemeinschaft
- Düngung mit Mikronährstoffen
- Schwerpunkt Bauernwald
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

