Dr. Franziska Kersten: „Ich hatte nie das Gefühl, dass wir es nicht schaffen“
Koalitionsvertrag zu Landwirtschaft und Umwelt: Erfahren Sie aus erster Hand von Dr. Franziska Kersten (SPD), Leiterin der Arbeitsgruppe, wie die Verhandlungen zu Landwirtschaft und Umwelt im Koalitionsvertrag liefen und welche Zukunftsperspektiven sich für die Landwirtschaft, besonders in Ostdeutschland, ergeben.
Die Themen Landwirtschaft und Umwelt umfassen etwa neun Seiten im Koalitionsvertrag. Dr. Franziska Kersten, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt und Leiterin der Arbeitsgruppe Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt bei den Koalitionsverhandlungen, gibt in diesem Interview Einblicke in die Ergebnisse der Verhandlungen, die Herausforderungen und die Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft, insbesondere in Ostdeutschland.
Bauernzeitung: Wie sind aus Ihrer Sicht die Verhandlungen der Arbeitsgruppe Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt gelaufen?
■ Franziska Kersten: An uns Agrar- und Umweltpolitikern scheitert der Koalitionsvertrag nicht. Die Gespräche waren sehr konstruktiv. Es gab einmal eine Situation, in der wir uns nicht einig waren – da haben wir zehn Minuten Pause gemacht und dann kam es zur Einigung. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir es nicht schaffen. Natürlich gibt es in einzelnen Punkten unterschiedliche Sichtweisen. Egal ob Düngung, Pflanzenschutz, Wolf oder Direktzahlungen – da gibt es schon in der SPD unterschiedliche Ansichten und es galt, einen Mittelweg zu finden. Manchmal war es mühsam und wir haben um Formulierungen gerungen.
Mit dem Koalitionsvertrag zufrieden
Sind Sie mit dem Koalitionsvertrag, so wie er jetzt abgestimmt wurde, zufrieden?
■ Ich hätte mir verschiedene Punkte schon ein bisschen ausführlicher und manche Formulierungen anders gewünscht. Aber mit dem Gesamtwerk bin ich zufrieden.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die sich positiv auf die Landwirtschaft auswirken werden?
■ Positiv ist die Fortführung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes und die praktikablere Umsetzung. Die Verbindung mit Tierwohl ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ich halte es nicht für sinnvoll, das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz rein auf die Vermarktungsmöglichkeiten zu reduzieren und dann zu vergessen, dass man auch das Tierwohl mitbenennt. Auch die Festlegung, dass wir ein eigenständiges Budget in der gemeinsamen Agrarpolitik Europas haben wollen, ist gut.
Die stärkere Honorierung von Leistungen, die zur Sauberhaltung von Wasser, Luft und der Stärkung der Biodiversität beitragen, war mir sehr wichtig. Für den Biolandbau haben wir die Stärkung des Landbauprogramms durchsetzen können. Darüber hinaus gibt es mehr Investitionen in Forschung und Bildung in dem Bereich. Davon profitieren auch die konventionellen Betriebe. Und es ist gelungen, sowohl konventionelle als auch die ökologische Landwirtschaft als gleichwertige Bewirtschaftungsformen anzuerkennen. Außerdem war die Schaffung des neuen Sonderrahmenplanes Naturschutz und Klimaanpassung ein wichtiges Thema. Hier geht es um die perspektivische Bündelung aller diesbezüglichen Aktivitäten in einer neuen Gemeinschaftsaufgabe.
Dazu ein Beispiel: Gerade Ostdeutschland ist von zunehmender Trockenheit betroffen. Wir brauchen also Lösungen, um mehr Niederschlagswasser in der Fläche zu halten. Dazu müssen dann auch die erforderlichen Finanzmittel bereitgestellt werden. Im Übrigen haben wir im Koalitionsvertrag klar gemacht, dass kooperative Ansätze von Landwirtschaft und Naturschutz für uns grundsätzlich Vorrang haben.
Dr. Franziska Kersten zum Agrardiesel
Unter der Ampel-Koalition haben sich viele Landwirtinnen und Landwirte nicht verstanden gefühlt. Die Kritik an der Regierung wurde immer lauter und mündete in den Bauernprotesten vom vergangenen Jahr. Rückblickend betrachtet, war das der Anfang vom Ende der Koalition? Konnten Sie den Unmut der Agrarbranche verstehen?
■ Ja und Nein. Wenn man sagt, es war der Anfang vom Ampel-Ende – da würden sich die Landwirte ein bisschen überschätzen. Aber die Streichung der Agrardiesel-Rückvergütung plus die Wegnahme der grünen Kennzeichen waren der letzte Tropfen auf den durch zu viel Bürokratie schon heißen Stein. Das war dann ausschlaggebend für die Proteste im Januar – wenn die Landwirte gerade Zeit haben. Es wäre sinnvoller gewesen, die Regierungsentscheidungen mit Fachleuten vorher zu besprechen. Und letztlich wirkte es, als sei keine Strategie dahinter.
Ist aus Ihrer Sicht die Wiedereinführung der Agrardiesel-Rückvergütung richtig?
■ Ich halte es in dieser Vollständigkeit nicht für das richtige Zeichen. Wir hätten damit auch einen Ausstiegsgedanken verbinden müssen. Die Förderung der Elektroenergie kommt zu kurz. Wir wissen, dass ein großer Traktor noch nicht mit E-Ladung funktioniert. Aber die technische Entwicklung geht rasend voran. Es sind also schon Potenziale vorhanden. Mein Wunsch wäre gewesen, hier differenzierter ranzugehen.
Welche Punkte am Koalitionsvertrag sehen Sie kritisch?
Bei der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) haben wir die Formulierungen sehr offengehalten. So haben wir die Erbringung von Klima-, Umwelt- und auch von Tierwohlleistungen und wie wir sie stärker honorieren, noch nicht definiert. Es wird noch einmal eine Debatte geben, wie sich die GAP ab 2028 weiterentwickelt. Die unterschiedlichen Vorstellungen, ob es eine Gemeinwohlprämie geben soll oder ein Punktesystem, das wird uns in den nächsten Monaten sehr fordern.
Landwirte in Ostdeutschland
Können ostdeutsche Landwirte zufrieden sein?
■ Ich denke ja. Wir haben die regional verankerten Agrarbetriebe in der Präambel unseres Kapitels drin und auch die Mehrfamilienbetriebe. Wir haben auch definiert, dass große Betriebe per se nicht schlechter zu stellen sind als kleine Betriebe. Denn sie haben Vorteile in Bezug auf Arbeitserledigung, weil sie auf großen Flächen andere Möglichkeiten haben, Technik einzusetzen, als jemand mit zehn Hektar. Die Agrargenossenschaften sollten ihre Chance begreifen und andererseits auch offener werden für die Förderung von Biodiversität. Wenn ein Betrieb die Bewirtschaftungsmöglichkeit damit verbindet, dass in der Mitte ein Agroforstsystem oder eine Dauerhecke angepflanzt wird – das als Chance anzunehmen, wäre mein Wunsch.
Dr. Franziska Kersten: „Haltet bei der Milch durch!“
In Ostdeutschland erleben wir zurzeit einen Einbruch in der Milchwirtschaft. Auch große Milchbetriebe geben auf. Sind die Formulierungen zum Thema Tierhaltung und Innovation in Ställen ausreichend für die Investitionen, die eigentlich dringend nötig sind?
■ In Ostdeutschland gibt es fast keinen Stall mehr mit Anbindehaltung. Es sind sehr viele neue Ställe gebaut worden. Was wir jetzt formuliert haben, dass neue und umgebaute Ställe einen Bestandsschutz von 20 Jahren haben sollen und für neue Stallsysteme ein Prüf- und Zulassungsverfahren einzuführen – das ist sinnvoll, weil es endlich Planungssicherheit schafft. Dann wissen die Betriebe, wenn sie einmal diesen sogenannten TÜV vollzogen haben, ist es anerkannt und wird als gute Form der Tierhaltung bewertet. Ich versuche die Betriebe zu ermutigen: Haltet bei der Milch durch! Es gibt schon Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und wir brauchen auch die Beweidung und die Weidewirtschaft für den Erhalt der Kulturlandschaft und der Biodiversität.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen lösen finanzwirksame Mehrkosten von insgesamt fast 15 Milliarden Euro aus. Im Koalitionsvertrag steht vieles unter “Finanzierungsvorbehalt”. Wie realistisch ist es, dass die Pläne auch umgesetzt werden?
■ Den Finanzierungsvorbehalt gibt es. Das bedeutet, wir müssen priorisieren, was wir wollen. Für mich ist der Umbau der Tierhaltung mit 1,5 Milliarden Euro nur ein Teil dessen, was tatsächlich notwendig wäre. Wenn wir damit anfangen und es über die einzelnen Tierarten weiterentwickeln, ist es gut. Es geht um die Umsetzung. Wenn das Geld da ist und es keiner abfragt, weil die Richtlinien noch nicht da sind und weil die Leute noch nicht wissen, wie es geht, wäre es fatal. Insofern ist es für mich die richtige Summe.
Der Agrardiesel ist mit 450 Millionen Euro eingepreist. Wichtig und gut finde ich, dass zum Beispiel das „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz” und die Moorschutz-Strategie aufgenommen sind. Landwirtinnen und Landwirte müssen bei der Umstellung auf eine nasse Bewirtschaftung bzw. Paludikultur auch finanziell unterstützt werden.
Streit zwischen SPD und Union vorgrammiert?
Nach den derzeitigen Plänen geht das Agrar-Ressort an die CSU und das Umwelt-Ressort an Ihre Partei – die SPD. Viele Vertreter – z.B. des Bauernverbandes – befürchten, dass Streit zwischen den Ressorts vorprogrammiert ist. Wie sehen Sie das?
■ Es wird mit Sicherheit Themen geben, über die man sich nicht gleich einigt. Aber ich glaube, dass alle Beteiligten verstanden haben, dass man die Themen zusammen denken muss. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir die beiden Arbeitsgruppen unserer Fraktion öfter mal zusammen tagen lassen, damit wir nicht separat Strategien entwickeln. Wenn man erst miteinander redet, wenn alles fertig ist, bringt es eher Missmut.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass deutsche und europäische Vorhaben abgestimmt werden und kongruent laufen?
■ Das ist wichtig und eine Grundvoraussetzung für die GAP. Von Christophe Hansen, dem neuen Agrarkommissar, erwarte ich jetzt auch keine 180-Grad-Wende. Aber ich wünsche mir, dass wir eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie sich Landwirtschaft entwickeln soll.

Ostdeutschland: Besondere Verhandlungen zur GAP
Vor allem die ostdeutschen Agrarminister sind mit einer Initiative an den Agrarkommissar herangetreten, um die Besonderheiten der ostdeutschen Agrarbetriebe deutlich zu machen…
■ Das hat sehr viel mit den Direktzahlungen zu tun. Über den ostdeutschen Betrieben schwebt die Gefahr der Kappung und Degression. Selbst die grünen Agrarminister im Osten haben sich in den letzten GAP-Verhandlungen letztendlich dagegen ausgesprochen. Schließlich müssen wir sehen, dass in den Agrargenossenschaften mehr Menschen beschäftigt und viele Familien davon abhängig sind.
ZKL und Borchert-Kommission haben in Zusammenarbeit vieler Interessengruppen in vielen Punkten Einigung erzielt. Sehen Sie eine Chance, dass die Ergebnisse von ZKL und Borchert-Kommission doch zumindest in Teilen Realität werden?
■ Definitiv. Ich hätte auch gern stärker darauf Bezug genommen. Wir haben es so formuliert, dass wir uns auch auf vergangene Dialogprozesse beziehen. Damit sind natürlich Borchert und ZKL gemeint. Jeder, der ein bisschen drinsteckt, versteht das auch. Es ist eben die mühsame Aushandlung von einzelnen Wörtern.
Bürokratie: Regeln vereinfachen
Stichwort Bürokratie-Abbau: Alle reden davon – nicht nur in der Landwirtschaft. Nach den Bauernprotesten gab es die 194 Vorschläge zum Bürokratieabbau. Für wie realistisch halten Sie es, dass sich tatsächlich etwas bewegt?
■ Diese Vorschläge werden wir neu bewerten. Doppelregeln müssen vermieden werden. Ein Sachverhalt darf am besten nur mit einer Regel oder einer Verordnung abgebildet werden. Wenn wir zum Beispiel Gewässer anschauen: Hier regeln sieben verschiedene Gesetze oder Verordnungen, wieviel Abstand Landwirte zu Gewässern beim Ausbringen von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln einzuhalten haben.

Auch die Doppelerfassung von Daten und unnötige Berichterstattung müssen vermieden werden. Dieser Bürokratieabbau geht mit Sicherheit. Aber wir müssen die rechtlichen Regeln so formulieren, dass wir nicht angreifbar werden. Schließlich haben wir über uns immer noch die EU, die sich anschaut, was wir machen. Dennoch kann man Regelwerke vereinfachen, standardisieren und zielführender gestalten und das werden wir auch zeitnah angehen.
Was halten Sie von Praxischecks?
■ Praxischecks sind mit Sicherheit richtig. Fachleute in den Ministerien formulieren die Regeln. Aber die Verwaltungen müssen das Regelwerk umsetzen. Es ist unbedingt sinnvoll, zu überprüfen, was überflüssig oder unnötig ist. Der Föderalismus macht es auch nicht unbedingt leichter. So gibt es z.B. unterschiedliche Agraranträge in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Landwirte mit Betrieben in beiden Bundesländern sind dann sehr gefordert. Daher haben wir als einen zentralen Punkt beim Bürokratieabbau die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Agraranträge aufgenommen, die wir gemeinsam mit Ländern und Berufsstand umsetzen werden. Wir bräuchten außerdem noch sehr viel mehr Beratung. Und in den Verwaltungen gibt es panische Angst, dass Fehler passieren.
Dr. Franziska Kersten: Ein klarer Fahrplan für den Wolf
Thema Wolf: Wie schnell kann er wirklich in das Jagdgesetz aufgenommen werden – und wie muss dazu das Bundesjagdgesetz verändert werden?
■ Hier gibt es einen klaren Fahrplan: Auf europäischer Ebene muss jetzt die FFH-Richtlinie an die Herabstufung des Schutzstatus in der Berner Konvention angepasst werden. Parallel wird von uns das Bundesnaturschutzgesetz punktuell in Bezug auf den Wolf geändert, um die rechtssichere Entnahme auffälliger Wölfe zu ermöglichen. Außerdem nehmen wir den Wolf ins Jagdrecht auf und stärken weiter den Herdenschutz. Es ist beim Wolf also ein Gesamtpaket. In diesem Zusammenhang werden wir auch einige weitere Punkte im Bundesjagdgesetz erneuern. Es geht da insbesondere um lange überfällige Regelungen zu bleifreier Munition und zum Schießübungsnachweis.
BVVG-Flächen gehen an die Länder
Noch ein wichtiges Thema aus ostdeutscher Sicht. Die BVVG-Flächen werden an die Länder zur Verwaltung übertragen. Ist das die richtige Entscheidung?
■ Ich finde das sehr richtig, weil so die Möglichkeit besteht, die Flächenvergabe mit den jeweiligen Ländern besser abzugleichen. Die Landgesellschaften und Flächenagenturen der Länder haben eine exzellente agrarstrukturelle Kompetenz und wissen am besten, was vor Ort in den Regionen sinnvoll ist. Daher ist es nur folgerichtig, die Verwaltung an die ostdeutschen Bundesländer zu übertragen. Für uns steht hier die Planungssicherheit für die Landwirtschaft im Mittelpunkt. Es gibt dann außerdem einen Pool an Flächen zum Ausgleich, um beispielsweise Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen vernetzt durchführen zu können.
Erfolg der AfD besonders auf dem Land
Wie erklären Sie sich die Erfolge der AfD insbesondere auf dem ostdeutschen Land?
■ Die AfD gibt vermeintlich einfache Lösungen für schwierige Fragen. Der Mensch möchte am liebsten, dass es wieder so wird, wie es immer war. Da ist die Angst vor der Zukunft und dass man seine Lebensweise einschränken muss. Insofern hört man den einfachen Lösungen gern zu. Aber das ist kurz gedacht. Wer sich das Wahlprogramm der AfD genau durchliest, würde merken, dass es für den Einzelnen persönlich gar nicht gut ausgehen würde. Im AfD-Grundsatzprogramm trägt das Landwirtschaftskapitel die Überschrift: „Mehr Wettbewerb. Weniger Subventionen“. Das dort geforderte Zurückfahren der EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip bedeutet nichts anderes als ein Ende der Direktzahlungen.
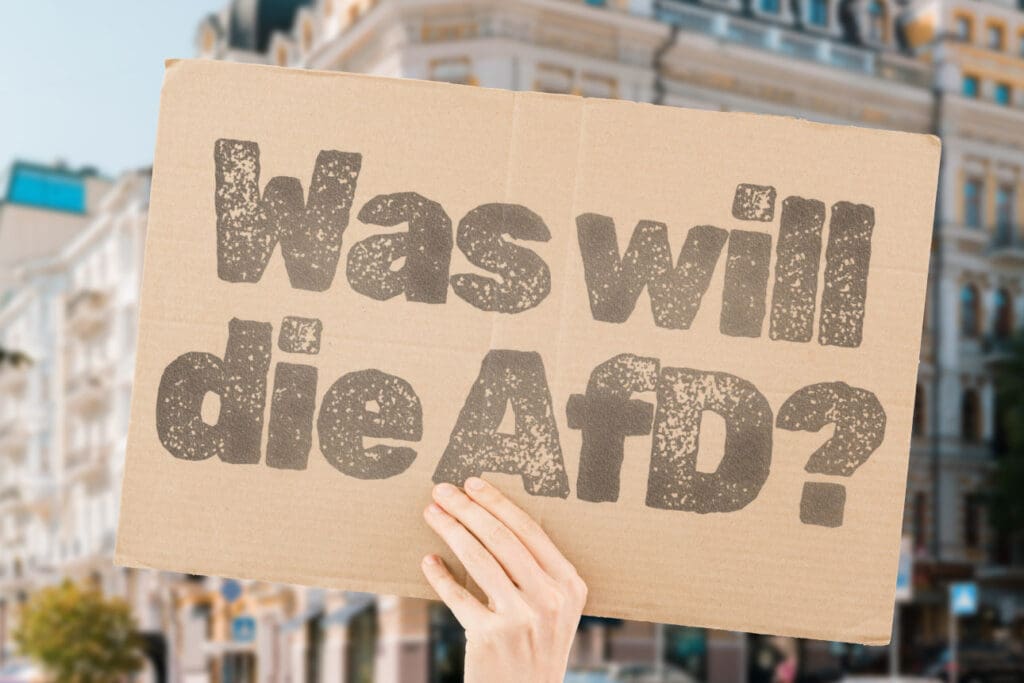
Aber auch an anderen Stellen des Programms wird schnell klar: Die soziale Sicherheit und damit auch der soziale Friede ist infrage gestellt. Uns ist aber auch klar, dass sich viele Menschen im ländlichen Raum abgehängt fühlen und es zum Teil auch sind. Daher ist die Stärkung des ländlichen Raumes auch schon im ersten Absatz unseres Kapitels ein zentrales Thema. Infrastrukturausbau, die deutliche Erhöhung der GAK-Mittel und die Förderung von Wertschöpfung vor Ort stehen für uns ganz oben auf der Agenda. Denn es ist doch klar, dass der ländliche Raum, in dem über die Hälfte unserer Bevölkerung lebt, attraktiv und lebenswert sein muss, um ein Ort des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der gelebten Demokratie sein zu können. Hierfür werde ich mich einsetzen!
Zur Person
Franziska Kersten, geboren 1968 in Lutherstadt Wittenberg, ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ihre berufliche Laufbahn begann sie mit einer Ausbildung zur Rinderzüchterin mit Abitur, gefolgt von einem Studium der Veterinärmedizin in Leipzig. Nach Tätigkeiten als Assistentin in einer Großtierpraxis und als Amtstierärztin im Kreis Heinsberg, wechselte sie in den öffentlichen Dienst. Sie war in verschiedenen Positionen im Bereich Tierseuchenbekämpfung, Arten- und Biotopschutz sowie Landschaftsplanung tätig, so als Geschäftsführerin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH und Vizepräsidentin des Umweltbundesamtes. Im Dezember 2020 wurde sie im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Leiterin des Referats „Natur- und Umweltschutz in der Landwirtschaft“, dann wurde sie in den Bundestag gewählt.
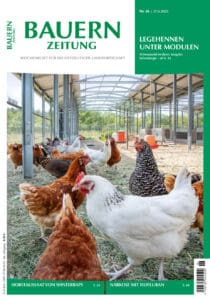
Unsere Top-Themen
- Schwerpunkt Solarenergie
- Feldversuch zur Horstaussaat
- Erntemaschinen-Reinigung
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!



