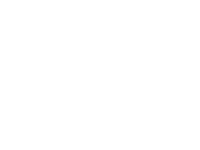Matthias Platzeck: Rückgrat statt Ruhestand
Vom Umweltschützer und Dialogpartner am Runden Tisch zum Politiker: Wir sprachen mit Matthias Platzeck über seine Hoffnungen und Ängste seinerzeit, über turbulente Jahre sowie das Glück, in Frieden zu leben.
Interview: Wolfgang Herklotz
Wo und wie haben Sie den 9. November 1989 erlebt?
An dem Abend saßen wir in Potsdam in kleiner Runde, um eine Kundgebung wenige Tage später vorzubereiten. Wir hatten an dem Tag oder einen Tag vorher, ich weiß es nicht mehr so genau, der Stadtverwaltung das Fußballstadion abgetrotzt. Die Verantwortlichen fanden das zwar unerhört. Es hätte dort noch nie eine Kundgebung gegeben, wurde uns erklärt. Aber irgendwie war auch Resignation im Spiel. Macht doch, was Ihr wollt, hieß es am Ende.
Wer sollte auf dieser Kundgebung sprechen?
Prominente Leute wie Professor Michael Succow, international anerkannter Biologe und mittlerweile Träger des alternativen Nobelpreises, der Schriftsteller und Umweltaktivist Reimar Gilsenbach und viele andere. aus dem ganzen Land. Wir rechneten mit bis zu zehntausend Teilnehmern. Es ging vor allem um die akuten Probleme des Umweltschutzes in der DDR, bei der Vorbereitung am 9. November aber zunächst um ganz irdische Dinge wie Beleuchtung, Einlass, Versorgung… Irgendwann ging dann abends die Tür auf und jemand, der gerade etwas von der Pressekonferenz mit SED-Politbüromitglied Schabowski mitbekommen hatte, äußerte die Vermutung, dass heute oder morgen die Berliner Mauer fallen könnte …
Konnten Sie sich das vorstellen?
Nein, so unmittelbar nicht, obwohl zu dieser Zeit schon einiges in der Luft lag. In unserer Runde herrschte erst einmal Schweigen. Und dann sagte jemand in die Stille hinein: Müssen die das gerade jetzt machen? Alle mussten lachen, aber gleichzeitig wussten wir, dass im Falle der Maueröffnung ganz viele Menschen plötzlich anderes wichtiger finden würden als unsere Kundgebung.
So geschah es dann auch, oder?
Na klar, aber dennoch kamen zu unserer Kundgebung, die sehr stimmungsvoll war, drei- bis viertausend Menschen. Immerhin!


Zur Person
Matthias Platzeck, 1953 in Potsdam geboren, wurde 1990 als parteiloser Vertreter der Grünen Partei in der DDR in die Regierung Modrow aufgenommen und danach in die Volkskammer gewählt. Nach der Wiedervereinigung trat Platzeck dem Bündnis 90 bei und wurde in der Koalitionsregierung von Manfred Stolpe von November 1990 bis November 1998 Umweltminister des Landes Brandenburg. 1993 war er Mitbegründer des BürgerBündnisses freier Wähler und zunächst wieder parteilos, ehe er als Minister in einer SPD-Alleinregierung 1995 in die SPD eintrat. Von November 1998 bis Juni 2002 war Platzeck Oberbürgermeister von Potsdam. Am 26. Juni 2002 wurde er zum Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt. Von November 2005 bis April 2006 war Platzeck Bundesvorsitzender der SPD, seit 2014 ist er Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums.
Zurück zum 9. November. Wo waren Sie am Abend?
Ich bin an der Glienicker Brücke in Potsdam aufgewachsen, deshalb wollte ich nach der Besprechung natürlich noch dorthin. Inzwischen war bekannt geworden, dass an der Bornholmer Straße in Ostberlin schon unzählige Leute standen. Die wollten rüber! Aber an der Glienicker Brücke, bekannt als Grenzübergang der Alliierten und Austauschort von Spionen, tat sich nichts. Sie war streng bewacht, von Amerikanern auf der Westberliner Seite und von Russen auf der ostdeutschen, im Vorfeld noch von Volkspolizisten. Als wir weiterwollten und die Uniformierten auf die Geschehnisse in Ostberlin hinwiesen, gab es erst einmal eine klare Ansage: Dieser Grenzübergang werde auf jeden Fall zubleiben! Eine Ewigkeitsansage also, doch schon einen Tag später bin ich über die Glienicker Brücke gegangen. So schnell war damals eine Ewigkeit vorbei.
Und ad absurdum geführt der Spruch Honeckers, dass die Mauer noch in 100 Jahren stehen werde …
Wenn man wie ich seine Kindheit und Jugend an dieser Brücke verbracht hat, ohne zu wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht, und dann darüber läuft, ist das einfach unfassbar. Eben etwas ganz Besonderes, wenn so eine Grenze nach Jahrzehnten fällt.
Sich zu DDR-Zeiten für Umweltschutz zu engagieren, war nicht ungefährlich, weil schon das Benennen von Missständen schnell als Kritik am Sozialismus verstanden und geahndet wurde. Hatten Sie nicht Angst um Ihre Familie, insbesondere um Ihre drei Töchter?
Ja, keine Frage, diese Momente gab es. Obwohl das doch eigentlich verrückt ist. Wir haben uns 1988 zusammengefunden, weil wir uns nicht zuvorderst als Opposition verstanden, sondern dieses Land verbessern wollten. Das Leben in der DDR sollte freier, offener, bunter werden. Das war sozusagen pro gedacht. Doch später mussten wir in den Akten lesen, dass wir als feindlich-negative Elemente betrachtet wurden. Daran sieht man, wie krank damals schon vieles war. Der Staat konnte mit bürgerschaftlichem Engagement einfach nicht umgehen. Wir haben dann Eingaben gemacht, als sich herausstellte, dass die Kommunalwahlen im Mai 1989 –noch dazu auf solch dumme Weise – gefälscht waren. Die Grundrechenarten haben genügt, um schon beim Zählen der Nein-Stimmen in Potsdam zu wissen, dass die Wahlergebnisse vorne und hinten nicht stimmen konnten.
Was bewirkte Ihre Eingabe?
Ende Mai saßen mir Offiziere der Staatssicherheit gegenüber. Sie meinten, dass unsere Töchter in einem staatlichen Kinderheim besser aufgehoben wären als bei ihren Eltern. Eine klare Drohung! Da kriegt man es schon mit der Angst zu tun. Auf der anderen Seite ging es mir und meinem Freundeskreis gerade um unsere Kinder. Mitte der 80er-Jahre konzentrierte sich die Debatte auf die Frage, ob unsere Kinder hier noch eine Zukunft haben. Leider spaltete sich dann unser Kreis, weil ein Teil die Frage mit Nein beantwortete. Und Ausreiseanträge stellte oder Botschaften besetzte.
Das kam für Sie nicht infrage?
Nein, und für viele meiner Freunde auch nicht. Wir haben uns gesagt, wir sind hierher gestellt, das ist unsere Heimat, wenn auch erheblich missraten. Wir wollten deshalb etwas tun, um sie besser zu machen. Und dachten auch daran, dass wir unsere Eltern in den 70er- Jahren gefragt hatten, was sie im Dritten Reich gemacht haben. Also war klar, dass auch unsere Kinder mal wissen wollen, ob wir nur zugeguckt haben. Meine Heimatstadt Potsdam war am Zerfallen, es gab sogar Pläne, die barocke Innenstadt und das geschichtsträchtige Holländer-Viertel abzureißen. Deshalb wollten wir wenigstens versuchen, etwas zu tun, damit wir unseren Kindern später mal sagen können, wir haben nicht nur auf dem Sofa gesessen. Allerdings konnten wir uns damals nicht vorstellen, dass dann alles so schnell gehen würde. Wir hatten an ganz andere Zeithorizonte gedacht.
Sie saßen von Ende Dezember 89 bis März 90 als führender Vertreter der Grünen Liga an dem von der Kirche initiierten Runden Tisch, um Antwort auf die drängendsten Fragen zu finden. Was ging Ihnen dabei durch den Kopf?
Das war schon eine außergewöhnliche Situation, weil im politischen Gefüge so nicht vorgesehen. Wenn man diese Konstruktion unter rechtlichen, auch verfassungsrechtlichen Aspekten betrachtet, könnte es sie gar nicht geben. Sie hatte nichts mit einer gewählten Regierung zu tun, sondern war aus der friedlichen Revolution heraus entstanden. Als Vorbild galt der Runde Tisch in Polen, der übrigens im Unterschied zu unserem wirklich rund war. Dass dies bei uns möglich wurde, hatte auch damit zu tun, dass die noch existierende DDR-Macht auf tönernen Füßen stand. Und deren Vertreter das auch begriffen hatten, weil die Regierung weder vom Willen des Volkes getragen wurde noch frei gewählt war. So ließ man sich deshalb darauf ein, dass es plötzlich eine solche Institution gab, die die Regierung kontrollierte, begleitete und für politische Stabilität sorgte.
Video: Wie haben Sie den 9. November 1989 erlebt, Herr Platzeck?
Ein Glücksfall somit in dieser schwierigen Zeit.
Ich glaube, dass am Ende diese friedliche Revolution nur eine friedliche und ohne Blutvergießen bleiben sowie dass es zu freien Wahlen kommen konnte, weil es diesen Runden Tisch gab. Dort wurde Koexistenz geübt. Denn an dem Tisch saßen sich Vertreter der neuen wie der alten Macht gegenüber, Auge in Auge sozusagen. Mit sehr viel Fingerspitzengefühl und politischem Geschick leiteten die drei kirchlichen Moderatoren die außerordentlich schwierige Diskussion und brachten diese immer wieder in ein vernünftiges Fahrwasser. Es bestätigte sich, dass die freie Debatte im kirchlichen Raum einen ganz anderen Stellenwert hatte als im staatlichen – die Kirchenvertreter waren also gut vorbereitet.
Ohne die Leistungen dieses Gremiums infrage zu stellen: Haben Sie heute, nach all den Jahren, auch einen kritischen Blick darauf?
Ich finde es bis heute traurig, dass der dort diskutierte Entwurf für eine neue Verfassung Gesamtdeutschlands in der Schublade blieb. Denn manches dieser Probleme, die wir heute haben, fußt auf dem damaligen Beitrittsweg nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Das hinterließ Fehlstellen, die nachwirken. Es wäre so unendlich wichtig für die ostdeutsche Gesellschaft gewesen, auf Augenhöhe, also gleichberechtigt dazuzukommen und mitgestalten zu können. Doch dieses Gefühl war nicht ausgeprägt.
Der Einführung der D-Mark im Juli 1990 folgte schon Anfang Oktober die Wiedervereinigung. Hatten Sie sich diese rasante Entwicklung gewünscht?
Vieles von dem, was wir uns in der Bürgerbewegung damals erhofft hatten, war schlichtweg politisch naiv. Wir sind ja noch im März 1990 mit vielen Träumen und Hoffnungen, die fast Wolkenkuckucksheimen glichen, in die erste freie Volkskammerwahl gezogen. Eine unserer Aussagen von Bündnis 90 lautete ja: Artikel 23 – kein Anschluss unter dieser Nummer! Aber als Demokraten mussten wir dann bei der Wahl akzeptieren, dass 80 Prozent der Menschen auf einem völlig anderen Trip waren.
Es gab ja damals die klare Ansage im Osten: Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr.
Genau! Die Menschen haben das so gewollt, das musste man einfach anerkennen. Leider haben wir in den letzten Wochen vor der Wahl am Willen des Volkes vorbeidiskutiert und eigene Bilder gemalt, aber keiner wollte mehr mitmalen. Dennoch war es mir dann als parlamentarischer Geschäftsführer der Bündnisfraktion in der Volkskammer wichtig, die Haltegriffe aus der ostdeutschen Gesellschaft nicht aus dem Auge zu verlieren.
Wie meinen Sie das?
Wenn man eine kleine, deutlich schwächere Gesellschaft in eine größere überführt und möchte, dass das gutgeht, dann muss die Chance da sein, etwas vom Gewohnten wiederzuerkennen. Wenn aber bei vielen das Gefühl entsteht, mein bisheriges Leben war umsonst, dann kann es kaum gutgehen. Kluge, weitsichtige Politik hätte bedeutet, strukturelle Elemente aus der ostdeutschen Geschichte zu übernehmen, beispielsweise die Betreuung der Kinder in Tagesstätten oder die medizinische Versorgung in Polikliniken. Diese Strukturelemente vom ideologischen Ballast zu befreien und zu übernehmen, hätte DDR-Bürgern signalisiert, auch etwas in die deutsche Einheit eingebracht zu haben. Das ist leider versäumt worden. Wenn heute Umfragen ergeben, dass sich fast jeder zweite Ostdeutsche zweitklassig fühlt, dann hat das auch darin seine Ursachen.
Wenn Sie an Ihre Zeit als Umweltminister und dann als Ministerpräsident Brandenburgs zurückschauen: Was war Ihnen damals wichtig? Und was würden Sie heute anders machen?
Nachhaltig und gut war, dass wir auf die Arbeit von solch engagierten Leuten wie Michael Succow und Matthias Freude aufbauen konnten, die das Nationalparkprogramm entworfen hatten. Dadurch gelang es, das Tafelsilber der deutschen Einheit, wie Klaus Töpfer mal treffend gesagt hat, hinreichend zu schützen und der Nachwelt zu erhalten. Das war nicht einfach und naturgemäß von erheblichen Protesten begleitet. Den heftigsten Streit mit Landnutzern und Bauern gab es ja bei der Einrichtung des Nationalparks Unteres Odertal …
… der ja auch zu heftigen Kontroversen mit Ihrem damaligen Kabinettskollegen Edwin Zimmermann führte.
Knackpunkt war, die landwirtschaftliche Nutzung im Kernbereich des Nationalparks einzustellen. Daraufhin kündigte Edwin Zimmermann wortgewaltig Proteste an, alle eventuellen Schranken würde er selber niederreißen. Wenn ich heute nach Schwedt komme und unter dem Ortsschild den stolzen Zusatz „Stadt am Na-
tionalpark“ lese, freue ich
mich jedesmal. Heute ist man in der ganzen Region froh über diese Entwicklung.
Was ist Ihrer Einschätzung nach nicht so gelungen?
Wir haben zum Beispiel damals zu wenig dagegen unternommen, dass die Abwasserplanungen der Kommunen oft auf Zuwachs von Bevölkerung, Industrie und Gewerbe basierten. Das ging so nicht auf und führte später zu erheblichen Verwerfungen.
Sie haben sich 2013 aus Gesundheitsgründen aus der Politik verabschiedet ...


Wenn man mehr als zwei Jahrzehnte hintereinander exekutive Politik macht, davon elf Jahre als Ministerpräsident, bleibt das nicht immer ohne Folgen. Zumal die 90er-Jahre, wie Manfred Stolpe mal formuliert hat, doppelt zählen. Denn es waren heftige Jahre! Nach dem Schlaganfall 2013 lag ich da und wurde nachdenklich. Eine unserer Töchter, Ärztin von Beruf, fand deutliche Worte für den Ernst der Situation und machte mir klar, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn ich Verantwortung abgebe.
Danach haben Sie jedoch alles andere als den Ruheständler gegeben. Sie waren Schlichter bei verschiedenen Tarifkonflikten, haben um Lösungen beim Kohleausstieg gerungen, sich für eine Normalisierung der deutsch-russischen Beziehungen engagiert … Warum tut man sich das an, wenn man gesundheitlich instabil ist?
Weil es ein Riesenunterschied ist, die volle Verantwortung rund um die Uhr für ein ganzes Bundesland zu tragen oder freiwillig und meist ehrenamtlich Dinge, die man gut und richtig findet, zu tun. Ich bin heute zwar in der Woche noch fast genauso viel wie früher unterwegs, aber der Dauerdruck ist weg, und vieles macht auch Freude.
Was sagt Ihre Familie dazu?
Die kennt mich sehr gut und weiß, dass Däumchendrehen nicht mein Ding ist. Das würde mir nicht gut bekommen.
Auch wenn manche Schlichtung zu einem puren Verhandlungsmarathon geriet?
Die letzte Runde mit der Kohlekommission ging 21 Stunden hintereinander weg. Ohne Pause. So etwas brauche ich schon hin und wieder (lacht).
Wie kommen Sie damit zurecht, wenn Kritiker Ihnen vorwerfen, das Ende der Kohleverstromung zu verzögern und damit grüne Ideale zu verraten?
Das trifft mich nicht, weil es nicht stimmt und ich zudem in all den Jahren auch dazugelernt habe. Wer behauptet, er hätte zu jeder Frage und an jedem Ort recht gehabt, ist nicht von dieser Welt. Ich habe mich gerade in der Kohlekommission dafür verantwortlich gefühlt, dass nicht noch einmal passiert, was zwischen 1991 und 1998 geschah. Dass nämlich aus einem geplanten Strukturwandel ein Strukturzusammenbruch wird. Damals wurden in der Lausitz Zehntausende von heute auf morgen arbeitslos. Zum Kohleausstieg gibt es aus Klimaschutzgründen keine Alternative. Aber das muss so gestaltet werden, dass die Menschen in der Region nicht noch einen zweiten Zusammenbruch erleben.
Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, zu viel Verständnis für Russlands Präsident Putin zu haben?


Auch darüber kann ich nur entspannt den Kopf schütteln. Ich würde Putin nicht als als einen lupenreinen Demokraten bezeichnen. Aber ich sehe das russische Gesellschaftssystem trotz deutlich autokratischer Züge in einer Entwicklung. Zumal immer Respekt geboten ist, wenn Völker eigene Wege suchen. Ich bin ein Schüler des großen Sozialdemokraten Egon Bahr, habe ihn auch auf seiner letzten Russlandreise 2015 begleitet. Er brachte uns bei, dass ein dauerhafter Frieden auf dem Kontinent niemals ohne und schon gar nicht gegen Russland gesichert werden kann. Ich möchte ganz einfach, dass meine Töchter und meine Enkel das gleiche Glück haben wie ich, in Frieden zu leben. Das treibt mich um.
Wie bewerten Sie die jüngsten Wahlergebnisse der AfD?
Die sind weit mehr als nur ein Warnzeichen. Man muss sich schon ehrlich die Frage stellen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wir, die etablierten Parteien, haben zweifellos Fehler gemacht in den letzten zehn, zwanzig Jahren und Felder unbearbeitet gelassen, sonst wäre es nicht zu dieser Entwicklung gekommen. Die Ursachen lassen sich nicht in wenigen Sätzen benennen, aber: Nach all den Umbrüchen in Ostdeutschland, oftmals mit Arbeitslosigkeit und persönlichen Verwundungen für unzählige Menschen verbunden, kamen die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise und gleich danach die Flüchtlingswelle. Nach all diesen Ereignissen in historisch kurzer Zeit haben viele den Glauben daran verloren, dass der Staat wirklich steuern und regeln kann. Vertrauen ist verloren gegangen. Materiell hat sich zwar vieles verbessert, die Unsicherheit aber ist größer denn je und damit ein idealer Nährboden für vermeintlich einfache Lösungen, auch rechtes Gedankengut. Wir müssen damit umgehen, einerseits unverdrossen das Gespräch auch mit verunsicherten oder frustrierten Menschen suchen, andererseits aber da klare Grenzen ziehen, wo die Würde von Menschen infrage gestellt wird. Dieses Gespräch sollten wir auch wieder verstärkt zwischen Ost und West suchen und uns auf Gemeinsames besinnen. Wenn wir nicht zusammenfinden, werden wir das nicht meistern, was alles noch vor uns liegt. Staaten drohen zu zerfallen und weitere Flüchtlingswellen wären das Resultat. Das alles müssen wir als Gesellschaft verarbeiten.
Im nächsten Jahr feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Verstehen Sie diese als Ergebnis oder als zielorientierten Prozess?
Mein ehemaliger Kollege Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, hat mal die Ansicht geäußert, dass sich auch in 20, sogar 30 Jahren die ehemalige Zonengrenze noch anhand von Befragungen, statistischen Daten und Einkommenssituationen abbilden lässt. Ich teile diese Einschätzung. Sie zeigt, wie lange wir noch mit der wirklichen Einheit zu tun haben werden. Ich will mich auch als Vorsitzender der Kommission Deutsche Einheit, die die Bundesregierung eingesetzt hat, weiterhin für das Gelingen einbringen.
Ist trotz Ihres offensichtlich gut gefüllten Terminkalenders noch Platz für Persönliches?
Natürlich, und wenn Sie jetzt auf meinen Rasentraktor abzielen, den ich für unser Grundstück in der Uckermark angeschafft habe: Mit dem bin ich regelmäßig unterwegs. Allerdings hat sich die Fläche reduziert, weil wir einen Teil in eine Streuobstwiese umgewandelt haben und eine weitere Fläche mittlerweile als Bienenweide dient. Die muss nur einmal im Jahr gemäht werden. Ich gewinne also wieder Zeit für andere Dinge.