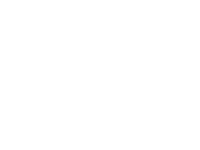Im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 hat die Linke ihr Wahlprogramm vorgestellt, das ambitionierte Ziele für die Landwirtschaft und den Umwelt- und Tierschutz in Deutschland formuliert. Ein zentraler Punkt des Programms ist die Schaffung von guten Arbeitsbedingungen und fairen Einkommen in der Agrarwirtschaft. Die Linke setzt sich für flächendeckende Tarifverträge in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ein, die Mindestlöhne und Sozialversicherungen auch für Saisonkräfte garantieren. Damit sollen die Arbeitsbedingungen in diesen Sektoren verbessert und die Lebensqualität der Beschäftigten gesteigert werden.
Kritik an billigen Importen
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Programms ist die Forderung nach einer landwirtschaftlichen Praxis, die im Einklang mit der Natur steht. Die Linke kritisiert die derzeitige Situation, in der billige Importe aus Drittländern, die nicht den hohen Produktionsstandards der heimischen Agrarwirtschaft entsprechen, den Markt überschwemmen. Freihandelsabkommen werden als kontraproduktiv angesehen, da sie die heimischen Standards gefährden. Um den Verbrauchern eine informierte Wahl zu ermöglichen, fordert die Linke eine eindeutige Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln.
Programm der Linken: Verbot von Glyphosat
Im Rahmen des ökologischen Umbaus der Landwirtschaft beabsichtigt die Linke, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln signifikant zu reduzieren. Bis zum Jahr 2030 soll der Einsatz um mindestens 50 Prozent verringert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert die Partei ein Verbot von Glyphosat und Neonikotinoiden sowie ein strenges Regelwerk für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Zudem setzt sich die Linke für eine ambitionierte Pestizidreduktions-Strategie und die Entwicklung von Düngemittelalternativen ein, um die Agrarbetriebe bei der Umstellung auf nachhaltige Anbaumethoden zu unterstützen.
Linke: Schutz vor Spekulanten
Ein zentrales Anliegen der Linken ist der Schutz des Bauernlandes vor Spekulanten und Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft stammen. Die Partei plädiert für ein Agrarstrukturgesetz, das gemeinschaftliches und öffentliches Eigentum an Grund und Boden stärkt. Ziel ist es, die Bäuerinnen und Bauern zu schützen und eine nachhaltige, lokal orientierte Landwirtschaft zu fördern.
Umbau der Tierhaltung – mehr Tierwohl
Auch das Thema Tierhaltung wird in dem Wahlprogramm der Linken ausführlich behandelt. Die Linke fordert einen sozialverträglichen Umbau der Tierhaltung, um mehr Tierwohl, Klimaschutz und Umweltschutz zu gewährleisten. Dazu sollen die Bundesförderung für tiergerechte Haltungssysteme ausgeweitet, Lebendtiertransporte eingeschränkt und die Kontrollen verstärkt werden. Um den Tierschutz zu verbessern, sind häufigere unangekündigte Kontrollen sowie härtere Strafen bei Verstößen gegen den Tierschutz vorgesehen.
Wahlprogramm der Linken: Weniger Bürokratie
Ein weiterer wichtiger Punkt des Wahlprogramms ist die Vereinfachung des Berichtswesens und der Antragstellung für Landwirtinnen. Trotz der hohen Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, die die Linke einfordert, sollen die bürokratischen Hürden abgebaut werden. Die Linke setzt sich für eine EU-weite Vereinfachung und Digitalisierung der Antragstellung ein, damit Landwirtinnen und Landwirte mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein
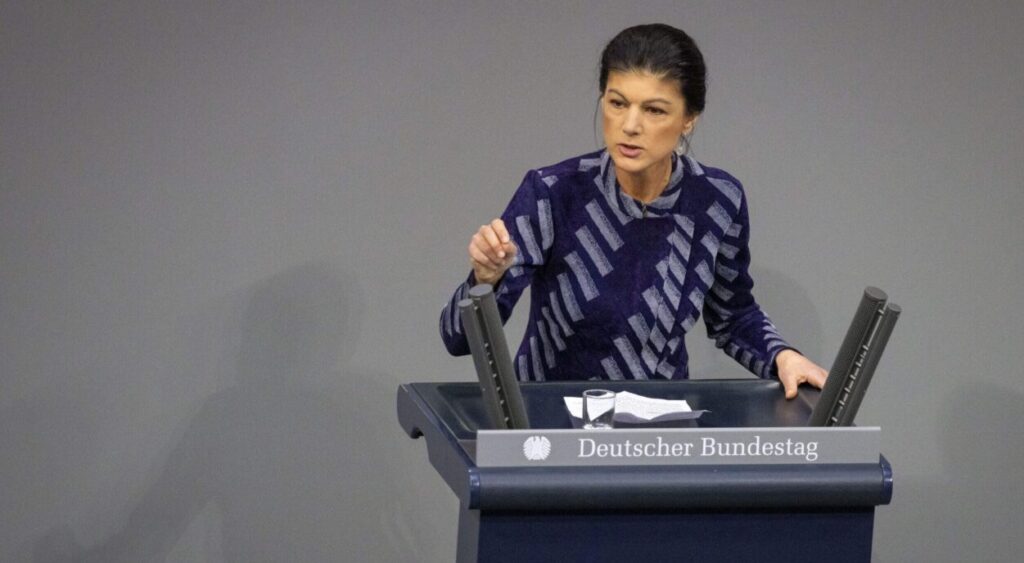
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 haben die Grünen/Bündnis 90 ein umfassendes Wahlprogramm vorgelegt, das einen Schwerpunkt auf die Themen Landwirtschaft und Ernährung in den Mittelpunkt stellt. Die Grünen nennen ihr Programm mutig: Regierungsprogramm. Ein zentrales Anliegen der Grünen für die Bundestagswahl am 23. Februar ist die Neugestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die ab 2027 ansteht. Die Partei strebt an, dass öffentliche Gelder künftig insbesondere für öffentliche Leistungen bereitgestellt werden. Dies bedeutet, dass finanzielle Mittel nicht mehr nur pauschal an Landwirte fließen, sondern gezielt eingesetzt werden, um den Schutz der natürlichen Ressourcen zu fördern und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft voranzutreiben.
Wahlprogramm: Faire Preise, gerechter Wettbewerb
Die Grünen setzen sich dafür ein, die Wettbewerbsposition der Landwirtinnen und Landwirte zu stärken und den Einfluss von großen Handelskonzernen auf die Lebensmittelkette zu reduzieren. Um dies zu erreichen, sollen kostendeckende Preise entlang der gesamten Wertschöpfungskette gesetzlich verankert werden. Weiterhin wird das Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz dahingehend reformiert, dass verbindliche schriftliche Verträge zwischen den Akteuren der Lebensmittelproduktion gefordert werden. Darüber hinaus planen die Grünen eine kartellrechtliche Prüfung des oligopolistischen Lebensmittelhandels, um faire Erzeugerpreise zu gewährleisten und einen gerechten Wettbewerb zu fördern.
Klimaschutz und Wiedervernässung der Moore
Ein weiterer entscheidender Punkt im Wahlprogramm der Grünen ist der Klimaschutz, den die Partei als integralen Bestandteil der Agrarpolitik sieht. Die Wiedervernässung von Mooren wird als ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz hervorgehoben. Moore spielen eine bedeutende Rolle bei der Speicherung von Kohlenstoffdioxid und tragen somit zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei. Die Grünen möchten die Renaturierung von Mooren aktiv vorantreiben, um die ökologischen Funktionen dieser wertvollen Flächen zu rehabilitieren.
Weniger Tiere und tiergerechte Haltung
Im Bereich der Tierhaltung setzen die Grünen auf eine tiergerechte Haltung und weniger Tiere in der Landwirtschaft. Sie haben bereits in der vergangenen Legislaturperiode den Umbau von Ställen für Schweine gefördert und möchten diese Maßnahmen fortsetzen. Ziel ist es, die Lebensbedingungen für alle Tierarten zu verbessern. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist die Einführung einer Haltungskennzeichnung für Schweinefleisch, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine informierte Kaufentscheidung ermöglichen soll.
Grünen-Wahlprogramm: Abbau von Bürokratie
Die Grünen haben sich auch dem Abbau unnötiger Bürokratie verschrieben, ohne dabei notwendige Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz zu gefährden. Sie fordern einen bedachten und sparsamen Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, um die Umwelt und die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Hierbei setzen sie auf marktwirtschaftliche Lösungen wie eine Pestizidabgabe, die sowohl wirksam als auch unbürokratisch gestaltet sein soll.
Ein sorgsamer Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen ist ebenfalls ein zentrales Anliegen der Grünen. Um die Nahrungsmittelproduktion zu sichern, sollen im Planungsrecht Vorrangflächen für die Landwirtschaft eingeführt werden. Bei der Nutzung von Biomasse streben die Grünen eine sorgsame Kaskaden- und Mehrfachnutzung an, um die Effizienz der Ressourcennutzung zu maximieren.
Gemeinschaftsverpflegung in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen
Die Ernährungspolitik der Grünen zielt nach eigenen Angaben darauf ab, den Bürgerinnen und Bürgern eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu ermöglichen. Hierbei wird die bereits bestehende Ernährungsstrategie „Gutes Essen für Deutschland“ als Grundlage genutzt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Die Grünen wollen die Ernährungsumgebung verbessern, um gesunde Ernährung zu fördern und ungesunde Lebensmittelwerbung, insbesondere für Kinder, zu regulieren. Zudem möchten sie Geschmacksaromen für E-Zigaretten, die vor allem junge Menschen ansprechen, vom Markt verbannen.
Grüne mit Kanzlerkandidat Robert Habeck im Rennen
Die Grünen schicken mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen eigenen Kanzlerkandidaten ins Rennen. Bei der Bundestagswahl 2021 haben sie 14,8 Prozent erreicht. Nach den aktuellen Umfrageergebnissen liegen die Grünen (Stand 3.2.) je nach Umfrageinstitut zwischen 12 und 15 Prozent. Der gewichtete Wert liegt bei 13,7 Prozent.


Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein
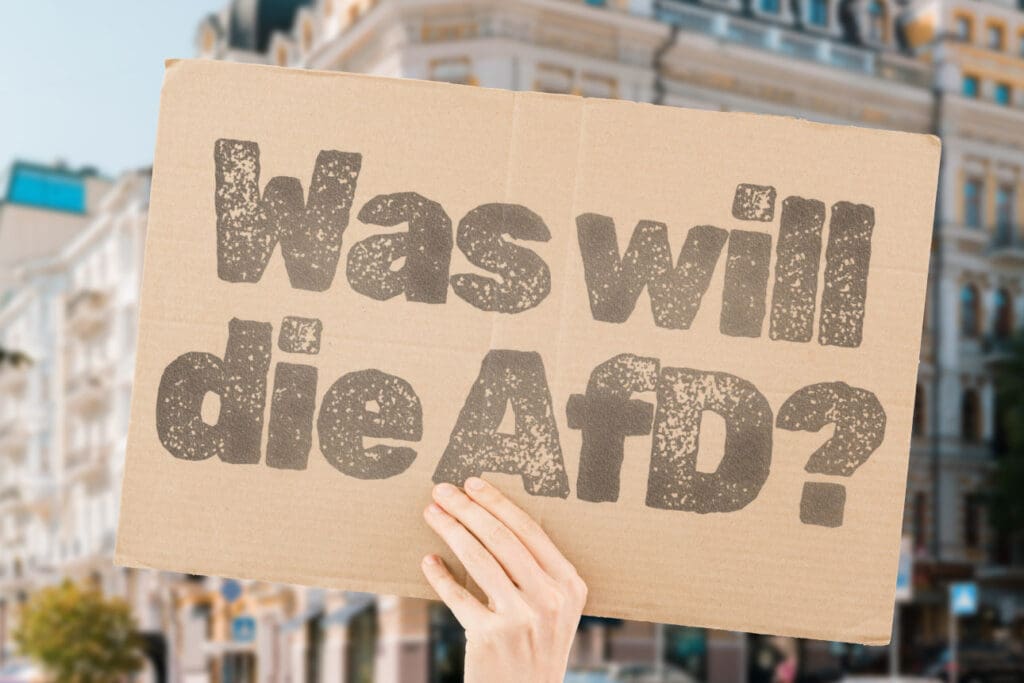
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie, wird immer wichtiger. Gerade im ländlichen Raum bieten sich zahlreiche Chancen, die oft ungenutzten Flächen sinnvoll und profitabel einzusetzen. Aus diesem Grund laden wir Grundstückseigentümer und Projektentwickler zu einer Fachveranstaltung ein, die sich mit der wirtschaftlichen Nutzung von Windenergie beschäftigt. Unter dem Motto „Windenergie im ländlichen Raum wirtschaftlich nutzen – Erfolgreich planen und profitieren“ erwarten die Teilnehmer am Mittwoch, 12. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen.
Austausch mit unserem Experten
Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Grundstückseigentümer, die ihre Flächen optimal nutzen möchten, als auch an Projektentwickler, die ihre Kenntnisse über wirtschaftliche Rahmenbedingungen vertiefen wollen. Durch fundierte Informationen und den Austausch mit Experten wird eine solide Grundlage geschaffen, um Windenergieprojekte erfolgreich zu planen und durchzuführen.
Ein zentrales Anliegen der Veranstaltung ist es, den Grundstückseigentümern aufzuzeigen, wie sie aus ihren Flächen das Beste herausholen können. Hierbei stehen die Themen attraktive Pachtverträge und rechtssichere Vertragsabschlüsse im Vordergrund. Die Teilnehmer erfahren, welche Pachten in der Branche realistisch sind und wie sie diese optimal verhandeln können. Zudem wird der Einfluss der Standortbedingungen und des zu erwartenden Stromertrags auf die wirtschaftliche Rentabilität von Windenergieprojekten thematisiert.
Tipps und Strategien
Für Projektentwickler bietet die Fachveranstaltung die Möglichkeit, ihr Wissen über wirtschaftliche Kalkulationen und erfolgreiche Verhandlungstaktiken zu vertiefen. Langfristige Planungssicherheit ist für den Erfolg von Windenergieprojekten unerlässlich, und die Veranstaltung wird wertvolle Tipps und Strategien vermitteln, um diese zu gewährleisten.
Online-Seminar: Veranstaltung in zwei Blöcken
Die Fachveranstaltung gliedert sich in zwei spannende Abschnitte:
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen beim Betrieb von Windenergieanlagen:
Welche Pachten sind realistisch? Hier wird auf aktuelle Marktentwicklungen und Trends eingegangen, um eine realistische Einschätzung zu ermöglichen.
Wie beeinflussen Standortbedingungen und Stromertrag die Wirtschaftlichkeit? Anhand von Beispielen wird verdeutlicht, welche Faktoren bei der Standortwahl eine Rolle spielen und wie diese optimal genutzt werden können.
2. Praxiswissen zur Gestaltung von Nutzungsverträgen:
Wie können Verträge fair und zukunftssicher gestaltet werden? In diesem Abschnitt werden die rechtlichen Grundlagen behandelt und es werden Beispiele für gut gestaltete Verträge präsentiert.
Vermeidung typischer Fallstricke und Konflikte zwischen Eigentümern und Entwicklern: Hierbei werden häufige Probleme und Missverständnisse beleuchtet, die in der Praxis auftreten können, sowie Lösungen und Best Practices aufgezeigt.
Erfahrungsberichte aus der Praxis
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem interaktiven Austausch zwischen den Teilnehmern und den Experten. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen und individuelle Anliegen zu diskutieren, wird als wertvolles Element der Veranstaltung hervorgehoben. Die Referenten bringen umfassende Erfahrungen aus der Praxis mit und werden den Teilnehmern fundierte Analysen sowie wertvolle Erfahrungsberichte präsentieren.
Online-Seminar: Wer, wann, wo
Das Online-Seminar wird von der Bauernzeitung in Kooperation mit der Landakademie veranstaltet. Als Referent steht Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Maslaton zur Verfügung. Er gehört seit Jahrzehnten zu einer der Größen im Bereich der erneuerbaren Energien und ihrer Projektierung. Er ist Herausgeber und Autor des Werkes „Windenergieanlagen“. Der Klassiker für die gesamte Windenergiebranche resultiert aus umfassenden praktischen Erfahrungen, die Professor Maslaton auch in dieser Veranstaltung zu Nutzungsverträgen den Zuhörern näherbringen will.

Das Seminar „Windenergie im ländlichen Raum“ findet am Mittwoch, 12. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über www.landakademie.de. Die Teilnahme kostet 225 Euro. Leserinnen und Leser der Bauernzeitung zahlen mit dem Rabattcode „BAUERNZEITUNG“ nur 199 Euro.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Die Alternative für Deutschland (AfD) hat in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 Positionen zur Stärkung der Landwirtschaft und zur Kritik an der gegenwärtigen Klimapolitik formuliert. Ein zentrales Anliegen der AfD ist die Unabhängigkeit der Landwirte. Die Partei fordert eine Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Prinzipien, um eine sach- und leistungsgerechte Vergütung für Landwirte, Nutztierhalter und Nahrungsmittelproduzenten zu gewährleisten. In diesem Kontext lehnt die AfD die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union ab, da sie die Selbständigkeit der Landwirte als gefährdet ansieht.
Programm: Auch die AfD will Bürokratie abbauen
Ein zentrales Ziel der AfD ist es, den Landwirten mehr unternehmerische Entscheidungsfreiheit zurückzugeben. Die Partei setzt sich für faire Erzeugerpreise und eine verbesserte Marktstellung ein, insbesondere durch Direktvermarktung.
Um den bäuerlichen Betrieben zu helfen, plant die AfD, die überbordende Bürokratie und Überregulierung schrittweise abzubauen. Vor der Einführung agrarpolitischer Maßnahmen soll geprüft werden, welche Auswirkungen diese auf das Einkommen der Bauern haben und welchen ökologischen Nutzen sie bringen.
Die AfD spricht sich für eine Agrarförderung aus, die die Leistungen von Familienbetrieben und Genossenschaften berücksichtigt. Zudem soll die Hofnachfolge vereinfacht werden, um die Landwirtschaft zu entbürokratisieren und den Landwirten mehr Freiraum zu geben. Deutsche und EU-Behörden sollen sich nicht in die Wirtschaftsweise der Landwirte einmischen, etwa bei der Wahl der Fruchtfolge.
Ablehnung von Steuer auf Zucker oder Fleisch
Ein weiterer Punkt im Wahlprogramm betrifft die Lebensmittelbesteuerung. Die AfD lehnt jede Form einer gesonderten Besteuerung ab, wie etwa eine Fleisch- oder Zuckersteuer. Die Partei sieht den mündigen Bürger, der frei in seinem Konsumverhalten entscheiden kann, als wichtiges Leitbild an.
In Bezug auf die Düngeregeln kritisiert die AfD die gegenwärtigen Vorschriften, die ihrer Meinung nach zu Ertrags- und Qualitätseinbußen führen. Die Partei fordert eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung von Kulturpflanzen und will den bürokratischen Aufwand auf ein Minimum reduzieren. Auch die Nutzung und der Handel mit alten Kultursorten sollen für Landwirte erleichtert werden, um die Sortenvielfalt für den Verbraucher zu erhöhen.
Die AfD steht auch neuen genomischen Techniken, wie CRISPR, positiv gegenüber, betont jedoch, dass der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft streng überwacht werden sollte.
Kritik an der Klimapolitik
Ein weiterer zentraler Punkt im Wahlprogramm der AfD ist die kritische Haltung gegenüber der derzeitigen Klimapolitik. Die Partei argumentiert, dass der Klimawandel ein komplexes Phänomen ist, dessen Ursachen nicht eindeutig geklärt sind. Sie lehnt die kostspielige Energiewende ab und sieht keinen Grund, die Nutzung fossiler Energien einzuschränken oder Verbote wie das von Verbrennungsmotoren einzuführen. Die AfD sieht sich in Übereinstimmung mit einem angeblichen wissenschaftlichen Konsens, der den menschgemachten Klimawandel als politisch konstruiert bezeichnet.
Klima: Warnungen werden infrage gestellt
Die Partei verweist auf wissenschaftliche Stimmen, die die Dringlichkeit der aktuellen Klimawarnungen in Frage stellen. Sie betont, dass die tatsächlichen Beobachtungen der letzten 30 Jahre weit unter den prognostizierten Katastrophenszenarien bleiben. Die AfD gibt an, „den zukünftigen Generationen die Möglichkeit auf ein würdiges Leben in Freiheit und Wohlstand zurückzugeben und die Plan- und Subventionswirtschaft der letzten Jahrzehnte in eine moderne soziale Marktwirtschaft überführen“.
Kritik an Windenergie und Photovoltaik
Abschließend äußert die AfD in ihrem Wahlprogramm Bedenken hinsichtlich der Wind- und Solarenergie. Sie sieht in Windkraftanlagen eine Gefährdung für Flora und Fauna und kritisiert die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Auch der Neubau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen wird abgelehnt, da diese nach ihrer Ansicht einen hohen Flächenverbrauch mit sich bringen und das Mikroklima negativ beeinflussen.
Bei der letzten Bundestagswahl 2021 hatte die Alternative für Deutschland (AfD) laut amtlichem Endergebnis 10,3 Prozent der Stimmen erreicht. In aktuellen Umfragen zur Wahl am 23. Februar (Stand 31.1.) liegt die AfD zwischen 19 Prozent (Ipsos) und 23 Prozent (YouGov). Im gewichteten Durchschnitt würde die AfD bei 20,8 Prozent landen.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein
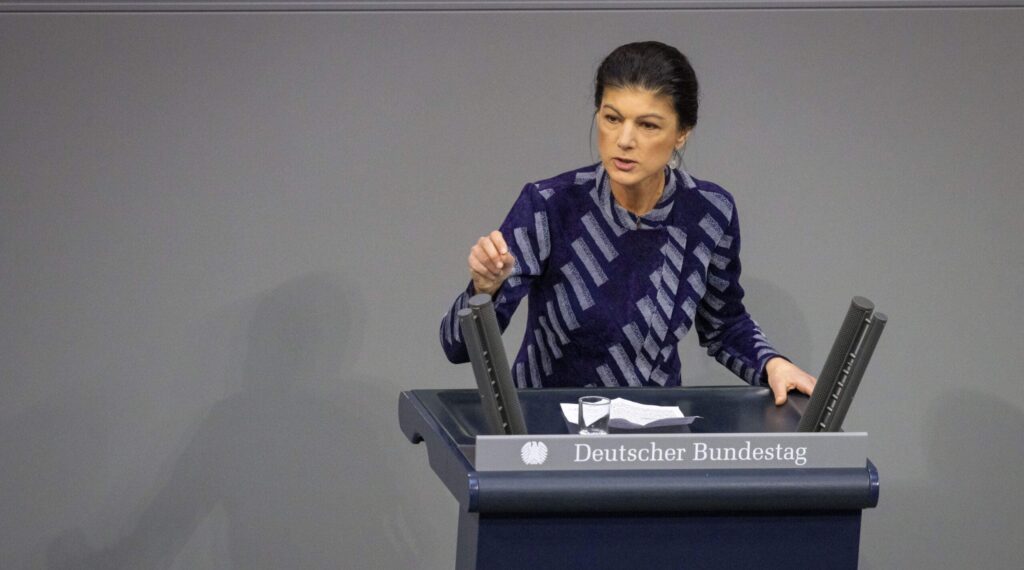
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Vor drei Wochen (10.1.) wurde bekannt, dass im Landkreis Märkisch-Oderland bei einer Wasserbüffelherde die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist. Unter den weitreichenden Folgen haben viele Tierhaltungsbetriebe in Brandenburg bis heute zu leiden. Doch jetzt gibt es erste Hilfen.
Vor allem Betriebe, die unter die Tierseuchenallgemeinverfügungen fallen und die sich in der Schutz- bzw. Überwachungszone befinden, dürfen seit Wochen weder ihre Tiere noch deren Produkte transportieren und verarbeiten. Das betrifft Betriebe aus den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Barnim und Oberhavel. Das bedeutet, dass seitdem täglich Tausende Liter Milch vernichtet werden. Schweine und Rinder dürfen nicht geschlachtet oder zu Schlachtbetrieben transportiert werden.
Wie lange gelten die Restriktionen?
„Wie lange noch?“, fragen sich die Verantwortlichen in den Betrieben, die mittlerweile unter den immensen wirtschaftlichen Folgen leiden und die in finanzielle Schieflage geraten. Wann ist damit zu rechnen, dass die Verfügungen aufgehoben werden?
Darauf antwortet Matthias Bruck, Pressesprecher des Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUK) am Freitag (31.1.):
„Dieser Zeitpunkt kann erst genannt werden, wenn alle erforderlichen Beprobungen in den Nutztier- und Wildtierbeständen genommen und ausgewertet sind. Gegenwärtig laufen beispielsweise die Beprobungen in den Wildtierbeständen. Es ist nicht abzuschätzen, wann sie beendet sind. Was betroffene Kontaktbestände anbelangt, ist davon auszugehen, dass die Beprobungen im Laufe des Wochenendes abgeschlossen sind. Demgemäß gehen wir im ständiger Kommunikation mit den Landkreisen davon aus, dass die ersten Allgemeinverfügungen zum Beginn der kommenden Woche angeglichen werden und damit eine Reihe von Restriktionen entfallen.“
Oberhavel legt Rettungspaket auf
Wie kann den betroffenen Betrieben geholfen werden? Nach Aussage des Ministeriumssprechers führt Ministerin Hanka Mittelstädt gegenwärtig noch intensive Gespräche mit Beteiligten auf allen Ebenen, wie den von der MKS unmittelbar und mittelbar betroffenen Landwirtschaftsbetrieben über die gesetzlich abgesicherten Hilfen, die die Tierseuchenkasse gewährt, hinaus finanzielle Unterstützung gewährt werden kann. Diese Gespräche würden mit Hochdruck geführt und führten zu ersten Ansätzen.
So hat der Landkreis Oberhavel am Freitag (31.1.) mitgeteilt, dass der finanzielle Schaden der strengen Hygienevorschriften zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg mehrere Höfe in Oberhavel hart getroffen hat. Sie standen zwei Wochen nach der vom Land verhängten Kontaktsperre kurz vor dem Konkurs. Um ihre Existenz zu retten, habe der Landkreis kurzfristig ein Rettungspaket aufgelegt, hieß es in einer Meldung. 250.000 Euro stellt Oberhavel bereit, um sie vor dem Konkurs zu bewahren. „Wir wollen unsere landwirtschaftlichen Betriebe retten. Uns ist wichtig, dass die Höfe nicht schließen müssen. Das Land kann kurzfristig keine Hilfe leisten. Deshalb sehen wir uns als Landkreis in der Pflicht, einzuspringen, bevor es zu spät ist“, begründete Landrat Alexander Tönnies seinen Vorstoß. Betroffene könnten sich ab sofort unter Landwirtschaft@oberhavel.de in der Kreisverwaltung melden.
Schweinehalter wurden Tiere nicht los
Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) bei einer Wasserbüffelherde im Landkreis Märkisch-Oderland haben Tierhalter aus Brandenburg mit dem nächsten Problem zu kämpfen: Schweinehalter bleiben auf ihren Schweinen sitzen! Wie der Landesbauernverband (LBV) am Mittwoch, 22.1., mitteilte, verweigern Schlachtbetriebe die Annahme von Schweinen aus Brandenburg.
„Katastrophe für Schweinehalter“
„Eine Katastrophe für unsere Schweinehalter!“, so bezeichnet LBV-Präsident Henrik Wendorff das Verhalten dieser Betriebe. Von der Weigerung der Schlachthöfe, Brandenburger Schweine anzunehmen, berichten Mitglieder des LBV Brandenburg. Dabei werden unterschiedliche Begründungen angeführt und verschiedene unverbindliche Termine für die nächste Tierabnahme genannt. Der Verband habe sich daher sowohl an Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) als auch an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit der Forderung gewandt, sofort das Gespräch mit den Beteiligten zu suchen und auf schnelle Lösungen zu drängen. Ziel müsse es sein, dass Tiere aus Brandenburg verbindlich und ohne Verzögerungen wieder zur Schlachtung abgeholt werden.

Schaden von 200.000 Euro pro Woche
Zwischenzeitliche Gespräche des Landesbauernverbandes haben laut der Mitteilung erste Erfolge: Die Wirtschaftspartner haben die ersten Schlachtungen Brandenburger Tiere ab Dienstag in Aussicht gestellt. Außerdem muss die Bundesregierung mit den europäischen Partnern schnellstmöglich ein unbürokratisches Verfahren für die Abnahme von Schlachtvieh vereinbaren, das von deutschen Schlachthöfen aufgrund der Verwerfungen nicht mehr geschlachtet wird. Das Land Brandenburg ist gefordert, die Landkreise in die Lage zu versetzen, diese Transporte schnellstmöglich fach- und sachgerecht zu genehmigen und allen Partnern die notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. Der Verband rechnet bereits jetzt mit einem Schaden für die Betriebe in Höhe von mindestens 200.000 Euro pro Woche – Tendenz deutlich steigend – allein durch die ausbleibende Abnahme von Schlachttieren.
Video: Maul- und Klauenseuche-Ausbruch: Was bedeutet das für die Betriebe?
MKS-Impfstoff-Datenbank aktiviert
Das Land Brandenburg hat aufgrund des aktuellen MKS-Ausbruchsgeschehens als derzeit betroffenes Bundesland gebeten, die MKS-Impfstoffbank zu aktivieren, um vorbereitet zu sein, falls sich die MKS auf weitere Gebiete in Deutschland ausbreitet. Das teilte das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUK) am Montag, (21.1.) mit. Die Aktivierung der MKS-Impfstoffbank zum jetzigen Zeitpunkt diene der Stärkung der Handlungsfähigkeit bei der Tierseuchenbekämpfung, da zwischen der Aktivierung und der möglichen Bereitstellung von Impfstoffdosen mindestens 6 Tage liegen. Die Länder haben sich laut Mitteilung dafür ausgesprochen, die Kosten der Aktivierung der Impfstoffbank nach dem Königsteiner Schlüssel zu verteilen.

MKS-Impfung: Einsatz zurzeit nicht geplant
Das Ministerium betont, dass diese Entscheidung über die Aktivierung der Impfstoffbank gegen die Maul- und Klauenseuche keine Entscheidung über den tatsächlichen Einsatz des Impfstoffes sei.
Eine Impfung in Brandenburg sei auf Grund der derzeitigen Seuchensituation in Brandenburg nicht vorgesehen. Bisher gibt es in Brandenburg einen Ausbruchsbetrieb. Alle bisherigen Untersuchungen im Umfeld des Ausbruchsbetriebes verliefen negativ, so dass bisher keine weitere Ausbreitung der Seuche festgestellt werden konnte.
Laut der Mitteilung ermöglicht die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten unter Einhaltung
bestimmter Auflagen den Einsatz dieser Impfstoffe als zusätzliche Seuchenbekämpfungsmaßnahme. Der Impfstoff werde für den Fall einer weiteren Ausbreitung der Seuche oder für den Fall des Auftretens in anderen Regionen Deutschlands als mögliche Bekämpfungsmaßnahme vorrätig gehalten.
Weitere Informationen zur MKS-Impfung finden Sie in den FAQ des Friedrich-Loeffler-Instituts.
Özdemir gibt Entwarnung
Aufatmen in Brandenburg: Wie Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Freitagmorgen, 17.1., im Deutschlandfunk informierte, hat sich der MKS-Verdachtsfall in Werneuchen in Brandenburg nicht bestätigt. „Es gibt gute Nachrichten“, sagte Özdemir im Deutschlandfunk. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe noch in der Nacht Entwarnung gegeben. Die am 10. Januar erlassene Eilverordnung zur Eindämmung der Tierseuche kann damit aufgehoben werden, teilte das Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt am Freitagmittag mit. Die Verordnung läuft mit Ablauf des 17. Januar aus und wird nicht verlängert. Derzeit gibt es nach Angaben des Ministeriums weiterhin keine Hinweise auf eine Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche. Die eingerichtete Schutz- und Überwachungszone um den Ausbruchsort bleibt jedoch bestehen.
Zweiter MKS-Verdachtsfall in Brandenburg nicht bestätigt
Das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg informierte am Morgen: „Der klinische Verdacht auf MKS in einem Ziegenbestand im Landkreis Barnim, zu dem es gestern eine breite Berichterstattung gab, hat sich durch die durchgeführten Laboruntersuchungen nicht bestätigt.“ Somit gebe es keinen weiteren Ausbruch der MKS und auch keine weitere Ausbreitung dieser Tierseuche.
Tiere im Barnim getötet
Der Pressesprecher des Landkreises, Robert Bachmann, hatte der Bauernzeitung am Donnerstag, (16.1.) bestätigt, dass bei einer klinischen Untersuchung von Tieren eines hiesigen Tierhaltungsbetriebs am 15. Januar Symptome festgestellt wurden, die auf eine MKS-Infektion hindeuten könnten. Umgehend seien Proben der betroffenen Tiere entnommen und noch am selben Abend zur Untersuchung in das zuständige Landeslabor geschickt worden. Die Tiere wurden laut Robert Bachmann getötet.
Der Landkreis Barnim bittet auch weiterhin insbesondere Tierhalter, Landwirte und Jagdausübungsberechtigte die Tierseuchenallgemeinverfügung des Landkreises Barnim zu beachten.
Eilverordnung bis 17.1. verlängert
Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) im Landkreis Märkisch-Oderland am vergangenen Freitag wurde die bestehende Eilverordnung zur Eindämmung der Tierseuche am Mittwoch erneut um 48 Stunden verlängert. Sie gilt nun bis zum 17. Januar 2025. Das teilte das Agrarministerium Brandenburg am Mittwoch, 15.1. mit. Drüber hinaus hat das Land Berlin veranlasst, dass Klauentiere nicht auf der Grünen Woche, die am Freitag, 17.1. offiziell beginnt, ausgestellt werden. Diese Maßnahmen dienen der weiteren Erfassung des Seuchengeschehens und der Verhinderung einer Ausbreitung. Bisher gibt es keine Hinweise auf weitere Fälle.
Das Verbot betrifft weiterhin den Transport von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Kameliden sowie von in den Betrieben gewonnenen Körpern, Tierkörperteilen und Gülle. Schlachtbetriebe und Einzelhandel sind nicht betroffen.
Die Verlängerung wurde notwendig, da die bisherigen Untersuchungsergebnisse noch keine abschließende Bewertung der Lage zulassen. Das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz prüft derzeit Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Betriebe. Verstöße gegen die Verordnung können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
Landeslabor konnte keine weiteren Fälle bestätigen
Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg kamen am Dienstag, 14.1., gute Nachrichten aus dem Landeslabor: In einem Radius von einem Kilometer um den Ausbruchsbestand im Landkreis Märkisch-Oderland wurden durch die Veterinärämter die Bestände mit empfänglichen Tieren untersucht und beprobt, teilte das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg mit. Die eingesendeten Proben seien durch das Landeslabor mit negativem Ergebnis befundet worden. Das bedeutet, dass es im Radius von einem Kilometer keinen weiteren Ausbruch der MKS gibt.
Am Freitag, 10.1., hatte Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) darüber informiert, dass es zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) gekommen ist. Drei Wasserbüffel im Landkreis Märkisch-Oderland (MOL) waren betroffen, sagte die Ministerin in Potsdam. Um die Ursache zu klären, hätte der Landkreis mit Fachleuten alle notwendigen Maßnahmen veranlasst. Die gesamte Herde wurde gekeult.

Als erste Maßnahme wurde um den Ausbruchsbestand ein etwa drei Kilometer großer Sperrkreis sowie eine zehn Kilometer große Überwachungszone eingerichtet. Betroffen sind dadurch zusätzlich die Landkreise Barnim und Oder-Spree sowie die Stadt Berlin. „Ich kann bestätigen, dass aufgrund der jüngsten Entwicklung, in Abstimmung mit dem Landestierseuchenkrisenstab die Tötung empfänglicher Tiere in einem Umkreis von 1.000 m vom Ausbruchsbetrieb angeordnet wurde“, erklärte der Pressesprecher des Landkreises Barnim, Robert Bachmann.

Keine Rinder, Schafe, Ziegen und Alpakas auf der Grünen Woche
Der MKS-Ausbruch hat auch Auswirkungen auf die Grünen Woche. Auf der weltgrößten Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau werden in diesem Jahr keine Rinder zu sehen sein. Auch die geplante Präsentation von Schafen und Ziegen sowie Alpakas fällt aus. Die Messeleitung folgt damit einer Anordnung des Veterinäramts Charlottenburg. Grüne Woche-Direktor Lars Jaeger zeigte Verständnis für die Entscheidung der Behörde. Schweine waren aus veterinärtechnischen schon seit längerem nicht mehr auf der Messe vertreten.

Virus für Menschen ungefährlich
Das Virus wird für den Menschen als ungefährlich eingestuft, ist aber für Rinder, Schweine, Ziegen oder auch Schafe hoch ansteckend. Auch viele Zoo- und Wildtiere können an MKS erkranken.
Fall wurde in Hönow festgestellt
Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte den MKS-Ausbruch bestätigt, so die Ministerin. Demnach war der Fall in Hönow am Donnerstag, 9.1., festgestellt worden. Seit mindestens drei Wochen ist der von der Maul- und Klauenseuche (MKS) betroffene Wasserbüffelbestand bei Hönow (MOL) infiziert. Darüber informierte nach der Sitzung des Krisenstabes in Seelow Dr. Ralph Bötticher, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes MOL am Sonnabend. Die Tatsache, dass einige Entzündungen im Maulbereich der Büffel bereits abgeheilt seien, spreche für eine längere Infektionszeit. Im Klauenbereich habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Die Inkubationszeit der MKS wird mit zwei bis sieben Tagen angegeben. Dass die Büffel Kontakt zu anderen Herdentieren hatten, könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Nicht auszuschließen sei dies bei Wildtieren.

Eilverordnung: Transport von Tieren ist verboten
Zur Eindämmung der Tierseuche hatte Ministerin Mittelstädt eine Eilverordnung erlassen. Um eine weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern, sei es erforderlich, das Verbringen von empfänglichen Tieren und von Erzeugnissen, die von diesen Tieren gewonnen wurden, vorübergehend zu verbieten, hieß es in einer Pressemitteilung. Der Transport von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Kameliden war daher durch die Eilverordnung der Ministerin für die Dauer untersagt. Das Gleiche galt für Schlachtkörper oder Teile von Schlachtkörpern sowie für Gülle, die in den Zuchtbetrieben von diesen Tieren gewonnen wurden. Nicht betroffen waren Schlachtbetriebe und der Einzelhandel. Verstöße gegen das Verbot können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
MKS-Virus vom Serotyp O festgestellt
Wie das FLI am Sonnabend, 11.1., mitteilte, hat das Nationale Referenzlabor am FLI bei einem betroffenen Wasserbüffel das MKS-Virus vom Serotyp O festgestellt. Nahe verwandte MKS-Viren kommen im Nahen Osten und in Asien vor. Ihre genaue Herkunft und der Weg, auf dem sie in die Tierbestände gelangt sind, sind auch nach Kenntnis des Serotyps noch unbekannt.
In der MKS-Antigenbank Deutschland stehen für diese Viren geeignete Impfstoffe zur Verfügung. Diese MKS-Antigenbank ist speziell für Fälle wie den aktuellen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche eingerichtet worden. Die MKS-Antigenbank kann, von den Bundesländern aktiviert, innerhalb weniger Tage die benötigten Impfstoffe herstellen.
Abgesehen davon, einen geeigneten Impfstoff herzustellen, sei derzeit entscheidend, alle Klauentiere in der Umgebung des betroffenen Betriebs zu untersuchen, um die tatsächliche Verbreitung zu kennen. Davon hänge ab, welche Maßnahmen gegebenenfalls noch ergriffen und ob und wie geimpft wird. Wichtig sei, dass der Impfstoff genau auf die MKS abgestimmt ist, da Impfstoffe gegen andere Serotypen die Tiere nicht schützen.
Mit Import-Verbot ist zu rechnen
Durch den Verlust des MKS-Freiheitsstatus nach WOAH rechnet das BMEL damit, dass der Export von beispielsweise Milch und Milchprodukten, Fleisch und Fleischprodukten, aber auch Häuten und Fellen, gesalzene Naturdärme, Samen und Blutprodukten oder empfänglichen Tieren stark eingeschränkt werden wird. Als erstes Land hat Südkorea sämtliche Schweinefleischlieferungen aus Deutschland mit sofortiger Wirkung verboten. Auch die Niederlande haben umgehend Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um ein Einschleppen der Maul- und Klauenseuche zu verhindern. Dazu gehört ein landesweites Verbringungsverbot für deutsche Mastkälber, ausgenommen Schlachttransporte.
Letzte Fälle gab es 1988 in Deutschland
Laut FLI waren Deutschland und die EU amtlich anerkannt MKS-frei, die letzten Fälle in Deutschland traten 1988 auf. Mit der Bestätigung der Seuche verliert Deutschland die Anerkennung als „frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfung“ bei der Weltorganisation für Tiergesundheit. In der Türkei, im Nahen Osten, in Afrika, in vielen Ländern Asiens und in Teilen Südamerikas ist die MKS jedoch noch endemisch. Die illegale Einfuhr von Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus diesen Ländern stellt eine ständige Bedrohung für die Landwirtschaft in der EU dar.
BMEL ruft Krisenstab ein
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) will zeitnah den Zentralen Krisenstab Tierseuchen einberufen, hieß es in einer Pressemitteilung. Der Zentrale Krisenstab ist das übergeordnete politische Entscheidungsgremium im Tierseuchenfall. Im Krisenstab sind die Amtschefs der für die Tierseuchenbekämpfung zuständigen Ministerien des Bundes und der Länder vertreten. Hier werden Maßnahmen von überregionaler und politischer Bedeutung beraten und gegebenenfalls ein bundeseinheitliches Vorgehen beschlossen. Über die Ursache, wie das Virus eingeschleppt wurde, gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse, heißt es aus dem Ministerium.
Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Grüne), Cem Özdemir, hat am Montag mit Verbänden der Land- und Ernährungswirtschaft über mögliche Konsequenzen beraten. „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, das Virus schnell zurückzudrängen, um die Tiere zu schützen und Schäden für unsere Land- und Lebensmittelwirtschaft zu minimieren. Höchste Priorität hat deshalb jetzt, schnell für Klarheit zu sorgen, wie verbreitet die hochinfektiöse Tierseuche ist“, erklärte Özdemir.
Appell von Wendorff: Ruhe bewahren
„So eine Überraschung will keiner haben!“, kommentiert Landesbauernpräsident Henrik Wendorff den Ausbruch der Maul- und Klauensuche (MKS). Gebeutelt durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) sei man in Sachen Tierseuchen zwar gut im Training, die MKS betreffe aber weit mehr Tierarten, Tierhalter und vermutlich auch die Bevölkerung in der Nähe des Ausbruchsortes im sogenannten Speckgürtel von Berlin. „Jetzt kommt es darauf an, die Eintragsquelle zu ermitteln und herauszufinden, wie weit die Seuche schon verbreitet ist“, so Wendorff. Er appellierte an alle Tierhalter, Ruhe zu bewahren und erst einmal alle Tierbewegungen zu unterlassen. Er sei froh, dass der Tierpark Berlin in Friedrichsfelde, nur etwa zwölf Kilometer von Hönow entfernt, bisher nicht betroffen sei.
Taskforce in Märkisch-Oderland
Der Landkreis Märkisch-Oderland hatte für Freitagabend eine Taskforce einberufen. Da der Tierhalter aus Berlin stammt und weitere Tiere im Landkreis Oder-Spree hält, die betroffene Herde in Märkisch-Oderland steht und sich der Sperrkreis in den Landkreis Barnim erstreckt, werde das Land die Maßnahmen koordinierend begleiten, informierte der Landkreis Märkisch-Oderland.
Auch der Landkreis Barnim hat alle erforderlichen Lageinformationen zusammengetragen und die daraus resultierenden Maßnahmen in die Wege geleitet, informierte der Landkreis. Zur Eindämmung der Tierseuche sollten die erforderlichen Krisenstrukturen aufgebaut werden.
MKS in der DDR
Den letzten größeren MKS-Ausbruch in Ostdeutschland gab es im Jahr 1982; dieser betraf Tierhaltungen in sechs Kreisen im Bezirk Rostock und in einem Kreis im Bezirk Neubrandenburg. Mit seuchenhygienischen Maßnahmen konnte der Ausbruch erfolgreich eingedämmt und eine weitere Ausbreitung der Seuche verhindert werden, heißt es im Bundesarchiv.
Für den Menschen, der pasteurisierte Milch, daraus hergestellte Milchprodukte oder Fleisch verzehrt, bestünde jedoch auch bei einer Einschleppung der MKS nach Deutschland keine Gefahr.
Erreger: Virus ruft MKS hervor
Die Maul- und Klauenseuche wird hervorgerufen durch Viren des Genus Aphthovirus der Familie Picornaviridae. Es gibt sieben Serotypen (O, A, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3), die in zahlreiche Untertypen und Stämme unterteilt werden.
Übertragung: Häufigster Erreger
Die häufigste Übertragungsart der MKS ist der Kontakt zwischen erkrankten und empfänglichen Tieren. An MKS erkrankte Tiere verbreiten das Virus in großen Mengen mit der Flüssigkeit aufgeplatzter Blasen, aber auch mit Speichel, Milch, Dung und der Atemluft. Es besteht zudem ein hohes Risiko für eine indirekte Ansteckung über kontaminiertes Futter, Gegenstände, Fahrzeuge oder Personen.
Klinisches Bild: So verläuft die Krankheit bei Tieren
Die Krankheit verläuft bei den meisten erwachsenen Tieren nicht tödlich, führt aber zu einem lang anhaltenden Leistungsabfall. Bei Jungtieren können hohe Verluste durch Schädigung des Herzmuskels auftreten. (Quelle: FLI)
Anzeichen und Inkubationszeit: Blasen an Maul und Zunge
Im Allgemeinen zeigen Milchrinder die schwersten Krankheitsanzeichen. Nach einer Inkubationszeit von meist 2-7 Tagen zeigen sich hohes Fieber, Milchrückgang, Appetitlosigkeit und Apathie, sowie die Bildung typischer Blasen am Maul und auf der Zunge (dort auch „Aphthen“ genannt), an den Klauen und den Zitzen.
Beim Schwein treten nach einer Inkubationszeit von meist 1–3 Tagen Blasen vorwiegend an den Klauen und der Rüsselscheibe auf. Die Tiere zeigen häufig Lahmheitserscheinungen, die mit einem „klammen Gang“ beginnen. Nach einigen Tagen können manche Schweine aufgrund der Schmerzen nicht mehr stehen und verlieren unter Umständen sogar ihr Klauenhorn.
Bei Schafen und Ziegen verläuft eine Infektion meist unauffällig; die Tiere können die Krankheit aber dadurch unerkannt verbreiten.
Bekämpfung der Seuche
Die MKS ist anzeigepflichtig. Weltweit gelten für die Verhütung und Bekämpfung der MKS sehr strenge Regeln. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit für erkrankte Tiere. Ist in einem Betrieb auch nur ein Tier erkrankt, müssen alle Klauentiere getötet und unschädlich beseitigt werden. Auch Klauentiere in landwirtschaftlichen Betrieben in der näheren Umgebung des Seuchenbetriebes müssen zumeist getötet werden. Ställe, Fahrzeuge und Geräte müssen gründlich desinfiziert werden. Eine Notimpfung gefährdeter Tierbestände ist bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen möglich. (Quelle: FLI)

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Das Wahlprogramm des BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 stellt Ziele für eine Agrarpolitik vor, die den Respekt für Landwirte, den Umwelt- und Tierschutz in den Mittelpunkt rückt. Besonders betont wird die Notwendigkeit einer national und regional ausgerichteten Landwirtschaft, die primär der Ernährungssicherung im eigenen Land dient. Die BSW setzt sich entschieden gegen Billigimporte aus dem Ausland ein, die die heimische Produktion von Lebens- und Futtermitteln gefährden. Ein zentrales Anliegen der Partei ist es, den Landwirten stabile und auskömmliche Preise zu garantieren, die eine langfristige Planung und Existenzsicherung ermöglichen.
Mindesterzeugerpreise und Agrardiesel
Ein konkretes Instrument, das der BSW vorschwebt, sind gesetzlich geregelte Mindesterzeugerpreise. Diese sollen sicherstellen, dass Landwirte für ihre Produkte angemessen entlohnt werden. Die Partei spricht sich zudem dafür aus, die Streichung der Steuerermäßigung für Agrardiesel zurückzunehmen, um die wirtschaftliche Lage der Landwirte zu verbessern.
Die BSW sieht eine dringende Notwendigkeit, die Marktmacht von großen Konzernen in der Verarbeitung und im Handel zu begrenzen. Handelsabkommen, die den Druck auf die heimische Landwirtschaft erhöhen, werden abgelehnt – so beispielsweise das umstrittene Mercosur-Abkommen. Stattdessen setzt die Partei auf regionale Wirtschaftskreisläufe mit kurzen Lieferwegen. Dies soll nicht nur die Unabhängigkeit vom Weltmarkt stärken, sondern auch den ländlichen Raum fördern, indem kleine und mittelgroße Molkereien, Schlachtereien und Lebensmittelläden erhalten bleiben. Durch solche Maßnahmen wird eine Augenhöhe zwischen Landwirten und ihren Verhandlungspartnern geschaffen, was auch klimaschädliche Transporte reduzieren könnte.
BSW-Anliegen: Erhalt der Flächen
Ein weiteres zentrales Anliegen des BSW ist der Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Flächen. Die Partei fordert bezahlbaren Boden, um die landwirtschaftliche Nutzung langfristig zu sichern. Zudem wird eine Reduzierung der Bürokratie gefordert, um Landwirten die Arbeit zu erleichtern. Bei Umweltauflagen sollen Landwirte aktiv einbezogen werden, und es sollen Kompromisse mit angemessenen Übergangsfristen und unbürokratischen Fördermöglichkeiten gefunden werden. Ziel ist es, umwelt-, boden- und klimaschonende Agrartechniken zu fördern, die gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität der Betriebe gewährleisten.
Die BSW lehnt es ab, die Landwirtschaft als „Klimakiller“ zu stigmatisieren. Sie sieht die Branche als systemrelevant für die Ernährungssicherheit und den Erhalt von Agrarflächen. Die Partei spricht sich außerdem dafür aus, dass Photovoltaikanlagen nicht die agrarische Nutzung verdrängen dürfen.
Bezahlbare und sichere Pflanzenschutzmittel
Eine verlässliche Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel wird gefordert, ebenso wie bezahlbare und sichere Pflanzenschutzmittel, deren Genehmigungsverfahren unabhängig und transparent gestaltet werden sollen.
Der Tierschutz steht ebenfalls im Zentrum der politischen Ziele. Die BSW möchte Tierleid in Ställen und Schlachthöfen beenden. Dazu gehören die Gewährleistung kostendeckender Preise sowie gute Löhne und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Zudem fordert die Partei, Lebendtiertransporte auf maximal vier Stunden zu beschränken und die Zahl der Amtstierärzte zu erhöhen, um eine bessere Tierarztversorgung auf dem Land sicherzustellen.
Mehrgefahrenversicherung für landwirtschaftliche Betriebe
Im Hinblick auf die Anpassung an klimabedingte Wetterextreme setzt sich die BSW für eine bundesweite, vom Bund anteilig finanzierte Mehrgefahrenversicherung für landwirtschaftliche Betriebe ein. Darüber hinaus sollen steuerfreie betriebliche Risikoausgleichsrücklagen unterstützt werden.
Schließlich möchte die Partei den Katastrophenschutz stärken und Maßnahmen ergreifen, um Hochwasserereignisse abzumildern. Dies umfasst die Bereitstellung von Mitteln für den Auf- und Ausbau von Deichen und Dämmen sowie die Aufforstung von Wäldern mit Baumarten, die besser mit den Klimaveränderungen zurechtkommen.
Umfragen: Wo liegt das BSW?
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt zum ersten zu einer Bundestagswahl an. In aktuellen Umfragen liegt das BSW etwa vier Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 bundesweit zwischen 3,0 Prozent (Forsa) und 6,0 Prozent (INSA). Der gewichtete Durchschnitt liegt Stand 31.1. bei 4,8 Prozent. Damit würde die 5-Prozent-Hürde nicht erreicht. Bei der Europawahl 2024 hatte das BSW nur wenige Monate nach Parteigründung 6,2 Prozent der Stimmen erreicht.
Haltung zum Ukraine-Krieg
Vor allem im Osten Deutschlands punktet Sahra Wagenknecht wegen ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg. Erst kürzlich erklärte die Parteichefin in einem Interview, nach der das BSW benannt ist, dass sie einen Waffenstillstand für möglich hält. Dazu müsste es aber Verhandlungen gegen und an der Frontlinie die Waffen schweigen.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Eine Grüne Woche ohne Tiere? Als eine Woche dem Start der Messe in Berlin bekannt wurde, dass in Märkisch-Oderland (Brandenburg) die Maul- und Klauenseuche (MKS) ausgebrochen ist haben die Ämter und der Veranstalter entschieden, dass Rinder, Ziegen, Schafe und Alpakas der Grünen Woche 2025 (17. bis 26.1.2025) in diesem Jahr fernbleiben müssen. Schweine gibt es bereits seit längerem aus veterinärtechnischen Gründen auf der Messe nicht mehr. In der Tierhalle bietet sich deshalb allen Tierfreunden auch ein trauriges Bild: In den Boxen stehen Plastik-Tiere.

Doch die Stimmung auf der Grünen Woche ist dennoch ungetrübt. Die Messe Berlin zieht nach dem ersten Wochenende eine rundum positive Bilanz. Knapp 100.000 Besucherinnen und Besucher kamen an den ersten drei Veranstaltungstagen in die Hallen unterm Funkturm, teilte die Messe am Montag (20.1) mit.
Bildergalerie: Impressionen von der Grünen Woche 2025
Gute Stimmung auf der Grünen Woche
Die Messeleitung zeigt sich äußerst zufrieden. „Die gute Stimmung auf der Grünen Woche 2025 spiegelt sich in den Besucherzahlen und auch im Feedback wider: Die Grüne Woche ist eine Instanz und lockt ein vielfältiges Publikum auf das Berliner Messegelände“, sagt Lars Jaeger, Direktor der Grünen Woche.
Grüne Woche 2025: Höhepunkte und Ausblick auf die kommenden Tage
young generation hub: Die Halle 6.2b steht noch bis Freitag, den 24. Januar, ganz im Zeichen der Berufsorientierung für Jugendliche. Hier können sie rund 80 handwerkliche Ausbildungsberufe kennenlernen und hautnah erleben – sei es beim Sägen, Hämmern oder Schrauben. Neu ist der lange Donnerstag von 10 bis 18 Uhr.
Startup-Days: Am 21. und 22. Januar präsentieren junge Unternehmen aus der Agrartechnologie- und Foodbranche ihre Ideen in kurzen Pitches der Jury und dem Publikum (Halle 27).
Hippologica: Das Reitsportturnier der Grünen Woche findet vom 24. bis 26. Januar statt und bringt mit den Disziplinen Voltigieren, Hindernisfahren, Dressur und Springen Olympiastimmung in die Hallen.

Ost-Agrarminister und die GAP
Auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker nutzen die Gelegenheit, sich auf der Messe zu treffen und auszutauschen. So haben die sich Ost-Agrarminister mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesbauernverbände getroffen. Bei einem Treffen (17.1.) bekräftigten sie ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Kappung und Degression der Direktzahlungen. Es dürfe keine Diskussion „groß gegen klein“ und keine Förderung nach „Bedürftigkeit“ geben, hieß es im Anschluss der Zusammenkunft, die auf Einladung von Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Dr. Till Backhaus (SPD) stattfand.
Um ihre agrarpolitischen Ziele zu erreichen, wollen die ostdeutschen Bundesländer noch intensiver zusammenarbeiten. „Wir werden unsere Kommunikation in Richtung Brüssel und Berlin künftig eng abstimmen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, der am Rande der Grünen Woche in Berlin Vertreter der Agrarressorts sowie die Spitzen der ostdeutschen Bauernverbände an einen Tisch brachte. Bereits in den vergangenen Wochen hatten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein gemeinsames Positionspapier zur Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028 erarbeitet, das auch die Zustimmung der Bauernverbände fand und in Kürze an EU-Agrarkommissar Christophe Hansen gehen wird.
Neuer Agrarkommissar Christophe Hansen stellt sich vor
Apropos Christophe Hansen: Der neue EU-Agrarkommissar absolvierte an den ersten Messetagen einen Vorstellungsmarathon und hinterließ insbesondere bei Landwirtinnen und Landwirten einen guten Eindruck. Nach seinem kurzen Statement auf dem Neujahrsempfang des Bauernverbandes im Palais am Funkturm wurde der 42-jährige Luxemburger teilweise stehend beklatscht.
Zuvor hatte er bekräftigt, dass Themen wie Ernährungssicherheit, offene Märkte und Maßnahmen gegen die Überalterung der europäischen Landwirtschaft drei Stichwörter sind, die weit oben auf seiner Agenda stehen. Die GAP nach 2027 will Hansen „gezielter, einfacher und wirksamer“ ausgestaltet wissen, um den Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen zu erleichtern. Hansen betonte, dass sowohl sein Vater als auch sein Bruder selbst Landwirte seien und er deshalb die Probleme der Bäuerinnen und Bauern gut kenne.

Der Neujahrsempfang des Deutschen Bauernverbandes wurde zum Stelldichein von Verbandsvertretern, Politikerinnen und Politikerinnen sowie Landwirtinnen und Landwirtinnen. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl erklärte der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Rukwied: „Die nächste Bundesregierung steht vor der großen Aufgabe, den Menschen wieder Optimismus zu geben! Die Stimmung ist derzeit gedämpft – das ist angesichts der zahlreichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, verständlich. Dennoch brauchen wir dringend einen positiveren Blick in die Zukunft. Unsere Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche und wird von der Gesellschaft gebraucht.“

MKS ist bei vielen Besuchern ein wichtiges Thema
Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche war vor allem unter den Vertreterinnen und Vertretern des Berufsstandes ein allgegenwärtiges Thema. Vor allem Betriebe in Ostdeutschland mussten ihre Biosicherheitsmaßnahmen ausbauen.
Video: Maul- und Klauenseuche-Ausbruch: Was bedeutet das für die Betriebe?
Grüne Woche 2025: Programmübersicht im Internet
Noch bis Sonntag, 26.1., können sich Besucherinnen und Besucher auf kulinarische Köstlichkeiten, regionale und exotische Reisetipps sowie blumige und tierische Erlebnisse freuen. Weitere Informationen finden Interessierte in der Programmübersicht. In Halle 25 präsentiert sich auch die Bauernzeitung mit einem eigenen Stand.


Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Lange Zeit galt der Sanddorn als robuste Pflanze, die wenig Pflegeaufwand erfordert. Vor etwa zehn Jahren begann allerdings ein großflächiges Absterben der Spezialkultur in Mecklenburg-Vorpommern. Sowohl Plantagen als auch Wildbestände entlang der Küste waren betroffen. In der Konsequenz rodeten zahlreiche Betriebe ihre Anbauflächen und gaben die Vermarktung der „Zitrone des Nordens“ komplett auf.
Forst Schneebecke zieht sich aus Sanddorn-Geschäft zurück
Auch einer der größten Anbauer in MV, Forst Schneebecke in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen), zog sich wegen des Problems im Jahr 2022 aus dem Sanddorn-Geschäft zurück. Als die Bauernzeitung im Jahr 2015 den Betrieb für eine Titelreportage besuchte, schien die Sanddornwelt noch in Ordnung zu sein. Schon seit 1999 baute der Betrieb Sanddorn als Zweitkultur an und expandierte in den folgenden Jahren zu einem der erfolgreichsten Vermarkter der gesunden Frucht.

Noch im Jahr 2010 pflanzte Geschäftsführer Benedikt Schneebecke mehr als 28.000 Jungpflanzen, um die wachsende Nachfrage nach den orangefarbenen Beeren zu bedienen. Auf rund 60 ha Anbaufläche konnte der Betrieb in den Jahren mit einer Ausbeute von mehr als 120 t Beeren rechnen. Heute bewirtschaftet Schneebecke nur noch eine Fläche von sechs Hektar, die ihm als Versuchsfläche dient. Denn bisher konnten die Ursachen des Sanddornsterbens noch nicht vollumfänglich ermittelt werden.
Wissenschaft erforscht Sanddorn-Sterben
Obwohl Wissenschaftler der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) MV gemeinsam mit dem Institut für Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau des Julius-Kühn-Instituts (JKI) den Ursachen im Rahmen eines vierjährigen Forschungsprojektes auf den Grund gegangen sind. Ende 2024 endete das Verbundprojekt, das trotz intensiver Untersuchungen keine klar definierte Krankheit finden konnte. Das Problem liege vermutlich im Zusammenspiel verschiedener Erreger in Kombination mit Witterungsextremen. So habe man eine Reihe Pilze gefunden, die aber wohl per se im Boden vorhanden seien. Möglicherweise würden sie aber bei einem Extrem wie der Trockenheit der vergangenen Jahre zum Problem.
Gezielte Bewässerung
„Wir stellen fest, dass Sanddorn in Kultur doch mehr Aufmerksamkeit braucht als bisher angenommen. Gezielte Bewässerung fördert das Wachstum dieses Wildobstes, das bislang als trockentolerant galt. Für die Bewässerung sprechen auch die in den letzten Trockenjahren vielerorts gefallenen Grundwasserspiegel. Gezielt bedeutet, Menge und Zeitpunkt der Bewässerung genau an die Bedürfnisse der Pflanzen am jeweiligen Standort anzupassen“, sagt Projektbearbeiterin Daniela Kuptz von der LFA.
Bewässerte Bestände seien nicht gegen die Krankheit gefeit, würden aber grundsätzlich kräftiger wachsen und mehr Ertrag bringen.
Sanddorn-Sterben: Wassermangel, Boden, Frost
Auch die Bodenbedingungen haben hier nach Kuptz einen Einfluss: Auf lehmigen Sandböden scheinen die Pflanzen deutlich wüchsiger als auf reinen Sandböden zu sein. Wassermangel und Bodenqualität können aber nicht die Erklärung dafür sein, dass überall massiv Sanddorn stirbt – so die Erkenntnis. Die Forscher stellten fest, dass das Sterben mit milderen Wintern korreliert, in denen längere Frostperioden ausblieben. Frost könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, natürliche Erreger einzudämmen. Die veränderten klimatischen Bedingungen könnten somit die Ausbreitung der Pilze fördern und die Sanddornbestände schwächen. Diese Erkenntnis verdeutliche die Notwendigkeit weiterer Forschung, um Anpassungsstrategien für den Anbau zu entwickeln.
Kritik am Forschungsprojekt In Mecklenburg-Vorpommern
Nach Meinung von Schneebecke war das Forschungsprojekt viel zu theoretisch und wenig hilfreich. Bei den Untersuchungen sei es in erster Linie um die schädigenden Pilz-Kulturen gegangen. Jeder Praktiker, der vom Sanddornsterben betroffen gewesen sei, sei sich jedoch sicher, dass es sich dabei um Sekundärerkrankungen gehandelt habe. Wie sonst erklärt sich das Phänomen, dass männliche Pflanzen nicht betroffen sind und auch weibliche Pflanzen erst ab dem ersten Jahr mit starkem Fruchtbesatz betroffen sind, so Schneebecke.
Alternative Direktvermarktung
„Bevor die Ursache nicht geklärt ist, werde ich Sanddorn nicht wieder anpflanzen. Das Kosten-Risiko ist einfach viel zu hoch“, sagt der Unternehmer. Der Fokus seines Betriebes liege inzwischen auf dem Weihnachtsbaumanbau. Mit rund 200 ha habe er mittlerweile fast die größten Flächen in den ostdeutschen Bundesländern. Zudem hat Schneebecke mit dem Haselnussanbau auf einer Fläche von 15 ha begonnen.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Der größte Stausee der USA – der Lake Mead – hat zwei Drittel seines Wassers verloren. Es sind dramatische Bilder von dem künstlichen See, der durch den Hoover Damm am Colorado River aufgestaut wird. An den riesigen Felsen, die die Talsperre umgeben, ist die ehemalige Wasserkante wie ein meterhoher Badewannenring deutlich zu sehen. Nicht nur die Millionenmetropole Las Vegas mit Springbrunnen, Golfplätzen und Tausenden Pools wird von dort versorgt, sondern die gesamte Region mit mehr als 25 Millionen Menschen.
Dürre: Landwirte lassen Felder brach liegen
Nach zahlreichen Dürre-Jahren droht der Westen der USA zum Ödland zu werden, teilweise muss das Wasser rationiert werden. In der Folge lassen Landwirte ihre Felder brachliegen oder stellen auf weniger Wasser-intensive Kulturen um.
Trump leugnet den Klimawandel
Was hat das mit uns zu tun? Auch wenn Las Vegas am anderen Ende der Welt liegt, betrifft uns das Thema mehr, als wir im ersten Moment denken. Der Wassermangel im Lake Mead ist Sinnbild für das Voranschreiten des Klimawandels. Am 20. Januar wird Donald Trump sein Amt als 47. Präsident der Vereinigen Staaten von Amerika antreten. Trump leugnet den Klimawandel und hat bereits angekündigt, dass er erneut aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten will.
Weniger Klimaschutz in den USA
Zudem könnte er diesmal auch aus der Klimarahmenkonvention aussteigen, was bedeuten würde, dass die USA auf unbestimmte Zeit nicht mehr an den globalen Klimaverhandlungen teilnehmen und als wichtiger Geldgeber ausfallen würden. Trump will zudem Naturschutzgebiete verkleinern, um Ölbohrungen und Bergbau zu ermöglichen, berichtete die „New York Times“. All das kann dazu führen, dass die Klimaschutzziele in weite Ferne rücken.
Wassermangel auch in Deutschland
Wassermangel ist auch für die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland ein allgegenwärtiges Thema. Die Folgen von Hitze und Dürre einerseits sowie Starkregen mit Überschwemmungen andererseits bekommen die Bauern überall zu spüren. Im Vergleich zum Westen der USA ist Deutschland ein wasserreiches Land. Aber auch hier sind sinkende Wasserstände zu beobachten – beispielsweise am Straussee in Brandenburg, Flüsse, wie die Schwarze Elster in Sachsen, trocknen aus. Im Zuge des Klimawandels ist mit einer weiteren Veränderung der Niederschläge zu rechnen, insbesondere der jahreszeitlichen Niederschlagsverteilung.
Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es immer wärmer und trockener, und die Verdunstung nimmt zu. Entscheidend für die Natur und die Landwirtschaft ist nicht nur, wie viel Niederschlag in einem Jahr insgesamt fällt, sondern auch, dass das Wasser zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung steht.
Klimaschutz kostet Geld
Wir Menschen neigen zur Bequemlichkeit. Klimaschutz ist unbequem. Er kostet Geld und setzt die Bereitschaft zu Veränderung voraus. Hier braucht es einen langen Atem und stetige Überzeugungsarbeit. Der Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Hubertus Paetow, hat zum Jahreswechsel gefordert, dass Zielvorgaben zu Ernährungssicherheit, Klimaschutz, Artenvielfalt, Boden- und Gewässerschutz fachlich und wissenschaftlich untermauert sein müssen. Er forderte eine Kombination aus Zielvorgaben und unternehmerischer Freiheit. Ziel müsse es sein, das Agrar- und Ernährungssystem zukunftsfest und krisensicher zu gestalten, so Paetow. Nur wenn die Bauern für sich eine Zukunft sehen, sind sie auch zu Veränderungen bereit. Was nichts bringt, sind erhobene Zeigefinger. Dramatische Bilder – wie die vom Lake Maed – können aber das Bewusstsein schärfen.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Wie weiter mit der GAP? Wie können Landwirte ihre Tiere künftig besser vor dem Wolf schützen? Und warum sprechen alle über Bürokratieabbau – aber nichts passiert? Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat am Mittwoch (8.1.) seine Forderungen und Ziele für die Landwirtschaft vorgestellt.
Die GAP muss einfacher werden
Schulze, der zurzeit auch Sprecher aller Unions-Agrarminister ist, richtete seinen Blick zuerst auf die GAP – die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Eine neue Bundesregierung müsse sich sehr schnell positionieren, wie es mit der GAP nach 2027 weitergeht. „Die Menschen im ländlichen Raum haben hohe Erwartungen an die Bundestagswahl. Sie hoffen, dass sich etwas ändert“, sagte Schulze. Die GAP müsse einfacher werden, es sollte weniger Dokumentationspflichten geben. „Der Landwirt soll auf dem Acker arbeiten und nicht im Büro“, erklärte der Minister.
Direktzahlungen: „Wir brauchen kein Bürgergeld für Landwirte“
An den Direktzahlungen für Landwirte will Schulze festhalten. „Wir brauchen weiterhin eine Einkommensgrundstützung über die Direktzahlungen“, sagte der Sprecher der Länderagrarminister von CDU und CSU in Berlin. Die europäische Landwirtschaft stehe vor enormen Herausforderungen und ein Ausgleich für die im Vergleich zu anderen Weltregionen höheren Produktionskosten sei unabdingbar, begründete er seine Position. Von der Forderung, die Basisprämie der europäischen Agrarförderung mittelfristig auslaufen zu lassen, rückt die Union damit ab.
Zum neuen Brüsseler Agrarkommissar Christophe Hansen habe er ein gutes persönliches Verhältnis, betonte der ehemalige Europaabgeordnete. Dessen Vorstellungen für eine Orientierung der Direktzahlungen an der Bedürftigkeit der Betriebe teilt er jedoch nicht: „Wir wollen kein Bürgergeld für Landwirte.“
Betriebe im Osten nicht benachteiligen
Es sei wichtig, die Bedürftigkeit der Landwirte zu klären. Mit Blick auf die unterschiedliche Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in Ost und West erklärte er, dass die unterschiedlichen Betriebsgrößen berücksichtigt werden müssten. „Große Betriebe dürfen nicht benachteiligt und die Betriebe dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden“. Er habe oft das Gefühl, dass vor allem im Osten die Unterschiede zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft besonders hervorgehoben werden.
Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden
Beim Thema Wolf drängt Schulze auf schnelle Entscheidungen: Zur flexiblen Regulierung müsse der Wolf schnell in Anhang V der FFH-Richtlinie aufgenommen werden. Um Weidetierhalter zu entlasten, müsse der Wolf außerdem ins Jagdrecht aufgenommen werden. Der Minister fordert ein ausgewogenes Wolfsmanagements ohne Beeinträchtigung der Weidewirtschaft.
Abbau von Bürokratie gefordert
Mangelnde Fortschritte beim Bürokratieabbau beklagte Schulze in Richtung aktueller Bundesregierung. Prüfaufträge und Praxischecks liefern bislang keine konkreten Ergebnisse. Zwar habe es nach den Bauernprotesten 194 Vorschläge zum Abbau von Bürokratie gegeben – bei den Landwirten habe sich aber kaum etwas geändert. Auch beim Thema Stoffstrombilanz habe sich bisher nichts bewegt.
Mit Blick auf den Pflanzenschutz forderte Schulze ein Bekenntnis zu modernen Pflanzenschutzmitteln, die Förderung von innovativen Ansätzen und den Abbau bürokratischer Hürden. Bei der SBR-Krankheit, die besonders Zuckerrüben und Kartoffeln befällt, gebe es hohe Ertragsausfälle. Hier seien Notfallzulassungen von Pflanzenschutzmitteln nötig. „Wir brauchen flexibleres Handeln“, erklärte Schulze mit Blick auf das Bundesumweltamt.

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Die Milchproduktion hat der Agrargenossenschaft Teichel im zurückliegenden Jahr erneut wirtschaftliche Stabilität verliehen. „In Zeiten guter Milchpreise ist es umso bedauerlicher, wenn unsere Kühe aufgrund der weniger guten Futterqualität aus der Ente 2023 ihr Leistungspotenzial nicht voll abrufen konnten“, sagt Vorstandschef Dr. Stefan Blöttner. Die Energieerzeugung trug ebenso dazu bei, dass der Betrieb für das Jahr 2024 ein positives Ergebnis wird vorweisen können. Im Ackerbau enttäuschten die Erträge und die Preise. „Unsere Sommergerste hat aber Brauqualität“, freut sich Pflanzenbauvorstand Eric Engelmann nach dem Verkauf erster Partien.
Direktvermarktung mit einer schwarzen Null
Anders als der Mais, der zum Teil mit recht hohen Trockensubstanzanteilen ins Silo kam, konnten die Luzerne- und Grassilagen in Menge und Qualität überzeugen. Für die Direktvermarktung bilanziert Blöttner eine schwarze Null; das dürfte auch bei der Mutterkuhtochter MKH-Agrar GmbH der Fall sein.

Mit Blick ins neue Jahr freuen sich Blöttner und der Leiter der Milchproduktion, Philipp Rose, auf die neue Kooperation mit der Agrargenossenschaft Kamsdorf: „Unsere Jungrinder werden künftig von den Kamsdorfer Kollegen aufgezogen, an die wir schon eine ganze Weile unsere Bullenkälber abgeben. Mit 140 bis 150 Tagen gehen unsere Milchkälber nach Kamsdorf, mit 12 bis 13 Monaten kommen sie zur Erstbesamung zu uns zurück. Aktuell haben wir ein Erstabkalbealter von 23,56 Monaten“, erklärte Rose. Gezielt will man dann gesextes Sperma einsetzen. Die ersten in Kamsdorf aufgezogenen Tiere werden im Sommer 2026 Milch geben.
Pläne zur Aufzucht der Jungrinder
Seit dem Abschied von der zu teuren Jungrinderaufzucht vor knapp einem Jahr, womit man den Rinderstall in Neckeroda schließen konnte, kaufte die Agrargenossenschaft zur Remontierung des Bestandes auch Tiere von einem namhaften Thüringer Betrieb zu. Zudem gibt es aktuell noch gut 100 eigene tragende Färsen, die in Teichröda genügend Platz haben. „Ärgerlich ist natürlich, dass im Laufe des vorigen Jahres die Färsenpreise so stark gestiegen sind“, sagt Blöttner. Die Pläne zur Jungrinderaufzucht hat man unter anderem mit dem Hoftierarzt und dem Rindergesundheitsdienst diskutiert. Der Gesundheitsstatus der Kühe genieße eine besonders hohe Priorität in Teichel.

Nach langer Vorbereitungszeit konnten Blöttner und Engelmann im Dezember ein bedeutendes Geschäft abschließen: „Unser regionaler Wasserzweckverband hat uns einen nahegelegenen Tiefbrunnen verkauft, der für die öffentliche Wasserversorgung nicht mehr gebraucht wird“, berichtet Blöttner. Seit der Fertigstellung der Talsperre Leibis-Lichte (die fast so hoch ist wie die Rappbode-Talsperre) im Jahr 2006 gibt es Böttner zufolge genügend Trinkwasser in Ostthüringen. Bislang bezieht die Genossenschaft per Ausnahmegenehmigung Wasser des Flachbrunnens, der einst die öffentliche Versorgung von Teichröda sicherte und den schon zu DDR-Zeiten die LPG nutzte.
Brunnen soll Bedarf an Wasser absichern
Ziel sei es, den kompletten Wasserbedarf von 100 m3 am Tag mit dem neuen Brunnen abzusichern. Die Leitungen verlaufen direkt am Betriebsgelände entlang, sodass mit relativ kleinem Aufwand der Anschluss an das betriebliche Leitungssystem hergestellt werden kann. „In dem Zuge wollen wir auch in die Hygienisierung unseres Tränkwassers investieren.“ Zudem wird in Teichröda ein zweiter „Wassergalgen“ für das Befüllen der Weidetränken errichtet. Dadurch verkürzen sich die Wege für das Mutterkuhteam in der Weidesaison.

Anders als zunächst geplant, begann die Demontage des alten BHKW nun doch schon Mitte Dezember. Der alte Motor steht in einer Halle. Die Firma enertec Katftwerke GmbH hat einen Behelfsmotor mit 50 kW angeschlossen, damit das Betriebsgelände weiter mit Wärme versorgt ist. „Am 14. Januar kommt dann das neue BHKW samt Container“, so Engelmann. Mit dem 50-kW-Aggregat verkaufe man in den vier Wochen der Improvisation natürlich nicht gerade viel Strom. Beim geplanten Austausch eines abgenutzten Rührwerks im Vergärer zeigte sich, dass das zweite Rührwerk gebrochen war. Somit herrschte Klarheit, warum sich eine starke Schwimmschicht bilden konnte.
Zwillinge bei den Charolais-Rinder
Mitte Dezember waren die letzten Charolais-Herden im Winterquartier. Schon bei den ersten Abkalbungen gab es Zwillinge. Dass Arbeit ein großes Vergnügen ist, bestätigt Mutterkuhchef Jens Schmidt. Ende November war er auf Dienstreise, die ihn nach Moulins nordwestlich von Lyon führte. Hier fand das nationale Finale 2024 der besten Charolais-Rinder Frankreichs statt. Nachdem im vorigen Jahr gleich zwei Bullen Probleme hatten – einer verletzte sich am Lauf; der zweite wollte/konnte nach seinem erfolgreichen Einsatz 2023 nicht decken – musste Ersatz ran. Von einem Elsässer Züchter erwarb Jens Schmidt direkt einen preisgekrönten einjährigen Sillon-Sohn, der nach seiner Heimatquarantäne Anfang Januar in Teichröda ankommen wird.


Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein

Die Zukunft der Nutztierhaltung in Sachsen-Anhalt – eine Gratwanderung zwischen Wunsch und Realität?! Um diese Frage bzw. Aussage drehte sich das Agrarforum Anfang Dezember an der Fachschule für Landwirtschaft in Haldensleben. Die Veranstalter, die Junglandwirtegruppe „The Farmers“ der Fachschule, der Schulförderverein und der hiesige Landjugendverband, hatten dazu eine illustre Runde an Podiumsgästen eingeladen.
Viehbestand geht zurück
Eine Analyse der gegenwärtigen Situation der Nutztierhaltung im Land lieferte Prof. Dr. Heiko Scholz von der Hochschule Anhalt in seinem Impulsvortrag. Angesichts der bundesweit geringsten Viehbesatzdichte (0,3 GVE/ha) sei es tatsächlich eine Gratwanderung, sagte er. Mit sinkenden Viehbeständen gehe auch Wertschöpfung verloren. Zudem sei das Image der Viehhaltung in der gesellschaftlichen Diskussion schlecht. Schlagwort schlechthin sei bei allem das Tierwohl, allerdings sei dieses nicht messbar.
Geld fehlt überall
Die Borchert-Kommission habe ein tolles Papier für den Umbau der Tierhaltung entwickelt, doch sei kein Geld zur Flankierung da. Die Leute werden aber auch künftig nicht mehr Tierwohl-Produkte kaufen bei schwieriger wirtschaftlicher Lage, prognostizierte er.
Der auch in Sachsen-Anhalt bestehende enorme Sparbedarf im Haushalt schlage auf die Landwirtschaft durch. „Das bedeutet Abbau statt Umbau“, zitierte er an dieser Stelle Landesbauernverbandspräsident Olaf Feuerborn.
Schlechtes Image
Das schlechte Image und die unsicheren Rahmenbedingungen verminderten den Zuspruch junger Leute für die Landwirtschaft. Ein Übriges täten enorme verwaltungstechnische Vorgaben und die wuchernde Bürokratie. Ein Abbau Letzterer sei „eher illusorisch“. Umweltauflagen, z. B. aus Bundes-Immissionsschutzgesetz und TA Luft, seien „Genickbrecher“ für die Tierproduktion.
Nach Ansicht von Scholz wird sich der Abbau der Viehbestände fortsetzen. Angesichts „veganer Fruchtfolgen“ stelle sich die Frage, was aus den Nebenprodukten wird, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Die Nahrungskonkurrenz durch Huhn und Schwein sei weit größer als durchs Rind, das das Grünland nutze.
Kaum noch Tierhaltung
„Wir verspielen hier gerade eine Chance“, betonte er. Bodenfruchtbarkeit, Bodenleben und intakte Kreisläufe bräuchten organische Wirtschaftsdünger. Selbst 85 % der Ökobetriebe hielten kein Vieh. Hemmnisse hierfür seien ökonomische Zwänge, Personalmangel und bürokratische Hürden. Ohne Tierhaltung fehle es aber an Wertschöpfung, und die immer wieder beschworenen geschlossenen Kreisläufe würden zur Legende. „Verlierer des Abbaus der Viehbestände werden die ländlichen Räume sein“, machte Scholz deutlich.
Weniger wirtschaftlich
Dr. Matthias Löber, Geschäftsführer der RinderAllianz, versuchte sich an der Frage nach einer Trendumkehr. Er betonte, dass Tierzucht ein jahrhundertealter, generationenübergreifender, mit Emotionen und Traditionen verbundener Wert sei, was sich auch bei den Jungzüchtern zeige. Deren Veranstaltungen, aber auch Tierschauen und Fachmessen würden Mut machen und zudem zeigen, „dass Potenzial da ist“.
Der Einbruch der Tierbestände sei angesichts explodierender Weltbevölkerung und abnehmender Agrarflächen „moralisch nicht zu akzeptieren“. Es gehe um Ernährungssicherheit und Proteinversorgung über Milch und Fleisch, insbesondere von Gunststandorten wie in Deutschland.
Nutztierhaltung ist ein sensibles Thema
Für Landesagrarminister und Bundesagrarstaatssekretär a. D. Hermann Onko Aeikens ist die Nutztierhaltung ein sehr sensibles Thema. Viehhaltung konzentriere sich in Deutschland auf Grünlandstandorten und schlechteren Böden, wo auch die Betriebe kleiner seien. Sachsen-Anhalt habe im Schnitt die besten Böden, und er wäre froh, wenn hier die jetzige Viehhaltung erhalten bliebe.
Wegen ihrer geringeren Wirtschaftlichkeit werde sie bei Rationalisierungen zuerst abgeschafft. Größere Betriebe hätten Kostenvorteile, aufgrund ihrer Arbeitnehmerstruktur aber eher Personalprobleme. Die Politik müsse alle diese Dinge aufnehmen, sagte Aeikens, der sich optimistisch zeigte und außerdem davon überzeugt, „dass Politik lernfähig ist“.
Diskussion zur Tierproduktion
Dr. Andreas Tyrpe, amtierender Abteilungsleiter im Agrarministerium, fasste sich danach kurz und erklärte, die Landespolitik sei an den Themen dran: „Wir müssen eine wissenschaftlich und fachlich fundierte Diskussion zur Tierproduktion in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen.“ Den limitierenden Faktor bei der Unterstützung der Tierhaltung sieht er in fehlenden Finanzmitteln.
Martin Dippe, stellvertretender Vorsitzender des Forums Natur Sachsen-Anhalt, verwies auf die Etablierung des Wolfes im Land. Damit sei Planungssicherheit für Weidetierhalter weg. Das Forum, ein Verbändezusammenschluss, werde sich künftig diesen und anderen Themen im Sinne des Berufsstandes widmen und dessen Interessen gegenüber der Politik mit einer Stimme vertreten.
Optimismus bei der Jugend
Julius Kurzweg, Herdenmanager der Agrarerzeugergemeinschaft Pretzier, sagte, die Tierproduktion werde Veränderungen unterliegen, „wir sollten die Zukunft aber nicht so schwarz sehen“. Es bringe nichts, alten Zeiten nachzutrauern. Die Branche müsse sich von „Zwängen des Jammerns“ befreien, die Gesellschaft wolle das nicht hören. Die Tierproduktion werde ein Geschäftszweig bleiben, „wenn wir es gut anstellen“.
Märkte werden auch künftig da sein. Es gelte, global neue mit Weitsicht zu erschließen. Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist nach Ansicht des Junglandwirts 15 Jahre zu spät. Zum Thema Arbeitskräfte sagte er, mit Mitarbeitern, die kaum Deutsch können, sei keine fachlich fundierte Arbeit möglich. Er glaube, so Kurzweg, dass die Diversifizierung der Betriebe der Schlüssel zum Erfolg der Landwirtschaft sein wird.
Zum Ende des von Fachschüler Lorenz Böcker moderierten Forums entspann sich eine intensive Diskussion, auch mit einigen der zahlreichen Zuhörer im Saal.fi

Unsere Top-Themen
- Der kleine Bauer Lindemann
- Brunnen brauchen gute Filter
- Effizient und nachhaltig füttern
- Märkte und Preise
Informiert sein